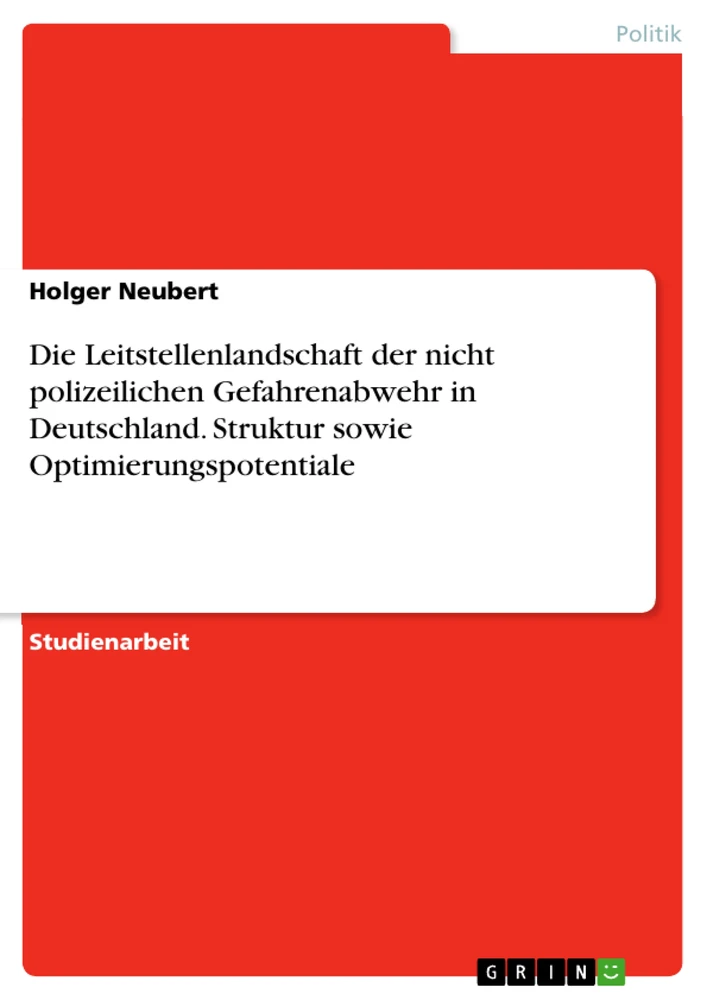Die Arbeit behandelt das Thema Leitstellenlandschaft in Deutschland. Insbesondere sollen die folgenden beiden Fragestellungen geklärt werden: Wie ist die Leitstellenlandschaft im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland strukturiert? Welches strukturelle Optimierungspotential besteht hinsichtlich des Aspektes der Regionalisierung in den einzelnen Bundesländern?
Als erstes professionelles Glied der Rettungskette stellen die Leitstellen neben den Feuerwehren und den Rettungsdiensten einen wichtigen Baustein im System der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr dar. Dabei unterliegt die in Deutschland derzeit sehr heterogen geprägte Leitstellenlandschaft im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte einem starken Wandel. Aus den einstigen Telefonzentralen entwickeln sich vielerorts hochkomplexe Schaltstellen, welche neben der Notrufannahme und Alarmierung der Einsatzkräfte auch vielfältige Aufgaben im Bereich der Führungsunterstützung wahrnehmen.
In einigen Bundesländern, beispielsweise Brandenburg und Rheinland-Pfalz, werden landesweite Konzepte zur Optimierung der Leitstellenstruktur verfolgt, die zum einen einheitliche Qualitätsstandards und zum anderen Kosteneinsparungen infolge der bedarfsgerechten Zusammenlegung von Leitstellen mehrerer Gebietskörperschaften zu Regionalleitstellen zum Ziel haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hintergrund der Arbeit
- 2. Methode
- 3. Entwicklungsgeschichte: von der Telefonzentrale zur Integrierten Regionalleitstelle
- 3.1. Ausgangssituation
- 3.2. Integration
- 3.3. Regionalisierung
- 4. Leitstellenlandschaft in Deutschland
- 4.1. Ist-Zustand im Jahr 2016
- 4.2. Optimierungspotential
- 4.3. Siedlungsstruktureller Ansatz zur Optimierung der zukünftigen Leitstellenlandschaft
- 5. Diskussion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Struktur der Leitstellenlandschaft in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr Deutschlands und analysiert Optimierungspotenziale im Hinblick auf Regionalisierung. Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und Datenanalyse des Jahres 2016.
- Entwicklung der Leitstellen von Telefonzentralen zu Integrierten Regionalleitstellen
- Der aktuelle Zustand der Leitstellenlandschaft in Deutschland im Jahr 2016
- Identifizierung von Optimierungspotenzialen in der Leitstellenstruktur
- Bewertung eines siedlungsstrukturellen Ansatzes zur Optimierung
- Methodische Vorgehensweise bei der Datenrecherche und -analyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hintergrund der Arbeit: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung von Leitstellen als professionelles Glied in der Rettungskette der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Es hebt die Heterogenität der deutschen Leitstellenlandschaft hervor und benennt den Wandel von einfachen Telefonzentralen zu komplexen Schaltstellen. Der Fokus liegt auf landesweiten Konzepten zur Optimierung der Leitstellenstruktur in einigen Bundesländern, die auf einheitliche Qualitätsstandards und Kosteneinsparungen durch Zusammenlegungen abzielen. Die zentralen Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert: die Struktur der Leitstellenlandschaft und das Optimierungspotenzial hinsichtlich der Regionalisierung.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Eine Datenbankrecherche mit dem Suchbegriff „Leitstelle AND (Feuerwehr OR Rettungsdienst)“ ergab 42 relevante Treffer. Zusätzlich wurde eine Handrecherche in Literaturverzeichnissen durchgeführt. Die Arbeit von Ruckdeschel, welche die Leitstellenlandschaft zum 31.03.2016 darstellt, bildet eine zentrale Datenquelle. Ergänzend wurden Einwohnerzahlen und -dichten aus dem Gemeindeverzeichnis des statistischen Bundesamtes für das Jahr 2016 herangezogen, da diese für die Planung von Leitstellenbereichen entscheidend sind.
3. Entwicklungsgeschichte: von der Telefonzentrale zur Integrierten Regionalleitstelle: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Leitstellen von den einfachen Telefonzentralen der 1950er Jahre hin zu den heutigen komplexen Integrierten Regionalleitstellen. Es werden die Aspekte der Integration und Regionalisierung detailliert dargestellt, beginnend mit der Ausgangssituation, in der die Notrufnummern 110 und 112 hauptsächlich aus dem Telefonnetz der Großstädte erreichbar waren. Der Wandel hin zu einem flächendeckenden Notrufsystem wird erläutert und die Entwicklungsschritte bis zur heutigen modernen Leitstellenstruktur nachgezeichnet.
4. Leitstellenlandschaft in Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert den Ist-Zustand der Leitstellenlandschaft in Deutschland im Jahr 2016 basierend auf den Erhebungen von Ruckdeschel und dem Fachverband Leitstelle e.V. Es analysiert die aktuelle Struktur und leitet daraus Optimierungspotenziale ab. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung eines möglichen Lösungsansatzes mittels eines siedlungsstrukturellen Modells, um die zukünftige Leitstellenlandschaft zu optimieren und effizienter zu gestalten.
Schlüsselwörter
Leitstellenlandschaft, Gefahrenabwehr, Regionalisierung, Integrierte Regionalleitstelle (IRLS), Optimierungspotenzial, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notruf, Einwohnerzahl, Siedlungsstruktur, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Optimierung der Leitstellenlandschaft in Deutschland
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Struktur der Leitstellenlandschaft in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr Deutschlands und analysiert Optimierungspotenziale im Hinblick auf Regionalisierung. Der Fokus liegt auf dem Wandel von einfachen Telefonzentralen zu komplexen, integrierten Regionalleitstellen und der Entwicklung eines effizienteren Systems.
Welche Daten wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und Datenanalyse des Jahres 2016. Eine Datenbankrecherche mit dem Suchbegriff „Leitstelle AND (Feuerwehr OR Rettungsdienst)“ ergab 42 relevante Treffer. Zusätzlich wurde eine Handrecherche in Literaturverzeichnissen durchgeführt. Die Arbeit von Ruckdeschel (Stand 31.03.2016) bildet eine zentrale Datenquelle. Ergänzend wurden Einwohnerzahlen und -dichten aus dem Gemeindeverzeichnis des statistischen Bundesamtes für das Jahr 2016 verwendet.
Welche Entwicklungsstufen der Leitstellen werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung von einfachen Telefonzentralen der 1950er Jahre hin zu den heutigen komplexen Integrierten Regionalleitstellen (IRLS). Die Aspekte der Integration und Regionalisierung werden detailliert dargestellt, beginnend mit der Ausgangssituation, in der die Notrufnummern 110 und 112 hauptsächlich aus dem Telefonnetz der Großstädte erreichbar waren. Der Wandel hin zu einem flächendeckenden Notrufsystem wird erläutert.
Wie sieht der aktuelle Zustand der Leitstellenlandschaft in Deutschland aus (Stand 2016)?
Kapitel 4 präsentiert den Ist-Zustand der Leitstellenlandschaft in Deutschland im Jahr 2016 basierend auf den Erhebungen von Ruckdeschel und dem Fachverband Leitstelle e.V. Es analysiert die aktuelle Struktur und leitet daraus Optimierungspotenziale ab.
Welche Optimierungspotenziale werden identifiziert?
Die Arbeit identifiziert Optimierungspotenziale in der Leitstellenstruktur und bewertet einen siedlungsstrukturellen Ansatz zur Optimierung der zukünftigen Leitstellenlandschaft, um diese effizienter zu gestalten. Die Zusammenlegung von Leitstellen zur Kostenersparnis und zur Verbesserung der einheitlichen Qualitätsstandards wird als wichtiges Thema angesprochen.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Methodik der Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und Datenanalyse. Die zentrale Datenquelle ist die Arbeit von Ruckdeschel (Stand 31.03.2016), ergänzt durch Daten des statistischen Bundesamtes (Einwohnerzahlen, -dichten).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Leitstellenlandschaft, Gefahrenabwehr, Regionalisierung, Integrierte Regionalleitstelle (IRLS), Optimierungspotenzial, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notruf, Einwohnerzahl, Siedlungsstruktur, Deutschland.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit gestellt?
Die zentralen Forschungsfragen befassen sich mit der Struktur der Leitstellenlandschaft und dem Optimierungspotenzial hinsichtlich der Regionalisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Hintergrund der Arbeit, 2. Methode, 3. Entwicklungsgeschichte (Telefonzentrale zur IRLS), 4. Leitstellenlandschaft in Deutschland, 5. Diskussion, 6. Fazit.
- Arbeit zitieren
- Holger Neubert (Autor:in), 2019, Die Leitstellenlandschaft der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr in Deutschland. Struktur sowie Optimierungspotentiale, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594509