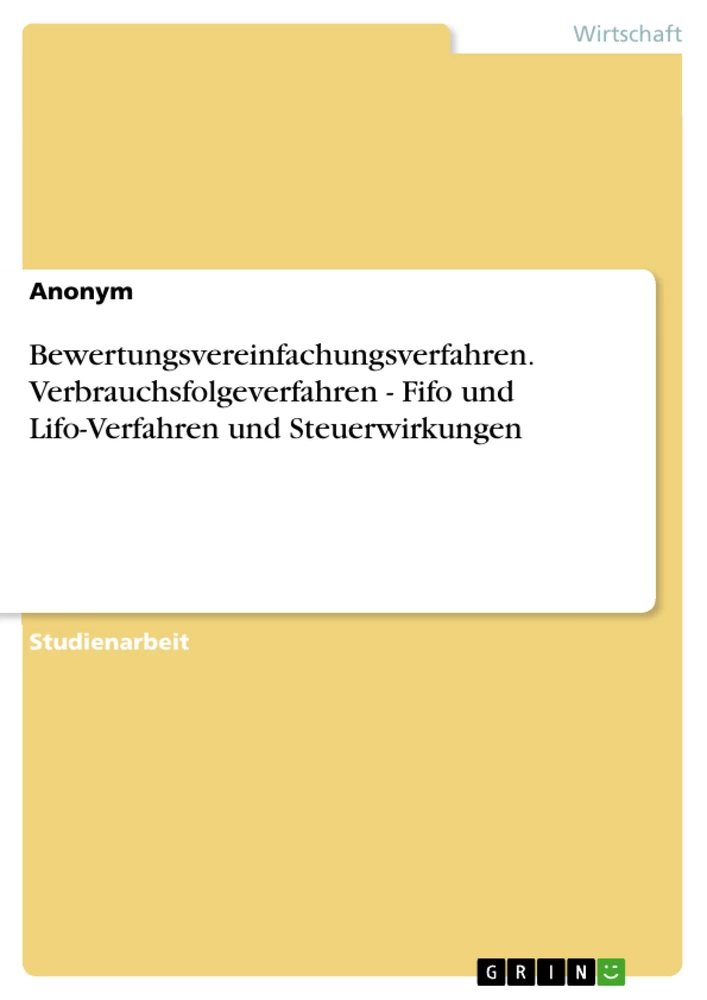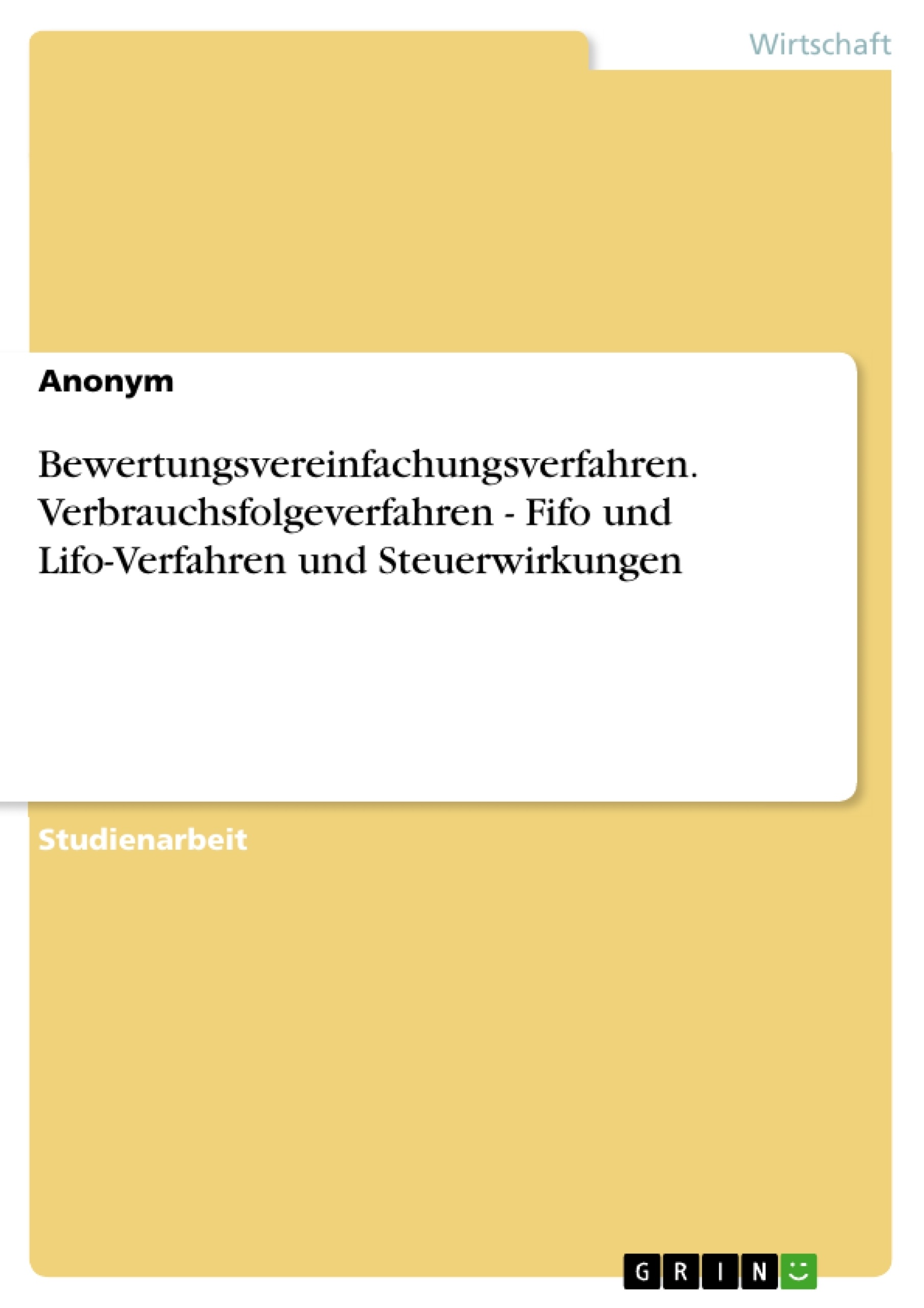Für die Bewertung des Vorratsvermögens gilt sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz der Grundsatz der Einzelbewertung nach § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB und § 6 Abs. 1 EStG. D. h., sämtliche Vermögensgegenstände sind einzeln mit ihren Anschaffungs-/ Herstellungskosten (AK/HK) zu bewerten. Hierfür müssen die einzelnen Vermögensgegenstände aber konkretisierbar und mit den tatsächlichen AK/HK bewertbar sein. Dies ist aber bei einer großen Zahl gleichartiger Vermögensgegenständen, insbesondere bei Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens, die zu verschiedenen Preisen und Zeitpunkten eingekauft werden, bei Vermischung in der Lagerhaltung oder Weiterverarbeitung von unfertigen Erzeugnissen oft nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand realisierbar. Daher ist es gem. § 252 Abs. 2 HGB unter bestimmten Voraussetzungen möglich vom Grundsatz der Einzelbewertung abzuweichen.
Gem. § 256 HGB und soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die zuerst oder, dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. Die Regelung erlaubt die vereinfachte Bewertung von gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens, indem die AK/HK mit Hilfe von Verbrauchsfolgeverfahren ermittelt oder gem. § 240 HGB mittels Fest- oder Durchschnittsbewertung angesetzt werden dürfen und somit erheblich zur Arbeitserleichterung, Zeit- und Kostenersparnis beitragen.
Ziel der Arbeit ist die Steuerwirkungen ausgewählter Bewertungsvereinfachungsverfahren mit Hilfe einer Szenarioanalyse darzustellen sowie Anwendungsvoraussetzungen derartiger Bewertungsvereinfachungen vor dem Hintergrund der Digitalisierung kritisch zu hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung, Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Abgrenzung Umlaufvermögen - Anlagevermögen
- 2.2 Überblick und gesetzliche Regelungen der Verfahren
- 2.3 Voraussetzungen und Grenzen von Verbrauchsfolgeverfahren
- 3 Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 3.1 Verbrauchsfolgeverfahren – Fifo- und Lifo-Verfahren
- 3.2 Steuerwirkungen des Lifo- und Fifo-Verfahrens
- 4 Kritische Würdigung
- 4.1 Vereinbarkeit der Verbrauchsfolgeverfahren mit den GoB
- 4.2 Digitalisierung - Zulässigkeit fiktiver Verbrauchsfolgeverfahren
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Bewertungsvereinfachungsverfahren, insbesondere Verbrauchsfolgeverfahren wie FIFO und LIFO, im Kontext des deutschen Handels- und Steuerrechts. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren zu erläutern, ihre Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen zu analysieren und ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu prüfen. Die Arbeit beleuchtet zudem den Einfluss der Digitalisierung auf die Zulässigkeit solcher Verfahren.
- Theoretische Grundlagen von Bewertungsvereinfachungsverfahren
- Anwendung von FIFO und LIFO Verfahren
- Steuerliche Auswirkungen von FIFO und LIFO
- Vereinbarkeit mit den GoB
- Der Einfluss der Digitalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung, Zielsetzung und Gang der Untersuchung: Dieses einleitende Kapitel definiert den Forschungsgegenstand, formuliert die Forschungsfrage und beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit. Es skizziert den Aufbau und die Struktur der Untersuchung und legt die Zielsetzung dar, Bewertungsvereinfachungsverfahren, insbesondere im Hinblick auf FIFO und LIFO, umfassend zu analysieren. Die Problemstellung wird durch die Notwendigkeit einer effizienten und gleichzeitig rechtssicheren Bewertung von Vorräten im Kontext der komplexen gesetzlichen Regelungen begründet. Der Gang der Untersuchung beschreibt die einzelnen Schritte der Analyse von den theoretischen Grundlagen bis hin zur kritischen Würdigung und dem abschließenden Fazit.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Bewertungsvereinfachungsverfahren dar. Es beginnt mit der Abgrenzung von Umlauf- und Anlagevermögen, um den Kontext der Vorratsbewertung zu klären. Anschließend bietet es einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen und Verfahren der Vorratsbewertung, um den Rahmen der Untersuchung zu definieren. Besondere Aufmerksamkeit widmet es den Voraussetzungen und Grenzen von Verbrauchsfolgeverfahren, um die Anwendbarkeit und die potenziellen Probleme dieser Verfahren zu beleuchten. Dieser Abschnitt dient als solide Basis für die detaillierte Analyse der FIFO- und LIFO-Methoden in den folgenden Kapiteln.
3 Bewertungsvereinfachungsverfahren: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die detaillierte Erläuterung von Verbrauchsfolgeverfahren, insbesondere FIFO und LIFO. Es beschreibt die Funktionsweise beider Verfahren und vergleicht ihre Anwendung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den steuerlichen Auswirkungen von FIFO und LIFO unter verschiedenen Preisentwicklungsszenarien (steigende und fallende Preise). Durch die Gegenüberstellung der Ergebnisse wird die unterschiedliche steuerliche Wirkung deutlich gemacht. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und liefert die notwendigen Informationen für die spätere kritische Würdigung.
4 Kritische Würdigung: In diesem Kapitel erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Bewertungsvereinfachungsverfahren. Es wird die Vereinbarkeit der Verbrauchsfolgeverfahren mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) geprüft und die Zulässigkeit von fiktiven Verbrauchsfolgeverfahren im Kontext der Digitalisierung diskutiert. Hier werden die Vor- und Nachteile der Verfahren abgewogen und mögliche Probleme und Herausforderungen bei der Anwendung erörtert. Dieser Abschnitt bietet eine fundierte Bewertung der Verfahren und trägt zur Klärung der Forschungsfrage bei.
Schlüsselwörter
Bewertungsvereinfachungsverfahren, FIFO, LIFO, Vorratsbewertung, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Steuerrecht, Handelsrecht, Digitalisierung, Bilanzierung, Umlaufvermögen, Anlagevermögen.
FAQ: Bewertungsvereinfachungsverfahren - FIFO und LIFO im deutschen Handels- und Steuerrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Bewertungsvereinfachungsverfahren, insbesondere die Verbrauchsfolgeverfahren FIFO (First-In, First-Out) und LIFO (Last-In, First-Out), im Kontext des deutschen Handels- und Steuerrechts. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen, Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen dieser Verfahren und prüft deren Vereinbarkeit mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der Digitalisierung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen von FIFO und LIFO zu erläutern, ihre Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen zu analysieren und ihre Vereinbarkeit mit den GoB zu prüfen. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss der Digitalisierung auf die Zulässigkeit solcher Verfahren und bietet eine umfassende Analyse der Vor- und Nachteile beider Verfahren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Theoretische Grundlagen von Bewertungsvereinfachungsverfahren, Anwendung von FIFO und LIFO Verfahren, Steuerliche Auswirkungen von FIFO und LIFO, Vereinbarkeit mit den GoB und den Einfluss der Digitalisierung auf die Zulässigkeit solcher Verfahren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Problemstellung, Zielsetzung und Gang der Untersuchung) legt den Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz dar. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) behandelt die Abgrenzung von Umlauf- und Anlagevermögen sowie die gesetzlichen Regelungen und Verfahren der Vorratsbewertung. Kapitel 3 (Bewertungsvereinfachungsverfahren) erläutert detailliert FIFO und LIFO und deren steuerliche Auswirkungen. Kapitel 4 (Kritische Würdigung) prüft die Vereinbarkeit mit den GoB und den Einfluss der Digitalisierung. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind FIFO und LIFO Verfahren?
FIFO (First-In, First-Out) und LIFO (Last-In, First-Out) sind Verbrauchsfolgeverfahren zur Bewertung von Vorräten. FIFO geht davon aus, dass die zuerst eingekauften Güter zuerst verbraucht werden. LIFO geht davon aus, dass die zuletzt eingekauften Güter zuerst verbraucht werden. Die Wahl des Verfahrens hat Auswirkungen auf die Bilanz und die Steuerbelastung.
Welche steuerlichen Auswirkungen haben FIFO und LIFO?
Die Wahl zwischen FIFO und LIFO hat unterschiedliche steuerliche Auswirkungen, insbesondere bei schwankenden Preisen. Bei steigenden Preisen führt LIFO zu niedrigeren Gewinnen und somit zu geringeren Steuern, während FIFO zu höheren Gewinnen und höheren Steuern führt. Bei fallenden Preisen verhält es sich umgekehrt.
Sind FIFO und LIFO Verfahren mit den GoB vereinbar?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von FIFO und LIFO mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Die Zulässigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird kritisch diskutiert.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Digitalisierung auf die Zulässigkeit von (fiktiven) Verbrauchsfolgeverfahren. Die Möglichkeiten der automatisierten Datenverarbeitung werden im Kontext der rechtlichen Vorgaben analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewertungsvereinfachungsverfahren, FIFO, LIFO, Vorratsbewertung, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Steuerrecht, Handelsrecht, Digitalisierung, Bilanzierung, Umlaufvermögen, Anlagevermögen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Bewertungsvereinfachungsverfahren. Verbrauchsfolgeverfahren - Fifo und Lifo-Verfahren und Steuerwirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594570