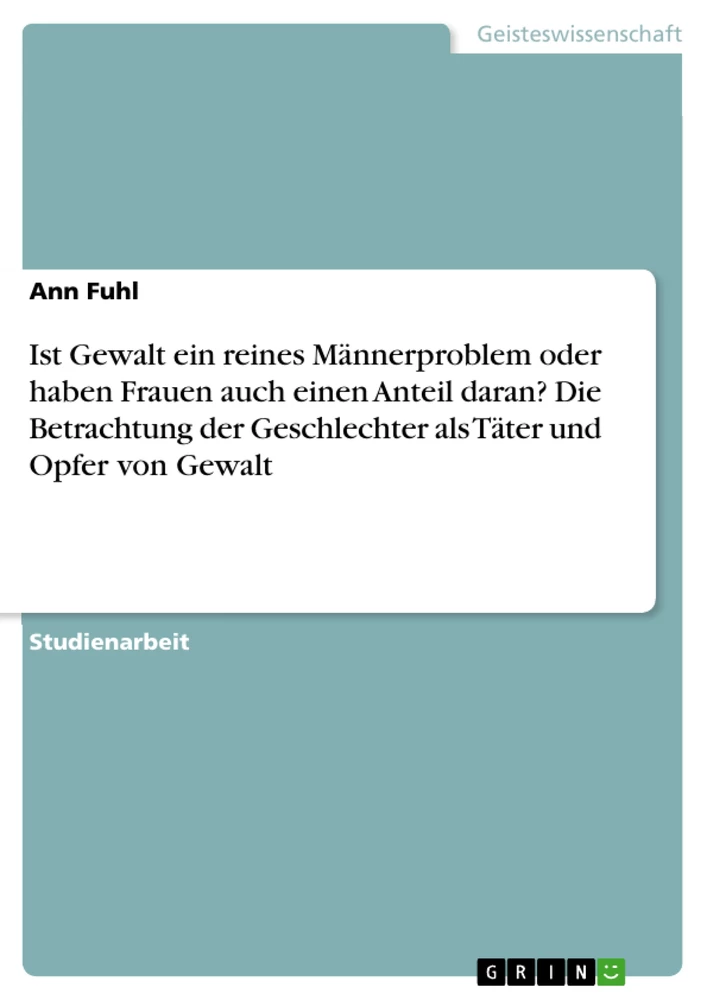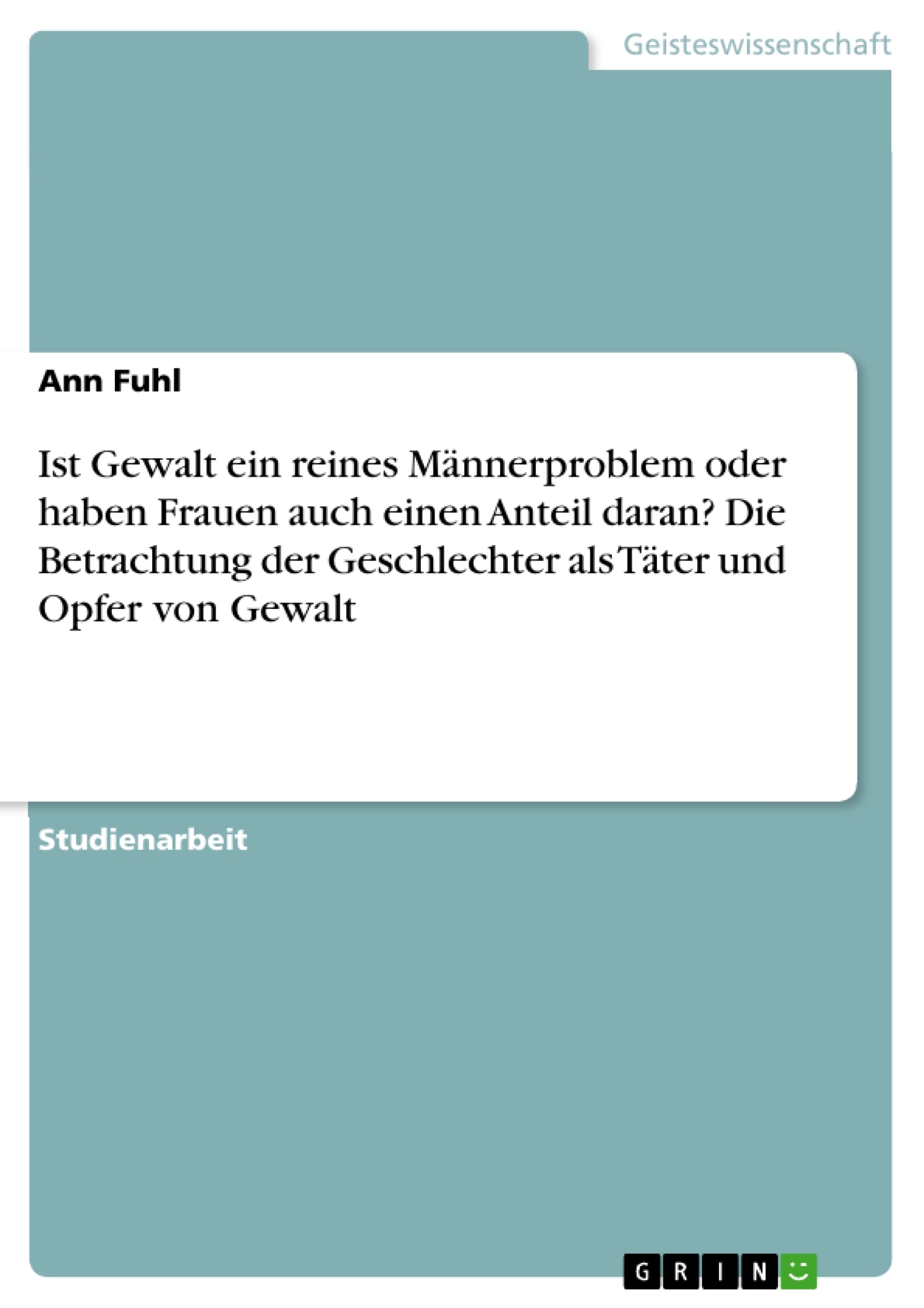Diese Arbeit stellt die Frage, wie sehr Gewalt männlich geprägt ist und welchen Anteil Frauen daran haben. Um diese Frage zu beantworten, wird das Gewaltverhalten der Geschlechter überprüft, indem beide als Täter und Opfer analysiert werden. Um das Gewaltverhalten der Männer zu untersuchen, wird unter anderem die polizeiliche Kriminalitätsstatistik herangezogen.
In der Öffentlichkeit wird eher die Meinung vertreten, dass Gewalt hauptsächlich ein männliches Problem ist, was trotz Forschungsergebnissen, die dem widersprechen, kaum die öffentliche Meinung beeinflusst. Zu sehr ist das öffentliche Denken noch von den typischen Geschlechterzuschreibungen geprägt, das Frauen eher als Opfer sieht denn als Täter. Die Fakten scheinen die öffentliche Meinung zu stützen, orientiert man sich an den Daten der Kriminalstatistik. Denn auch hier sind es Männer, die deutlich bei den Gewaltdelikten dominieren. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass Männer vor allem körperliche Gewalt ausüben, die Spuren hinterlässt und einfacher nachzuweisen ist. Um aber ein differenziertes Bild über die Gewaltproblematik zu erhalten, ist es nötig, auch die versteckte Gewalt in den Blick zu nehmen. Weil diese nur sehr schwer nachzuweisen ist, da sie sich der Sichtbarkeit meist entzieht, kann der Eindruck entstehen, dass diese nicht existiert. Dem soll diese Arbeit entgegenwirken und mit einem erweiterten Gewaltbegriff untersuchen, ob Männer wirklich gewalttätiger sind als Frauen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Gewalt
- Gewalt als Männerproblem
- Männer als Gewalttäter
- Männer als Opfer von Gewalt
- Frauen als Täter und Opfer von Gewalt
- Frauen als Täterinnen
- Frauen als Opfer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Gewalt hauptsächlich von Männern ausgeübt wird oder auch von Frauen. Sie analysiert die öffentliche Wahrnehmung und die Ergebnisse der Kriminalstatistik, die häufig ein männliches Gewaltmonopol suggerieren. Der Text hinterfragt die zugrundeliegenden Geschlechterklischees und beleuchtet die unterschiedlichen Formen von Gewalt, um ein differenziertes Bild der Problematik zu erstellen.
- Geschlechterrollen und öffentliche Wahrnehmung von Gewalt
- Kritik der Kriminalstatistik und der Fokus auf physische Gewalt
- Die Relevanz des erweiterten Gewaltbegriffs (psychische und relationale Gewalt)
- Die Rolle der Kultur und des sozialen Kontextes in der Definition von Gewalt
- Die Herausforderungen, die mit der Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Gewalt verbunden sind
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die gängige öffentliche Meinung, die Gewalt als ein Männerproblem darstellt. Sie betont die Notwendigkeit, die Debatte zu erweitern und auch versteckte Formen von Gewalt zu berücksichtigen, die von Frauen ausgeübt werden könnten.
Der Begriff Gewalt
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Gewalt und diskutiert die unterschiedlichen Perspektiven und Definitionen in der Fachliteratur. Es zeigt, wie sich der Gewaltbegriff im Laufe der Zeit erweitert hat und wie die Kultur Einfluss auf die Definition von Gewalt hat.
Gewalt als Männerproblem
Dieses Kapitel beleuchtet die weit verbreitete Ansicht, dass Gewalt hauptsächlich von Männern ausgeübt wird. Es analysiert die Kriminalstatistik und beleuchtet die Argumentation, die auf biologischen Determinanten basiert. Der Text kritisiert jedoch die einseitige Fokussierung auf körperliche Gewalt und betont die Bedeutung anderer Gewaltformen, die in der Statistik nicht erfasst werden.
Männer als Gewalttäter
Dieses Kapitel diskutiert die Gründe, warum Männer in der öffentlichen Wahrnehmung als die dominierenden Gewalttäter erscheinen. Der Text kritisiert die eng gefasste Definition von Gewalt und die einseitige Betrachtung der Gewalt an Frauen. Es wird betont, dass auch Gewalt von Männern an Frauen ein relevantes Thema ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gewalt, Geschlechterrollen, Kriminalstatistik, öffentliche Wahrnehmung, erweiterter Gewaltbegriff, psychische Gewalt, relationale Gewalt, Geschlechterverhältnis, Kultur, Sozialer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Ist Gewalt laut Kriminalstatistik ein rein männliches Problem?
Die Statistik zeigt eine Dominanz männlicher Täter, was jedoch oft an der Konzentration auf körperliche Gewalt liegt, die leichter nachzuweisen ist.
Welche Rolle spielen Frauen als Gewalttäterinnen?
Frauen üben häufiger „versteckte“ Gewaltformen wie psychische oder relationale Gewalt aus, die in offiziellen Statistiken seltener auftauchen.
Was versteht man unter einem erweiterten Gewaltbegriff?
Er umfasst neben physischer Gewalt auch psychische Verletzungen, soziale Ausgrenzung und emotionale Manipulation.
Warum werden Frauen in der Öffentlichkeit primär als Opfer wahrgenommen?
Dies liegt an tief verwurzelten Geschlechterzuschreibungen und Klischees, die Männern Aggression und Frauen Passivität zuschreiben.
Werden Männer auch als Opfer von Gewalt untersucht?
Ja, die Arbeit analysiert beide Geschlechter sowohl in der Rolle der Täter als auch in der Rolle der Opfer.
- Citation du texte
- Ann Fuhl (Auteur), 2016, Ist Gewalt ein reines Männerproblem oder haben Frauen auch einen Anteil daran? Die Betrachtung der Geschlechter als Täter und Opfer von Gewalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/595734