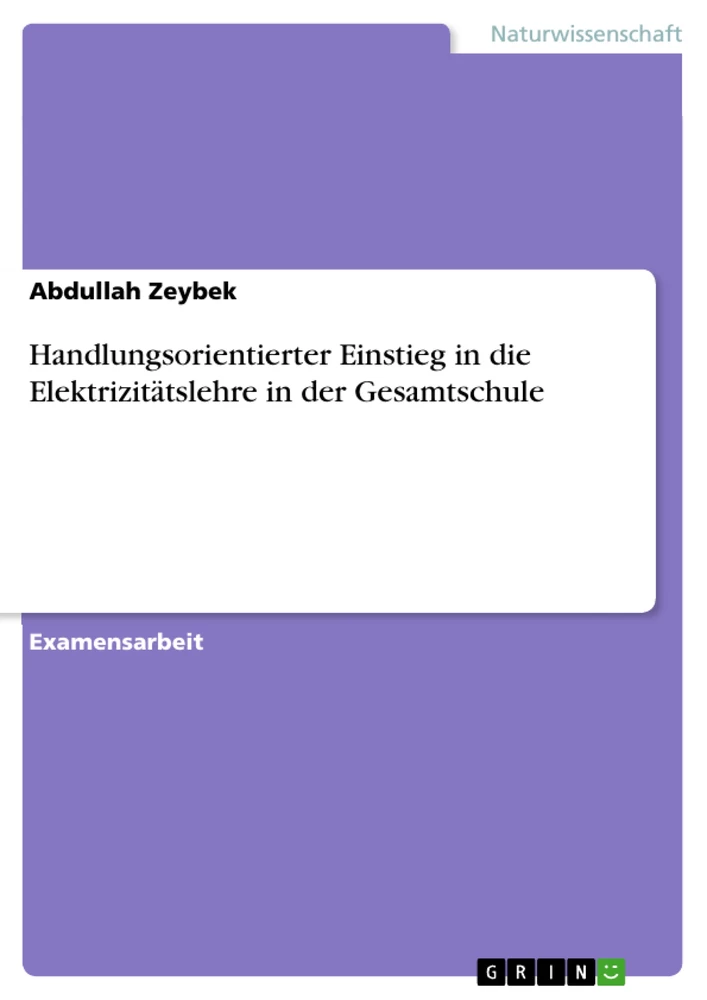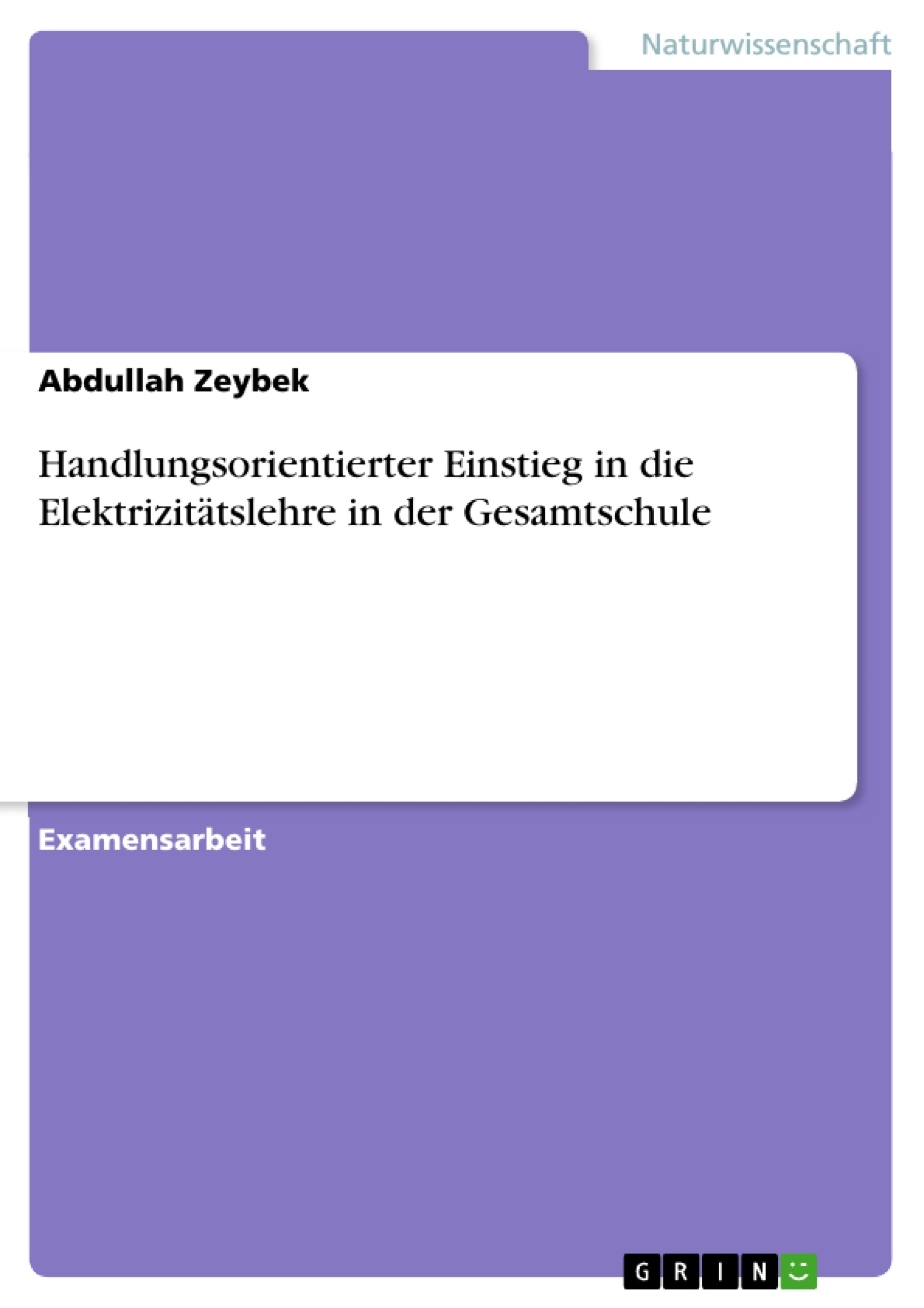„Elektrizitätslehre – Physik in der Black Box?“
Die Elektrizitätslehre ist von Natur aus wesentlich unanschaulicher als einige andere Teilgebiete der Physik In der Optik oder der Wärmelehre sind physikalische Vorgänge, im Gegensatz zur Elektrizitätslehre, direkt beobachtbar. Die Brechung des Lichts an einer Glasoberfläche oder das Ausdehnen von Flüssigkeiten bei Erwärmung kann man sehen, das Fließen des Stromes oder den Spannungsabfall an einem Verbraucher ist nur an den Wirkungen zu beobachten. Das Elektrizität nicht direkt sichtbar gemacht werden kann, führt bei den Schülerinnen und Schülern dieser Altersstufe oft zu großen Verständnisschwierigkeiten und als Folge zu mangelnder Motivation für dieses Thema. Auch ich habe in meiner noch nicht allzu lange zurückliegenden eigenen Schulzeit negative Erfahrungen mit dem Themenbereich der Elektrizitätslehre gesammelt. Da es sich in meiner Schulzeit häufig um einen allzu theoretischen Unterricht gehandelt hat, konnte ich mich mit dem Thema nicht anfreunden. Da der Unterricht sich ausschließlich auf Lehrerversuche und die theoretische Behandlung der physikalischen Problemstellungen beschränkte, hatte ich keine Gelegenheit durch selbst geplante, durchgeführte und ausgewertete Versuche eigene physikalische Erfahrungen zu sammeln. Diese Art von Unterricht war für mich damals sehr demotivierend und wäre es für meine Lerngruppe heute mit Sicherheit ebenfalls.
In meiner pädagogischen Prüfungsarbeit dokumentiere ich, wie ich den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 einen praktischen, möglichst schülernahen Einstieg in das Thema der Elektrizitätslehre ermöglicht habe. Hierzu habe ich mich für einen Einstieg über einfache Stromkreise entschieden, da sie einen anschaulichen und praktischen Zugang in die Elektrizitätslehre darstellen.
Mein Anliegen war es einen Zugang zur Elektrizitätslehre zu finden, bei dem die Schülerinnen und Schüler selbst experimentieren können, bei dem sie mit Spaß „knobeln“ können und bei des um mehr geht, als bei einer vom Lehrer aufgebauten Schaltung die Messergebnisse abzulesen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Physikalische Grundlagen
- Der elektrische Stromkreis
- Die Glühlampe
- Der Leitungsprüfer
- Der Morsetelegraf
- Der Kurzschluss
- Die Sicherung
- Die Reihenschaltung
- Die Parallelschaltung
- Die UND-Schaltung
- Die ODER-Schaltung
- Methodische Grundidee
- Das Experiment im naturwissenschaftlichen Unterricht
- Die Lerngruppe
- Die Unterrichtseinheit
- Didaktische Legitimation der Unterrichtseinheit
- Überblick über alle Stunden der Unterrichtseinheit
- Darstellung einiger ausgesuchter Unterrichtsstunden aus der Unterrichtseinheit
- Stunde 3: Welche Stoffe leiten den elektrischen Strom und welche nicht?
- Didaktische Legitimation der Stunde
- Lernziele der Stunde
- Methodische Entscheidungen
- Stunde 8: Die Brotschneidemaschine
- Didaktische Legitimation der Stunde
- Lernziele der Stunde
- Methodische Entscheidungen
- Stunde 9: Die Hausklingel
- Didaktische Legitimation der Stunde
- Lernziele der Stunde
- Methodische Entscheidungen
- Reflexion der ausgesuchten Unterrichtsstunden
- Stunde 3: Welche Stoffe leiten den elektrischen Strom und welche nicht?
- Stunde 8: Die Brotschneidemaschine
- Stunde 9: Die Hausklingel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem handlungsorientierten Einstieg in die Elektrizitätslehre für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8. Ziel ist es, durch praktische Experimente mit alltäglichen Materialien einen anschaulichen und motivierenden Zugang zu diesem für viele Schüler abstrakten Thema zu schaffen. Die Arbeit stellt die didaktische Legitimation der Unterrichtseinheit sowie die methodische Umsetzung anhand ausgewählter Stunden dar.
- Handlungsorientierter und schülerzentrierter Unterricht
- Praktische Experimente mit Alltagsgegenständen
- Didaktische Relevanz von Schülerexperimenten
- Bedeutung der Elektrizitätslehre im Alltag
- Motivationssteigerung im naturwissenschaftlichen Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problematik des Themas Elektrizitätslehre für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 aufzeigt. Die Einleitung beschreibt die Notwendigkeit eines praktischen und handlungsorientierten Einstiegs in das Thema. Im zweiten Kapitel werden die physikalischen Grundlagen der Elektrizitätslehre behandelt. Kapitel drei stellt die methodische Grundidee der Arbeit dar, welche auf der Erschließung der entsprechenden physikalischen Inhalte durch Schülerexperimente mit handelsüblichen Materialien basiert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Experimenten im naturwissenschaftlichen Unterricht. Kapitel fünf stellt die Lerngruppe vor, mit der die Unterrichtseinheit durchgeführt wurde. In Kapitel sechs wird die Unterrichtseinheit didaktisch legitimiert und es wird ein Überblick über alle Stunden der Einheit gegeben. Anschließend werden ausgewählte Stunden der Einheit im Detail analysiert. Die Arbeit endet mit einer Reflexion der ausgesuchten Unterrichtsstunden und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen handlungsorientierter Unterricht, Schülerexperimente, Elektrizitätslehre, alltägliche Materialien, Didaktische Legitimation, Motivationssteigerung, naturwissenschaftlicher Unterricht, Jahrgangsstufe 8.
Häufig gestellte Fragen
Warum fällt vielen Schülern der Einstieg in die Elektrizitätslehre schwer?
Physikalische Vorgänge wie Stromfluss oder Spannung sind nicht direkt sichtbar, sondern nur an ihren Wirkungen erkennbar. Das macht das Thema im Vergleich zur Optik sehr abstrakt und oft demotivierend.
Was ist der Kerngedanke des handlungsorientierten Unterrichts?
Schüler sollen physikalische Erfahrungen durch eigenes Experimentieren, Knobeln und Bauen von Schaltungen sammeln, anstatt nur theoretische Lehrerversuche zu beobachten.
Welche Alltagsgegenstände werden in der Unterrichtseinheit verwendet?
Es werden einfache Materialien wie Glühlampen, Leitungsprüfer, Hausklingeln oder sogar Modelle von Brotschneidemaschinen genutzt, um einen Alltagsbezug herzustellen.
Was lernen die Schüler in der Stunde über Leitfähigkeit?
Sie untersuchen experimentell, welche Stoffe den elektrischen Strom leiten und welche als Isolatoren wirken, indem sie verschiedene Materialien in einen Prüfstromkreis einbauen.
Warum ist das Schülerexperiment didaktisch so wichtig?
Es fördert die Motivation, das Verständnis für naturwissenschaftliche Arbeitsweisen und hilft dabei, abstrakte physikalische Konzepte durch haptische Erfahrungen zu verankern.
- Quote paper
- Abdullah Zeybek (Author), 2005, Handlungsorientierter Einstieg in die Elektrizitätslehre in der Gesamtschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59605