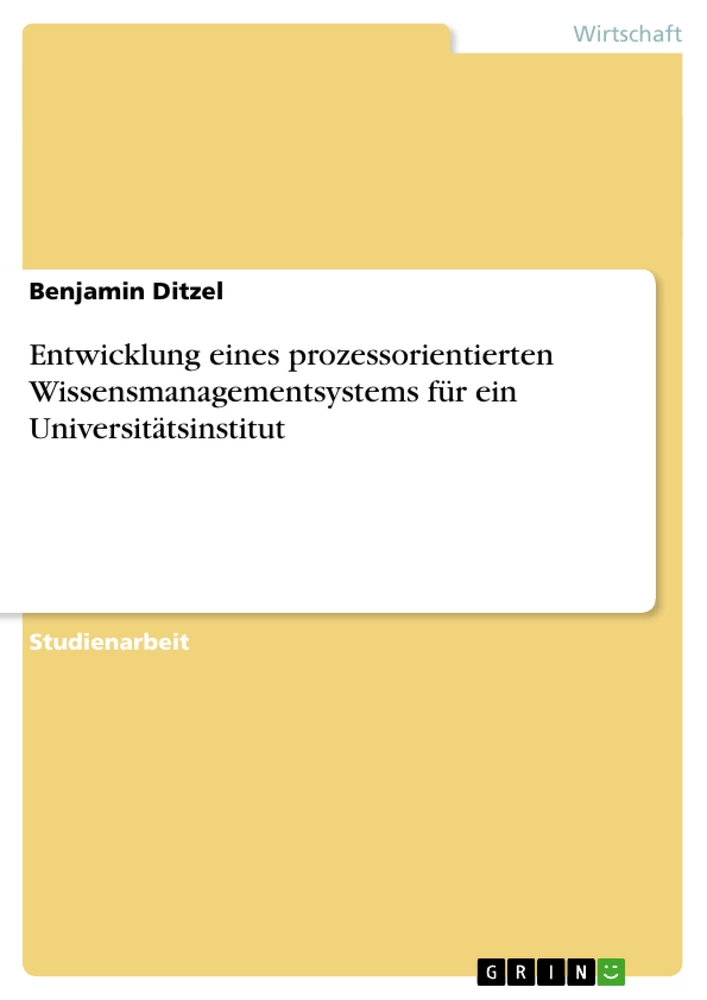Durch ständig neue Managementkonzepte wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten sowohl Aufbau als auch Ablauf der Unternehmen immer wieder nachhaltigen Veränderungen unterzogen. Just-in-Time, Lean Production, Kaizen, Business Process Reengineering oder Total Quality Management sind nur einige der Konzepte, welche in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft zu großen Veränderungen führten. Personalabbau und Umstrukturierungen standen und stehen dabei oft an oberster Stelle der Maßnahmen, um solche Konzepte einzuführen. In der Zwischenzeit hat sich jedoch ein neuer, zunehmend wichtigerer Aspekt als Wettbewerbsfaktor herausgebildet: das Schaffen, Verteilen und Bereitstellen von Wissen in Organisationen. Dabei ist Wissen nicht einfach eine weitere Ressource der Organisationen, sondern hat sich durch die Wandlung von der Industrie- zur Informations- bzw. Wissensgesellschaft zu einem der wichtigsten Produktionsfaktoren entwickelt. Die traditionellen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital verlieren zunehmend an Bedeutung, zugunsten des Faktors Wissen. Damit verbunden ist einerseits eine Veränderung der bekannten Berufsbilder; fanden Mitte des 20. Jahrhunderts noch ca. 40 % der Wertschöpfung in der industriellen Produktion statt, so liegt dieser Anteil heute bei nur noch 20 %. Zunehmend gewinnen Dienstleistungen an Bedeutung und befassen sich die Tätigkeiten im weitesten Sinne mit Informationen. Andererseits müssen auch die Managementpraktiken auf die veränderten Bedingungen reagieren und die Informationstechnik die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung.
- 1.1.1 Zunehmende Bedeutung von Wissen und Wissensmanagement
- 1.1.2 Management und Wissensmanagement an Universitäten
- 1.1.3 Prozess- und Wissensmanagement an einem Institut der TU Berlin
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Grundlagen und Begriffe
- 2.1 Begriffsdefinitionen
- 2.1.1 Information und Wissen
- 2.1.2 Wissensmanagement
- 2.1.3 Prozessorientierung
- 2.2 Verschiedene Ansätze des Wissensmanagements
- 2.2.1 Wissensmanagement und Prozessorientierung
- 2.2.2 Wissensmanagement und Intellektuelles Kapital.
- 2.2.3 Wissensmanagement und Informationstechnik
- 2.3 Nutzen des Wissensmanagements
- 2.4 Technologien und Werkzeuge des Wissensmanagements
- 2.4.1 Business Intelligence
- 2.4.2 Data Warehouse
- 2.4.3 Data Mining
- 2.4.4 Content Management
- 2.4.5 Dokumentenmanagement
- 2.4.6 Workflow Management
- 2.4.7 E-Learning
- 2.4.8 Web-Portale
- 3 Problemanalyse
- 3.1 Situationsanalyse
- 3.1.1 Anforderungen an Universitäten
- 3.1.2 Charakteristika einer Universität
- 3.1.3 Wissensmanagement an Universitäten
- 3.1.4 Fallstudie Projektgruppe Praktische Mathematik
- 3.2 Anforderungen an die Arbeit und ihre Umsetzung
- 4 Entwicklung eines prozessorientierten Wissensmanagementsystems
- 4.1 Organisation
- 4.1.1 Organisationsstruktur
- 4.1.2 Organisationskultur
- 4.1.3 Strategische Ausrichtung
- 4.1.4 Führung
- 4.2 Prozesse
- 4.2.1 Wissensplanung
- 4.2.2 Wissensentwicklung
- 4.2.3 Wissenstransfer
- 4.2.4 Wissensnutzung
- 4.2.5 Bewertung und Überprüfung
- 4.3 Personen
- 4.3.1 Qualifizierung
- 4.3.2 Motivation
- 4.3.3 Beteiligung und Bemächtigung
- 4.4 Technologie
- 4.4.1 Konzept für den Aufbau eines Wissensportals
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, ein prozessorientiertes Wissensmanagementsystem für ein Universitätsinstitut zu entwickeln. Das System soll dazu beitragen, das Wissen im Institut besser zu erfassen, zu strukturieren, zu teilen und zu nutzen.
- Bedeutung von Wissen und Wissensmanagement in universitären Kontexten
- Prozessorientierte Ansätze im Wissensmanagement
- Entwicklung und Implementierung eines Wissensmanagementsystems
- Rolle von Technologie im Wissensmanagement
- Bewertung und Weiterentwicklung des Wissensmanagementsystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problemstellung des Wissensmanagements an Universitäten dar und erläutert die Notwendigkeit eines prozessorientierten Wissensmanagementsystems. Die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit werden definiert.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden grundlegende Begriffe wie Information, Wissen und Wissensmanagement definiert. Verschiedene Ansätze des Wissensmanagements werden vorgestellt, und es wird auf den Nutzen und die Technologien des Wissensmanagements eingegangen.
- Kapitel 3: Die Problemanalyse beleuchtet die Situation an Universitäten im Hinblick auf die Anforderungen an Wissensmanagement. Eine Fallstudie einer Projektgruppe an der TU Berlin wird vorgestellt.
- Kapitel 4: Im Kern der Arbeit wird ein prozessorientiertes Wissensmanagementsystem entwickelt. Die einzelnen Komponenten des Systems, wie Organisation, Prozesse, Personen und Technologie, werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Prozessorientierung, Universitäten, Institut, Wissensportal, Technologie, Information, Wissen, Data Warehouse, Data Mining, Content Management, Workflow Management.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement an Universitäten wichtig?
Da Wissen der zentrale Produktionsfaktor im Informationszeitalter ist, müssen Universitäten sicherstellen, dass Forschungsergebnisse und prozessrelevantes Wissen effizient geteilt und genutzt werden.
Was bedeutet Prozessorientierung im Wissensmanagement?
Es bedeutet, dass Wissensflüsse (Planung, Entwicklung, Transfer, Nutzung) direkt in die täglichen Arbeitsabläufe der Organisation integriert werden.
Welche Technologien unterstützen das Wissensmanagement?
Eingesetzt werden unter anderem Wissensportale, Data Warehouses, Dokumentenmanagement-Systeme und Workflow-Management-Tools.
Welche Rolle spielt die Organisationskultur?
Eine offene Kultur ist entscheidend, um Mitarbeiter zur Weitergabe ihres Wissens zu motivieren und eine Atmosphäre des gemeinsamen Lernens zu schaffen.
Was ist ein Wissensportal?
Ein zentraler digitaler Zugangspunkt, der Informationen bündelt und den Austausch zwischen den Mitgliedern eines Instituts technisch ermöglicht.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Benjamin Ditzel (Author), 2005, Entwicklung eines prozessorientierten Wissensmanagementsystems für ein Universitätsinstitut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59608