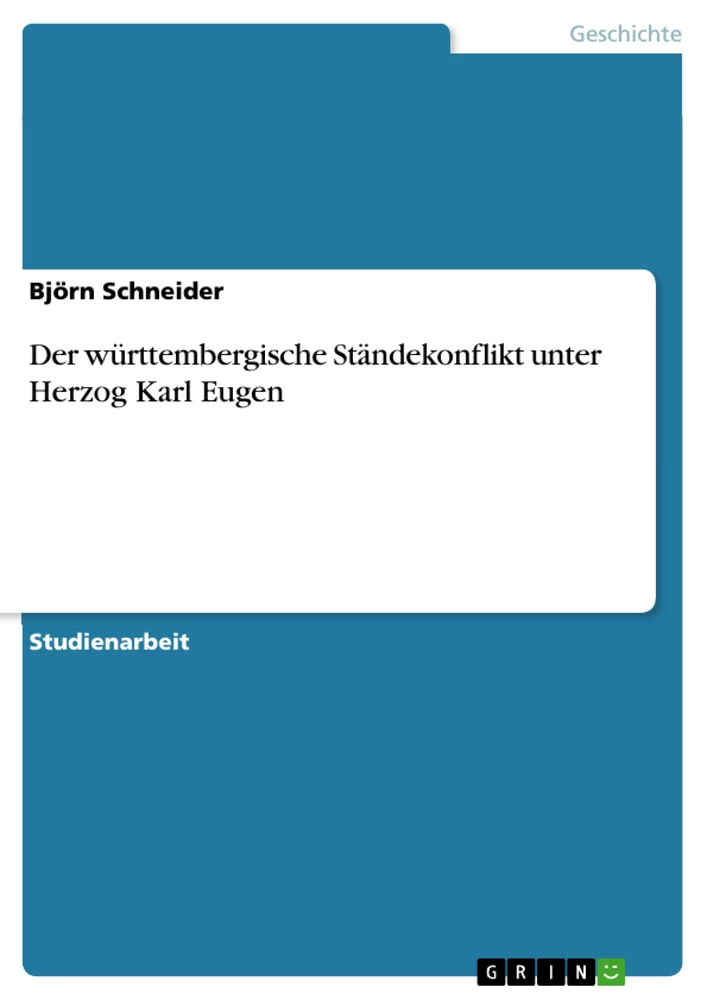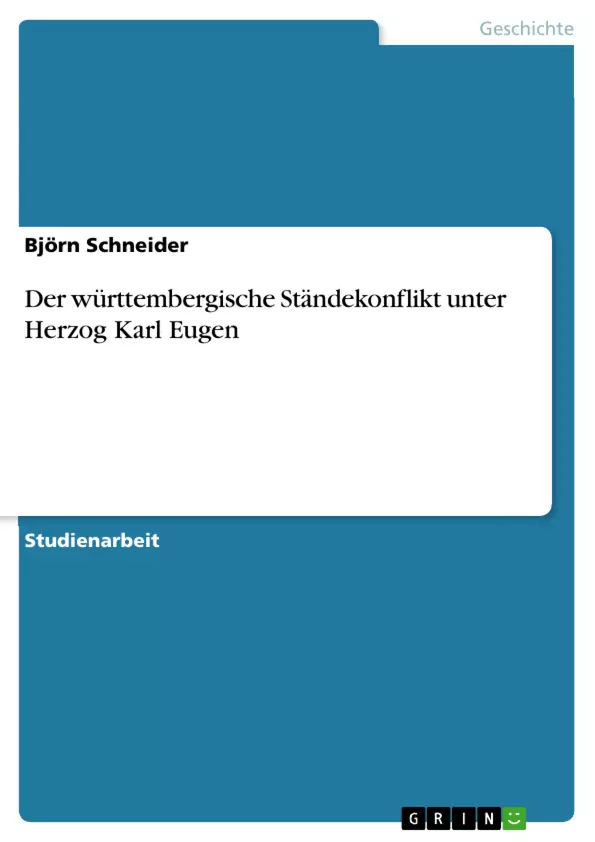Württembergs Weg im 18. Jahrhundert wird oft als ein Extremfall der Entwicklung des frühmodernen Staates im absolutistischen Europa zitiert, weil hier das Ständetum seine Machtposition im Verhältnis zum Monarchen behaupten konnte. Kern des Konfliktes war der auf politischer Ebene ausgetragene Streit um die Machtverteilung zwischen Herzog Carl Eugen (1728/44 - 1793) und den württembergischen Ständen, der aufgrund der besonderen politischen Rahmenbedingungen, vor allem durch den zunehmenden Dualismus zwischen Preußen und Österreich im Reich, außenpolitische Brisanz barg. Dabei sind derartige Konflikte im strukturellen Verständnis der Machtenfaltung der absoluten Monarchen immanent. Auch wenn der „Punktsieg“, erzielt durch die Klage protestantischer Landstände gegen einen katholischen Herzog, den rechtlichen Zusammenhalt des alten Reiches offenbaren mag, so ist auch zu sehen, dass der Reichshofrat sich durch seinen Rechtsspruch als interne politische Regulierungsinstanz in Württemberg etablierte und die Kodifikation des landschaftlichen „Verfassungsverständnisses“ nur unter dem spezifischen politischen Klima des Reiches und Europas zur Zeit der Konfliktlösung möglich war. Die „Behauptung der Landschaft“ ist auch dadurch eingeschränkt, dass sich die württembergische Landschaft, und ihre tragende soziale Gruppe, die Ehrbarkeit, selbst in einer Transformation befand, die sich dann in der Machtverschiebung zugunsten des engeren Ausschusses nach der Konfliktbeilegung durch den Erbvergleich von 1770 besonders deutlich macht. Der Schwerpunkt der Arbeit soll allerdings auf der politischen Dynamik des Ständekonflikts liegen, und ihre Grundlagen und Strukturen aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN DES KONFLIKTES BIS 1744
- 1. WÜRTTEMBERGISCHE HERRSCHAFTSVERTRÄGE
- 2. POLITISCHE STRUKTUREN WÜRTTEMBERGS
- 3. DIE POSITION WÜRTTEMBERGS IN DER EUROPÄISCHEN POLITIK
- 4. KONFESSION UND POLITIK
- III. KONTRAHENTEN DES KONFLIKTES
- 1. HERZOG KARL EUGEN
- 2. DIE EHRBARKEIT
- IV. KONFLIKTVERLAUF
- V. KONFLIKTLÖSUNG
- VI. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den württembergischen Ständekonflikt unter Herzog Carl Eugen (1728/44 – 1793) und beleuchtet dessen politische Rahmenbedingungen, Akteure und Verlauf. Dabei werden die Machtverhältnisse zwischen dem Herzog und den Ständen, insbesondere der „Ehrbarkeit“, untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf den Herrschaftsverträgen und der Rolle des Reichshofrates in diesem Konflikt.
- Die Machtverteilung zwischen Herzog Carl Eugen und den Ständen in Württemberg
- Die Bedeutung der Herrschaftsverträge für das Verhältnis von Monarchie und Ständetum
- Die Rolle der „Ehrbarkeit“ als tragende soziale Gruppe der Stände
- Die Einbindung Württembergs in die europäische Politik
- Die Konfliktlösung und ihre Auswirkungen auf das politische System Württembergs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Bedeutung des Ständekonflikts für die Entwicklung des frühmodernen Staates in Württemberg. Sie stellt den Konflikt als einen zentralen Bestandteil des Machtgefüges zwischen absolutistischen Monarchen und Ständen dar.
Kapitel II untersucht die politischen Rahmenbedingungen des Konflikts bis 1744. Dabei werden die württembergischen Herrschaftsverträge, die politische Struktur des Landes und die Rolle Württembergs in der europäischen Politik beleuchtet.
Kapitel III präsentiert die zentralen Kontrahenten des Konflikts: Herzog Carl Eugen und die „Ehrbarkeit“ als Vertreter der Stände. Dieses Kapitel analysiert die Machtpositionen und Interessen beider Seiten.
Kapitel IV beschreibt den Verlauf des Konflikts, ohne dabei auf die Konfliktlösung oder die Schlussfolgerungen einzugehen.
Schlüsselwörter
Ständekonflikt, Herzog Carl Eugen, Ehrbarkeit, Herrschaftsverträge, Tübinger Vertrag, Religionsreversalien, Reichshofrat, frühmoderner Staat, Absolutismus, politische Strukturen, Machtverteilung, Konfession, europäische Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des württembergischen Ständekonflikts?
Es war ein Machtkampf zwischen Herzog Carl Eugen, der absolutistische Bestrebungen verfolgte, und den Landständen, die ihre traditionellen Rechte und Privilegien verteidigten.
Wer war die „Ehrbarkeit“?
Die Ehrbarkeit war die tragende soziale Gruppe der württembergischen Stände, bestehend aus dem städtischen Patriziat und der Beamtenschaft, die den Widerstand gegen den Herzog anführte.
Welche Rolle spielte der Tübinger Vertrag?
Der Tübinger Vertrag von 1514 war einer der wichtigsten Herrschaftsverträge, auf den sich die Stände beriefen, um ihre Mitbestimmungsrechte gegenüber dem Monarchen rechtlich zu untermauern.
Warum hatte der Konflikt eine außenpolitische Dimension?
Die Brisanz ergab sich aus dem Dualismus zwischen Preußen und Österreich sowie der konfessionellen Spannung zwischen dem katholischen Herzog und den protestantischen Ständen.
Wie wurde der Konflikt 1770 gelöst?
Die Beilegung erfolgte durch den sogenannten Erbvergleich von 1770, der die Machtverhältnisse neu ordnete und die Position des "Engeren Ausschusses" der Stände stärkte.
- Citation du texte
- Björn Schneider (Auteur), 2005, Der württembergische Ständekonflikt unter Herzog Karl Eugen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59628