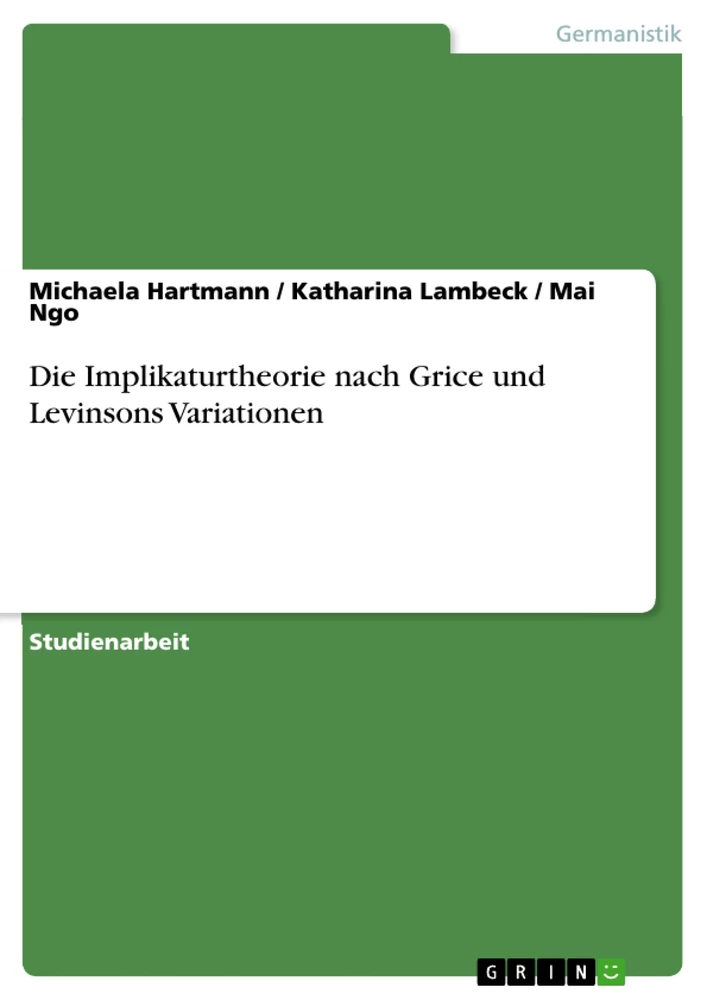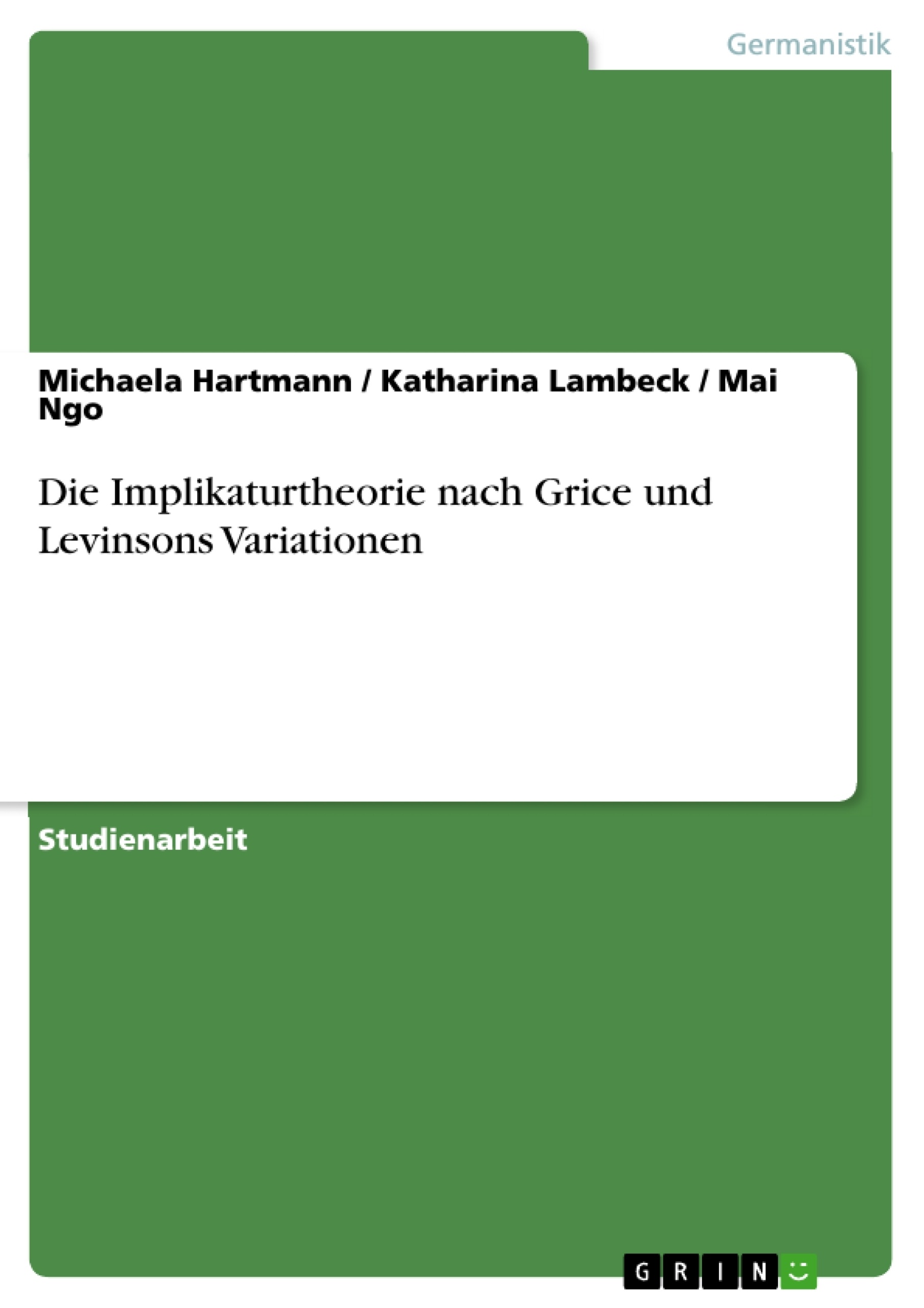Angenommen, eine junge Dame trifft sich abends mit einem Bekannten und geht mit diesem spazieren. Nach einer Weile sagt sie: „Mich friert. Es ist ganz schön kühl geworden.“ Es ist durchaus möglich, dass die junge Dame mit dieser Äußerung mehr zu verstehen geben will als sie gesagt hat, zum Beispiel, dass sie eine Jacke benötigt oder dass sie in das nahe gelegene Café gehen möchte. Wie lassen sich solche Abweichungen zwischen Gesagtem und Gemeintem erklären?
In seinem Aufsatz „Logik und Konversation“ stellt Herbert Paul Grice die Theorie der Implikatur vor, welche wiederum Teil seiner Theorie des Meinens ist. Diese Theorie des Meinens ist eingebettet in die Theorie rationaler Verständigung. Im Griceschen Sinne etwas zu meinen, heißt „mit der Handlung versuchen, dem Adressaten Gründe für eine Annahme oder Handlung seinerseits zu geben“ (Kemmerling 1991: 321). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Handlung, mit der etwas gemeint wird, die Gründe für eine Handlung nicht aus ihren natürlichen Eigenschaften herleitet, sondern diese bereitstellt, weil sie solche Gründe bereitstellen soll. Grice differenziert zwischen der natürlichen Bedeutung, Bedeutungn, und der nicht- natürlichen Bedeutung, Bedeutungnn. Interessant ist für Grice hierbei die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit von einer Person A gesagt werden kann, dass sie mit einem Ausdruck x, bzw. mit der Äußerung von x (im nicht natürlichen Sinne) etwas Bestimmtes gemeint oder zu verstehen gegeben versucht hat (Rolf 1994: 23). Das, was ein Sprecher mit einer sprachlichen Äußerung meint, zerfällt nach Grice in das, was mit ihr gesagt wird, und das, was mit ihr implikiert wird. Das Gesagte entspricht der wörtlichen Bedeutung des geäußerten Satzes; alles, was über das Gesagte hinausgeht, ist das Implikat der Äußerung. Die wörtliche Bedeutung und das, was implikiert wird, können zusammenfallen oder auseinanderdriften, dann nämlich, wenn das, was zu verstehen gegeben werden soll, das Gesagte übersteigt wie im obigen Beispiel. In diesem Kontext erlangt die Theorie der Implikatur ihre Wichtigkeit, denn sie ist konzipiert, um Dissoziationen des Gesagten und Gemeinten zu erfassen (Rolf 1994: 110).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grice' Implikaturtheorie.
- 2.1 Die Grundlage..
- 2.2 Der Zusammenhang zwischen dem Kooperationsprinzip, den Maximen und der konversationalen Implikatur.
- 3. Variationen nach Levinson
- 3.1 Einführung...
- 3.2 Definition der Implikatur
- 3.3 Fünf typische Eigenschaften von Implikaturen..
- 3.3.1 Aufhebbarkeit.
- 3.3.2 Nicht-Abtrennbarkeit
- 3.3.3 Berechenbarkeit....
- 3.3.4 Nicht-Konventionalität.
- 3.3.5 Nicht genaue Bestimmbarkeit.
- 3.4 Die generellen Quantitätsimplikaturen.
- 3.4.1 Die skalaren Implikaturen
- 3.4.2 Die klausalen Implikaturen
- 3.5 Das Erkennen genereller Quantitätsimplikaturen: der Gewinn für die Semantik am Beispiel des Ambiguitätsproblems bei Konjunktionen.
- 3.6 Fragestellungen innerhalb der Implikaturtheorie am Beispiel des Projektionsproblems..
- 4. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Implikaturtheorie nach Grice und deren Variationen nach Levinson. Sie analysiert die Grundlagen der Theorie und zeigt die verschiedenen Implikaturtypen sowie deren Eigenschaften auf.
- Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen nach Grice
- Merkmale und Probleme der konversationalen Implikaturen
- Levinsons Variationen der Griceschen Theorie
- Skalare und klausale Implikaturen
- Das Erkennen genereller Quantitätsimplikaturen und deren Einfluss auf die Semantik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Implikaturtheorie ein und stellt das Problem der Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem anhand eines Beispiels vor.
- Kapitel 2: Grice' Implikaturtheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Griceschen Theorie und den verschiedenen Arten von Implikaturen. Es werden die konventionalen und nicht-konventionalen Implikaturen sowie das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen vorgestellt.
- Kapitel 3: Variationen nach Levinson: Dieser Teil beleuchtet Levinsons Variationen der Griceschen Theorie und geht auf die Definition der Implikatur sowie deren typische Eigenschaften ein.
- Kapitel 3.4: Die generellen Quantitätsimplikaturen: Hier werden die skalaren und klausalen Implikaturen genauer betrachtet.
- Kapitel 3.5: Das Erkennen genereller Quantitätsimplikaturen: Dieses Kapitel behandelt das Ambiguitätsproblem bei Konjunktionen und wie die Erkennung genereller Quantitätsimplikaturen dazu beitragen kann, diese Ambiguität aufzulösen.
- Kapitel 3.6: Fragestellungen innerhalb der Implikaturtheorie: Dieser Abschnitt fokussiert auf das Projektionsproblem und die damit verbundenen Fragen innerhalb der Implikaturtheorie.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Hausarbeit umfassen Implikaturtheorie, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, konventionale und nicht-konventionale Implikaturen, skalare und klausale Implikaturen, sowie das Projektionsproblem.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine konversationale Implikatur?
Nach Grice bezeichnet sie den Teil der Bedeutung einer Äußerung, der über das wörtlich Gesagte hinausgeht und vom Hörer aus dem Kontext und dem Kooperationsprinzip erschlossen wird.
Was besagt das Kooperationsprinzip von Grice?
Es fordert Teilnehmer an einem Gespräch auf, ihren Beitrag so zu gestalten, wie es der Zweck oder die Richtung des Gesprächs gerade erfordert.
Welche Merkmale haben Implikaturen nach Levinson?
Levinson nennt fünf typische Eigenschaften: Aufhebbarkeit, Nicht-Abtrennbarkeit, Berechenbarkeit, Nicht-Konventionalität und Nicht genaue Bestimmbarkeit.
Was sind skalare und klausale Implikaturen?
Dies sind Typen der Quantitätsimplikatur. Skalare Implikaturen nutzen Begriffe auf einer Skala (z.B. „einige“ impliziert „nicht alle“), während klausale Implikaturen Unsicherheit über Teilsätze ausdrücken.
Warum ist die Implikaturtheorie wichtig für die Semantik?
Sie hilft dabei, Probleme wie Ambiguitäten bei Konjunktionen oder das Projektionsproblem zu lösen, indem sie die Grenze zwischen wörtlicher Bedeutung und pragmatischem Gebrauch klärt.
- Quote paper
- Michaela Hartmann (Author), Katharina Lambeck (Author), Mai Ngo (Author), 2006, Die Implikaturtheorie nach Grice und Levinsons Variationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59743