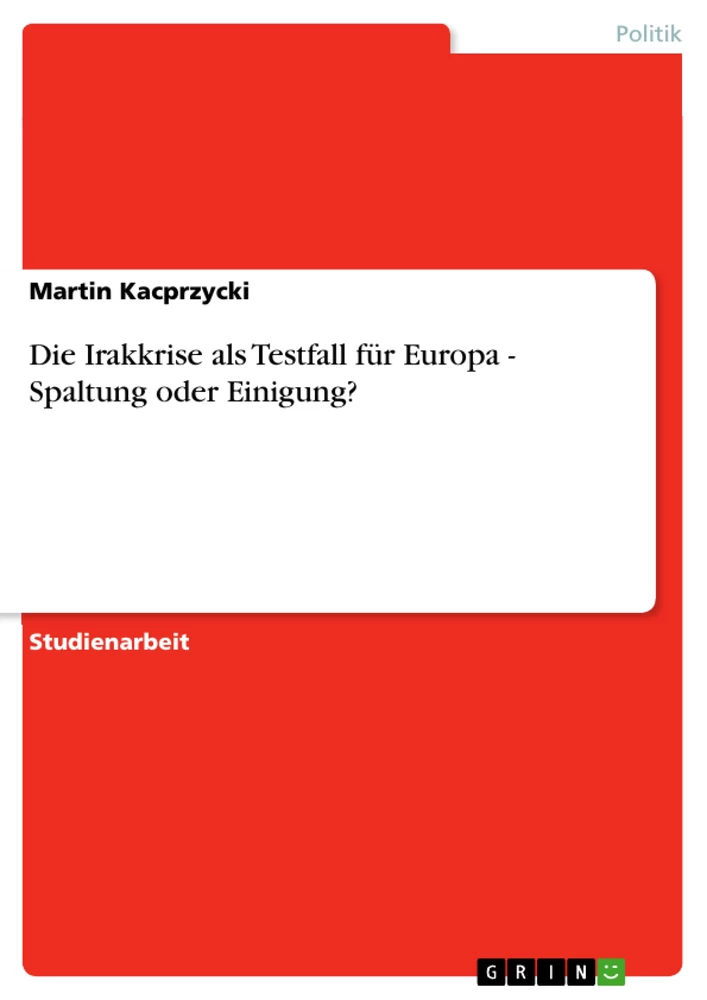Die Irak- Krise hat die Europäische Union und vor allem die GASP in eine Krise geführt. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bildet dabei die zweite Säule der Europäischen Union, die in drei Säulen aufgeteilt ist. Es ging nicht nur um die Frage, ob man die USA unterstützt, sondern es wurden grundlegende Fragen gestellt, die mit dem Irak nichts zu tun haben. Es entstand die Diskussion, welche Ziele die Europäische Union erreichen soll. Wie wird die Zukunft der GASP in Europa aussehen? Sind die Visionen der einzelnen Länder von Europa so unterschiedlich? Hat man gemeinsam Institutionen erschaffen um besser miteinander zu kooperieren, ohne ein Ziel in den Augen? So sagt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot: „ Die Irak-Krise könnte sogar als Ursache dafür gewertet werden, dass alle institutionellen Verbesserungen im Bereich der GASP infolge einer „Realitätsprüfung“ als „Wolkenkuckucksheim“ angesehen werden. Eine gemeinsame Außenvertretung der EU, z.B. im UN-Sicherheitsrat, scheint derzeit völlig unrealistisch”
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Positionen der einzelnen Mitgliedsländer zum Irak-Krieg
- Position Großbritanniens
- Position Osteuropäischer Mitgliedsländer
- Position Frankreichs
- Position Deutschlands
- Vertrag von Amsterdam
- Abstimmungsmodus
- Notwendigkeit und Grenzen der Integration innerhalb der GASP
- Notwendigkeiten der Integration
- Grenzen der Integration
- Zukünftige Entwicklungsoptionen der EU
- Kerneuropa
- Mehrheitsentscheidungen
- Supranational
- Neo-Realismus
- Annahme des Neo-Realismus
- Innere und äußere Dimension
- Zukünftige Entwicklung aus neo-realistischer Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Irak-Krise auf die Europäische Union, insbesondere die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedsländer zum Irak-Krieg, betrachtet die Integrationsmöglichkeiten der GASP im Lichte des Vertrags von Amsterdam und erörtert die zukünftige Entwicklung der GASP unter Berücksichtigung verschiedener Modelle.
- Die Positionen der europäischen Mitgliedsländer zum Irak-Krieg
- Die Rolle des Vertrags von Amsterdam für die GASP
- Die Notwendigkeit und Grenzen der Integration innerhalb der GASP
- Zukünftige Entwicklungsoptionen der GASP
- Die Anwendung des Neo-Realismus auf die Integration der GASP
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Positionen von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den osteuropäischen Mitgliedsländern zum Irak-Krieg, wobei insbesondere die Position Großbritanniens als Beispiel für die enge Zusammenarbeit mit den USA herangezogen wird.
Kapitel 2 analysiert den Abstimmungsmodus des Vertrags von Amsterdam, der die Entscheidungsfindung in der GASP während der Irak-Krise prägte.
Kapitel 3 untersucht die Notwendigkeit und die Grenzen der Integration innerhalb der GASP, wobei die unterschiedlichen Vorstellungen der europäischen Länder bezüglich des zukünftigen Verhältnisses zur GASP zu den USA hervorgehoben werden.
Kapitel 4 skizziert drei mögliche zukünftige Entwicklungen der GASP: die Bildung eines Kerneuropas, die Einführung von Mehrheitsentscheidungen und die Supranationalisierung der GASP.
Kapitel 5 wendet die Theorie des Neo-Realismus auf die Integration der GASP an, indem es zwischen der inneren und äußeren Dimension der Theorie unterscheidet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die Integration der Europäischen Union, die Irak-Krise, die Positionen der Mitgliedsländer, der Vertrag von Amsterdam, die Notwendigkeit und Grenzen der Integration, zukünftige Entwicklungsoptionen, der Neo-Realismus sowie die Beziehung der EU zu den USA.
Häufig gestellte Fragen
Warum führte die Irak-Krise zu einer Spaltung der EU?
Die Mitgliedsländer hatten fundamental unterschiedliche Positionen zur Unterstützung der USA: Während Großbritannien den Krieg unterstützte, lehnten Frankreich und Deutschland ihn entschieden ab.
Was ist die GASP?
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bildet die „zweite Säule“ der EU und soll ein gemeinsames Handeln der Mitgliedstaaten in der Außenpolitik ermöglichen.
Welche Rolle spielte der Vertrag von Amsterdam?
Der Vertrag definierte den Abstimmungsmodus für außenpolitische Entscheidungen, der sich während der Irak-Krise jedoch als unzureichend für eine einheitliche Position erwies.
Was bedeutet „Kerneuropa“ als Zukunftsmodell?
Es ist die Idee, dass eine Gruppe integrationswilliger Staaten in der Außen- und Sicherheitspolitik vorangeht, wenn eine Einigung aller 27 Mitglieder nicht möglich ist.
Wie erklärt der Neo-Realismus das Scheitern einer gemeinsamen EU-Außenpolitik?
Der Neo-Realismus geht davon aus, dass Staaten primär ihre eigenen nationalen Sicherheitsinteressen verfolgen und supranationale Institutionen in Krisenzeiten an Bedeutung verlieren.
- Quote paper
- Martin Kacprzycki (Author), 2006, Die Irakkrise als Testfall für Europa - Spaltung oder Einigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59795