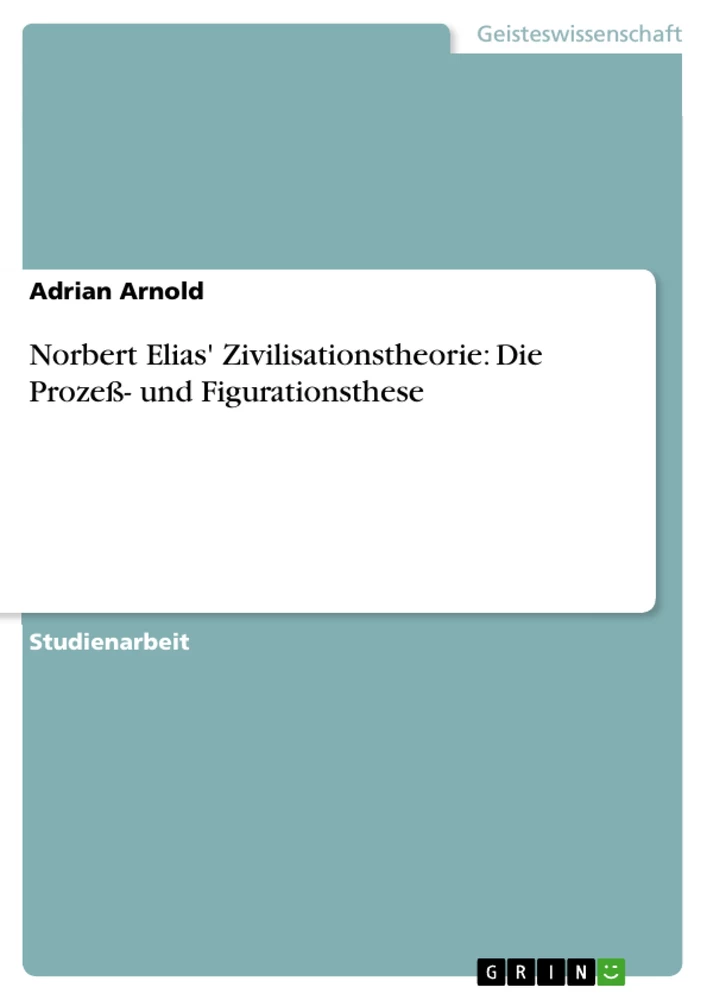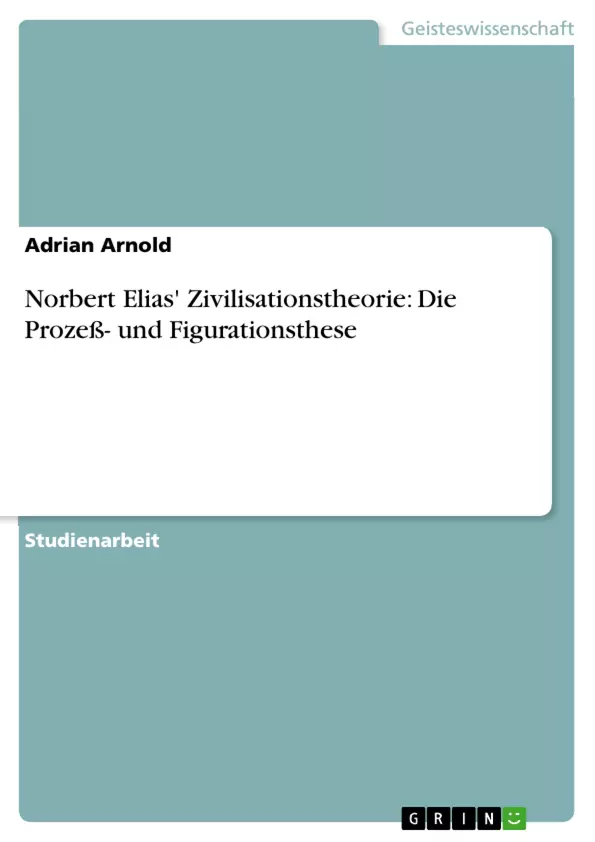Ein Gedicht, von Norbert Elias selbst verfaßt, stellt auf poetische Weise dessen besondere Sichtweise von Gesellschaftsentwicklung als dynamischer, reziproker Zivilisierungs- (Psyche/Individuum) und Zivilisationsprozeß (Gesellschaft/ Figurationen) dar:
„Und Zufall wächst/ im Wandel der Geschichte
dem Wesen ein/ wird mein/ und wird Geschichte
Und Strom wird Welle/ Welle stromdurchtränkt
Bin ich in dich/ seid ihr in sie versenkt
Verschlungen Dasein/ Mensch und Stern und Tier
Wächst eins im anderen/ Du und Ich sind Wir“
Er beschreibt die unauflösbare Verflechtung von Geschichte, Menschen und ihrer Entwicklung, die sich in ihnen selbst wiederfindet. Daß Menschen und Natur in ständiger Wechselwirkung stehen, daß Geschichte in ihnen entsteht und doch in eigenständigen, unbeeinflußbaren Bahnen läuft - eben wie ein Fluß, der letztlich doch sein eigenes Ziel ins Meer sucht – dies ist Inhalt dieser Arbeit. Man kann Elias’ Werke in drei Teile gliedern. Die Zivilisationstheorie, die sich auf die Wechselwirkung von Soziogenese und Psychogenese konzentriert, zweitens die Prozeß- und Figurationstheorie, welche Bestandteil meiner Arbeit ist. Letztens ist dann noch die Wissens- und Wissenschaftstheorie zu nennen.
Zuerst müssen einige anthropologischen Grundannahmen dargelegt werden. Sie sind insofern wichtig, als sie das grundlegende Menschenbild des Autors erklären, auf dem Theorien der Sozialwissenschaft aufbauen. Daran anschließen muß die Forschungsmethodik und die erkenntnistheoretischen Paradigmen, um darzulegen, von wo Elias in seiner Denkweise beginnt, wie er Gesellschaft sieht und mit welchen Werkzeugen er forscht. So kann der Hauptteil die Ergebnisse seiner so strukturierten Arbeit in Bezug auf „Figurationen“ als Prozesse darlegen. Dabei gehe ich auf Machtdifferenzen von Figurationen und auf historische Mechanismen der Staatsbildung näher ein.
Als Abschluß dieser Arbeit füge ich zum einen meine persönlichen Ergänzungen hinzu, die sich durch die Arbeit mit seinen Schriften ergaben. Darin beschreibe ich Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Elias’ Theorien sowie Anknüpfungspunkte und Erklärungen gegenwärtiger Phänomene.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoriemethodischer Hintergrund
- 1. Anthropologische Grundannahmen
- 2. Methodik
- II. Die Prozeß- und Figurationstheorie
- 1. „Figurationen“ im Wandel
- Definition
- Labile Machtbalancen
- Sozialer Wandel: developmentalism
- 2. Staatsbildungsprozesse
- Historische Mechanismen
- 1. „Figurationen“ im Wandel
- III. Resumee
- 1. Persönliche Ergänzungen
- Eine friedlicher Weltstaat?
- 2. Persönliche Kritiken
- a) Erkenntnistheoretische Einwände
- b) Inhaltliches
- 1. Persönliche Ergänzungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Prozeß- und Figurationstheorie von Norbert Elias und analysiert ihre Anwendung auf gesellschaftliche Entwicklungen, insbesondere auf die Staatsbildung. Sie beleuchtet den theoretischen Hintergrund von Elias' Werk, einschließlich seiner anthropologischen Grundannahmen und Forschungsmethodik, und untersucht die zentralen Konzepte der „Figurationen“ im Wandel und der Staatsbildungsprozesse.
- Die anthropologischen Grundannahmen von Elias und ihre Auswirkungen auf seine Theorie
- Die Methodik von Elias und die erkenntnistheoretischen Paradigmen, die seine Denkweise prägen
- Die Bedeutung von Machtdifferenzen und historischen Mechanismen bei der Staatsbildung
- Die Rolle von „Figurationen“ im Wandel und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung
- Persönliche Ergänzungen und kritische Betrachtungen der Theorien von Elias
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert Elias' besondere Sichtweise von Gesellschaftsentwicklung, die sich auf die unauflösbare Verflechtung von Geschichte, Menschen und ihrer Entwicklung konzentriert. Sie führt in die drei Teile von Elias' Werk ein, wobei die Zivilisationstheorie, die Prozeß- und Figurationstheorie und die Wissens- und Wissenschaftstheorie genannt werden.
Das erste Kapitel beleuchtet den Theoriemethodischen Hintergrund, indem es die anthropologischen Grundannahmen von Elias darlegt. Diese Grundannahmen erklären das grundlegende Menschenbild des Autors, das die Theorien der Sozialwissenschaft beeinflussen. Außerdem wird auf die Forschungsmethodik und die erkenntnistheoretischen Paradigmen eingegangen, um zu verdeutlichen, wie Elias Gesellschaft sieht und mit welchen Werkzeugen er forscht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Prozeß- und Figurationstheorie, die den Kern der Hausarbeit bildet. Es behandelt die Definition von „Figurationen“, die Labilen Machtbalancen, den Prozess des sozialen Wandels und die Staatsbildungsprozesse, wobei ein Fokus auf die historischen Mechanismen gelegt wird.
Das dritte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse und fügt persönliche Ergänzungen hinzu. Es beleuchtet Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Elias' Theorien sowie Anknüpfungspunkte und Erklärungen gegenwärtiger Phänomene. Es enthält auch eine kritische Betrachtung der Theorien, wobei Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln genutzt werden.
Schlüsselwörter
Die Hauptschlüsselwörter dieser Arbeit sind Norbert Elias, Prozeß- und Figurationstheorie, Zivilisationstheorie, Staatsbildung, Machtbalancen, Anthropologie, Soziogenese, Psychogenese, Historische Mechanismen, Soziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Norbert Elias unter „Figurationen“?
Figurationen sind die wechselseitigen Abhängigkeitsgeflechte, in denen Menschen zueinander stehen, wie z.B. in Familien, Städten oder Staaten.
Wie hängen Psychogenese und Soziogenese zusammen?
Die psychische Struktur des Einzelnen (Psychogenese) entwickelt sich in ständiger Wechselwirkung mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Strukturen (Soziogenese).
Was ist der Kern von Elias' Zivilisationstheorie?
Sie beschreibt den langfristigen Prozess, in dem menschliche Triebe und Affekte durch gesellschaftliche Zwänge zunehmend kontrolliert und in Selbstzwänge umgewandelt werden.
Welche Rolle spielt Macht in der Figurationstheorie?
Macht ist bei Elias kein Besitz, sondern ein strukturelles Merkmal von Beziehungen. Figurationen sind durch labile Machtbalancen gekennzeichnet, die sich ständig verändern können.
Welche Mechanismen führen laut Elias zur Staatsbildung?
Die Staatsbildung erfolgt durch Konkurrenz- und Monopolmechanismen, bei denen territoriale Einheiten miteinander kämpfen, bis ein Gewalt- und Steuermonopol entsteht.
- Quote paper
- Adrian Arnold (Author), 2001, Norbert Elias' Zivilisationstheorie: Die Prozeß- und Figurationsthese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59803