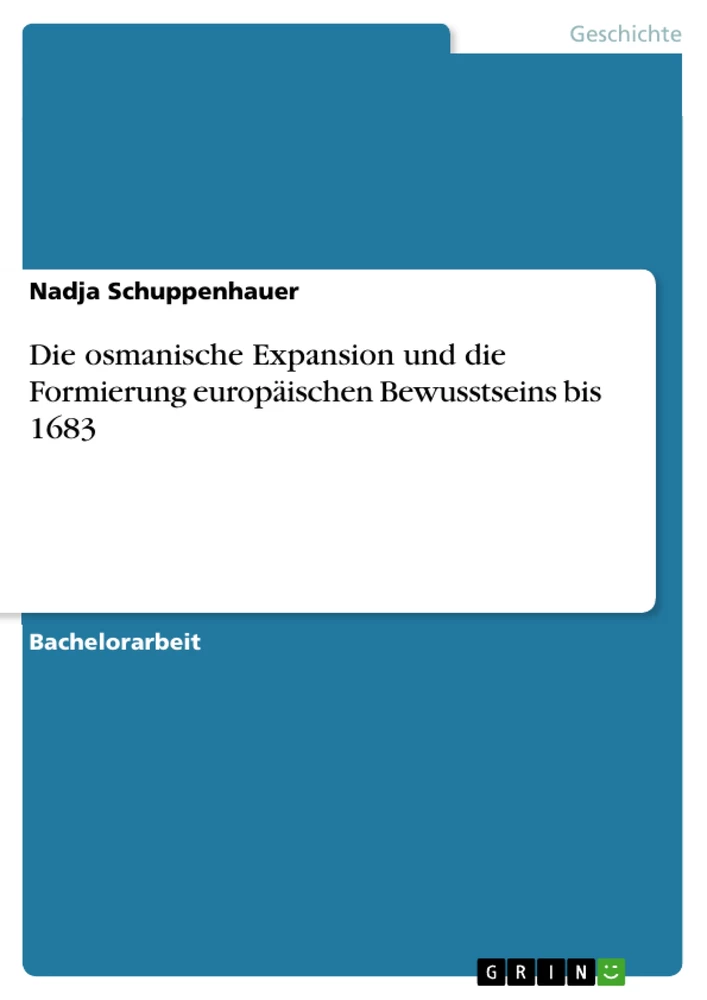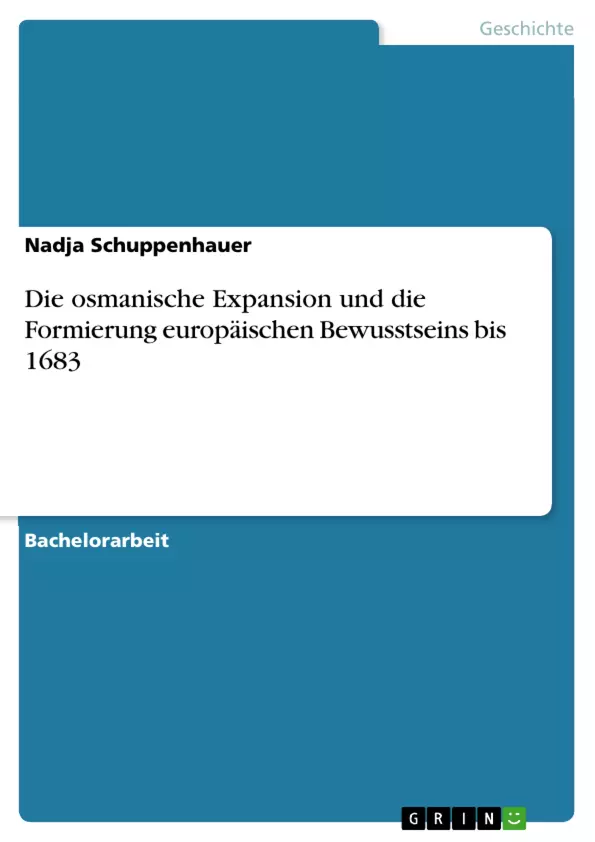Der Begriff „Europa“ im Sinne einer historisch-politischen und kulturellen Einheit ist keine seit grauen Vorzeiten im Bewusstsein der Bewohner dieses Kontinents institutionalisierte Größe, auch wenn dies vielerorts von verantwortlichen Politikern und meinungsbildenden Massenmedien und Eliten im Zuge der Entwicklung Europas in den letzten Jahrzehnten insinuiert werden möchte und auch Historiker sich häufiger „als Apologeten eines scheinbar schon immer existenten Kultureuropa betätigen“. 1 Europa war nie eine Konstante im politischen Sinne, vielmehr ist Europa „not so much a place as an idea“. 2 Dieses Zitat von Peter Burke lässt bereits durchscheinen, dass Europa nie eine fest umrissene Größe war - weder geographisch noch politisch - , sondern vielmehr je nach Interessenlage stets anders und neu definiert wurde. Mehr noch, in der Zeit vom fünften vorchristlichen Jahrhundert bis zum 15. Jh. unserer Zeitrechnung wurde der Begriff „Europa“ nur sporadisch verwendet und ohne dabei viel Gewicht zu besitzen. 3 Die Menschen sahen sich bis zur Frühen Neuzeit - abgesehen von einigen Ausnahmen, auf die im Verlauf der vorliegenden Arbeit noch gesondert einzugehen sein wird - nicht als „Europäer“. Der programmatische Gebrauch des Begriffs „Europa“ im Sinne der oben erwähnten historisch-politischen und kulturellen Einheit beginnt sich vielmehr erst in der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit durchzusetzen, als der Terminus auf Grund bestimmter Entwicklungen neuen Sinn und Inhalt gewinnt 4 und so allmählich eine vorher existente Identifikationsgröße ablöst. Diese Identifikationsgröße war im Mittelalter die Christenheit, und die in den zeitgenössischen Texten üblichen und synonym gebrauchten Termini christianitas und res publica christiana machen deutlich, „that Christendom was the largest unit to which men in the Latin west felt allegiance in the middle ages“. 5 Die christianitas umfasste die latinitas, entsprach also denjenigen Territorien, die im Autoritätsbereich der römischen Papstkirche lagen und schloss somit das byzantinische Reich aus. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung und Gebrauch des Europabegriffs von der Antike bis 1453.
- Der Europamythos
- Die Antike
- Das Mittelalter
- Die osmanische Expansion und die Eroberung Konstantinopels 1453.
- Struktur des Osmanischen Reiches
- Das timar-System
- Das Militärwesen
- Staatsapparat und Gesellschaft
- Expansion und Eroberungen bis 1453.
- Die Eroberung Konstantinopels
- Die Reaktionen auf die Eroberung und ihre Auswirkungen für „Europa“
- Die Weiterentwicklung des Europabegriffs nach 1453 im Sinne einer Formierung europäischen Bewusstseins
- Türkenkriege und Habsburger bis zum Entsatz Wiens 1683.
- Ausblicke
- Schlussbetrachtung
- Resumen
- Anhang
- Karte: Aufstieg des Osmanischen Reiches bis 1683.
- Frontispiz von Breitenfels
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die osmanische Expansion und deren Einfluss auf die Formierung des europäischen Bewusstseins bis 1683. Sie verfolgt die Entwicklung des Europabegriffs von seinen Anfängen bis zum 15. Jahrhundert und analysiert, wie die Eroberung Konstantinopels und die darauf folgende Türkengefahr die europäische Identität prägten.
- Entwicklung des Europabegriffs
- Osmanische Expansion und ihre Folgen für Europa
- Die Rolle der Türkenkriege in der europäischen Geschichte
- Formierung des europäischen Bewusstseins
- Die Bedeutung des 15. Jahrhunderts als Wendepunkt in der europäischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Begriff „Europa“ im Kontext seiner historischen und politischen Entwicklung. Sie betont, dass Europa keine statische Größe ist, sondern stets neu definiert wurde.
Kapitel 2 verfolgt die Entwicklung des Europabegriffs von der Antike bis 1453. Es analysiert den „Europamythos“ und untersucht, wie der Begriff in der Antike und im Mittelalter verwendet wurde.
Kapitel 3 beleuchtet die osmanische Expansion und die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453. Es analysiert die Struktur des Osmanischen Reiches und die Faktoren, die zu seiner Expansion führten.
Kapitel 4 untersucht die Reaktionen auf die Eroberung Konstantinopels und deren Auswirkungen auf das europäische Bewusstsein.
Kapitel 5 analysiert die Weiterentwicklung des Europabegriffs nach 1453 im Kontext der Formierung einer europäischen Identität.
Kapitel 6 untersucht die Türkenkriege und ihre Bedeutung für die Habsburger bis zum Entsatz Wiens im Jahr 1683.
Schlüsselwörter
Europabegriff, Osmanische Expansion, Türkenkriege, Konstantinopel, Europäisches Bewusstsein, Formierung, Identität, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Christenheit, christianitas.
Häufig gestellte Fragen
War „Europa“ schon immer ein fester Begriff?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Europa eher eine Idee als ein fester Ort ist. Bis zur Frühen Neuzeit identifizierten sich Menschen eher mit der „Christenheit“ (christianitas) als mit Europa.
Welchen Einfluss hatte die Eroberung Konstantinopels 1453?
Die Eroberung durch die Osmanen wirkte als Schock für den lateinischen Westen und förderte die Wahrnehmung einer gemeinsamen europäischen Identität angesichts der äußeren Bedrohung.
Was war die Bedeutung des Entsatzes von Wien 1683?
Der Sieg über das osmanische Heer vor Wien markiert das Ende der osmanischen Expansion in Europa und festigte die Rolle der Habsburger sowie ein gestärktes europäisches Selbstbewusstsein.
Was versteht man unter dem „Europamythos“?
Die Arbeit untersucht die antiken Wurzeln des Begriffs, beginnend mit der mythologischen Figur der Europa, und wie dieser Name über Jahrhunderte unterschiedliche politische Inhalte erhielt.
Wie unterschied sich die „christianitas“ vom modernen Europa?
Die mittelalterliche „christianitas“ definierte sich über die Zugehörigkeit zur römischen Papstkirche und schloss das orthodoxe Byzanz oft aus, während der moderne Europabegriff stärker politisch-kulturell geprägt ist.
- Quote paper
- Nadja Schuppenhauer (Author), 2006, Die osmanische Expansion und die Formierung europäischen Bewusstseins bis 1683, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59930