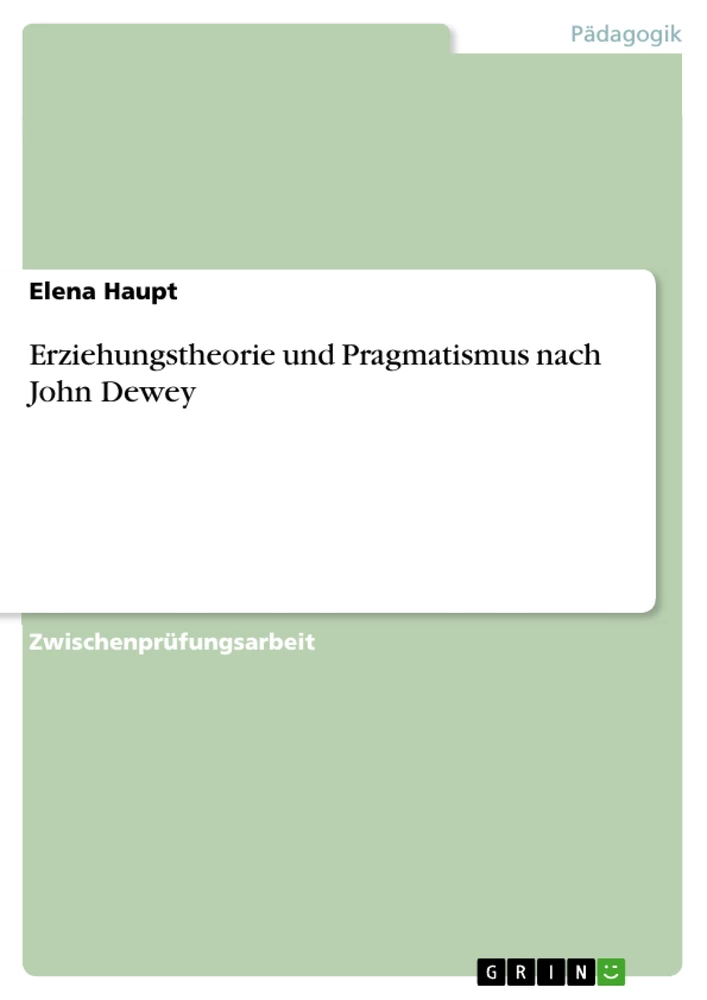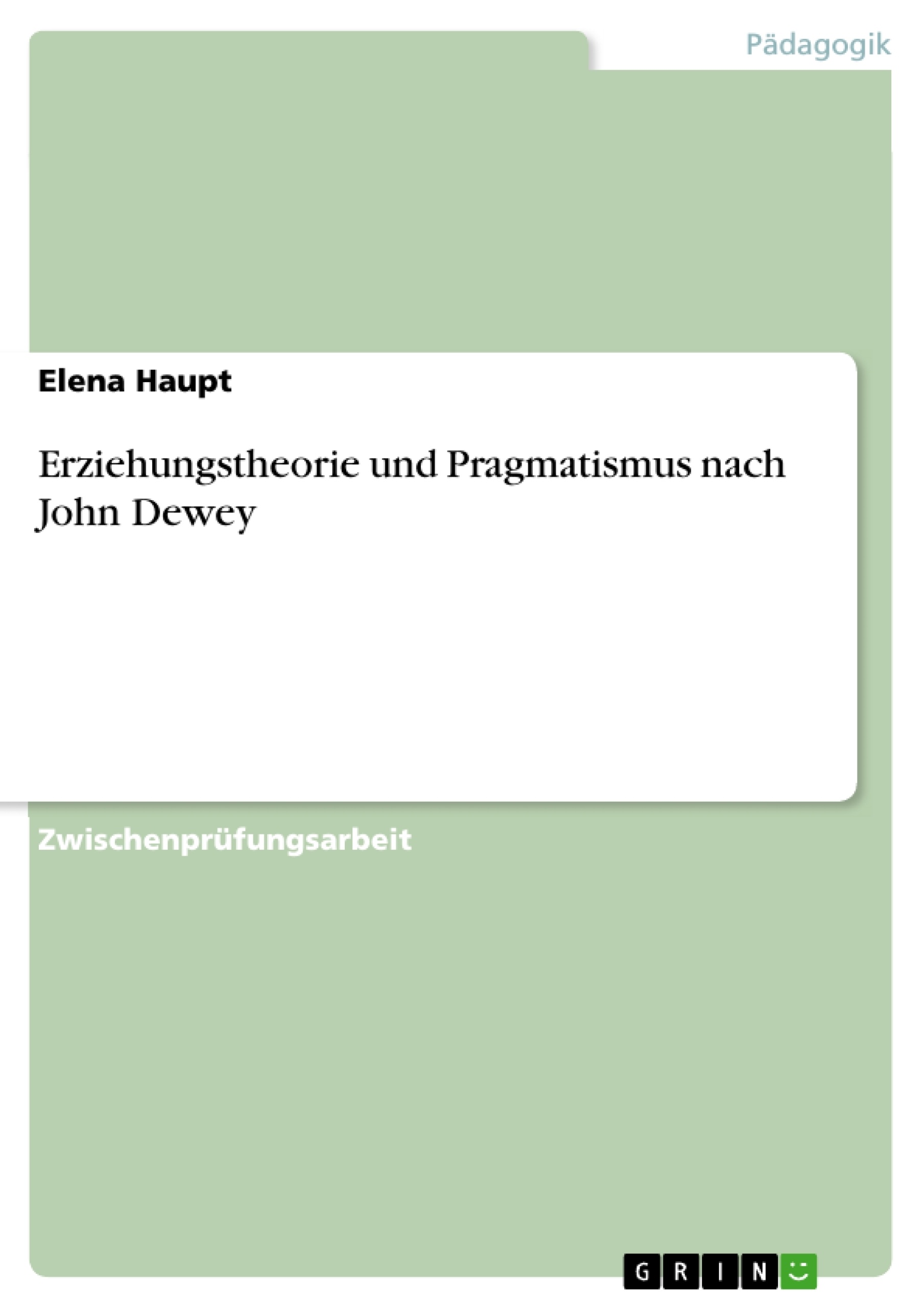In dieser Arbeit wird John Dewey, der amerikanische Philosoph aus dem Ende des 19. Jh. und dem Beginn des 20. Jh. behandelt. In Deutschland wird seine Philosophie deutlich weniger beachtet als seine Reformpädagogik und Erziehungstheorie. Erst in den letzten Jahren sind einige Schriften über seine Philosophie publiziert worden. Doch diese Zahl steht in keinem Verhältnis zu der Anzahl an Deweys eigenen Veröffentlichungen zu Philosophie, Psychologie und Pädagogik, die in seinen gesammelten Werken 37 Bände („The Collected Works of John Dewey, 1882-1953“) umfassen und die teilweise aus einzelnen Monografien aber auch aus zusammengestellten Essays und Briefen bestehen.
Das Hauptaugenmerk bei der Betrachtung von Deweys Werk in dieser Arbeit liegt zunächst auf der Philosophie – insbesondere dem von Dewey beeinflussten Pragmatismus – und hauptsächlich (durch den Rahmen dieser Arbeit) auf seiner Erziehungstheorie. Über die Erziehung hat Dewey zahlreiche Werke publiziert, die in Deutschland – wenn überhaupt – im Grundschulunterricht berücksichtigt werden. In der Grundschule findet sich der Einfluss vor allem im Sachunterricht, da sich Dewey ausgiebig mit der Vermittlung von Sachthemen in der Schule in Abhängigkeit von Entwicklungsphasen von Kindern befasst hat. Bei dieser entwicklungspsychologischen Betrachtung sind also nicht das Stoffpensum, sondern die Interessen und Fähigkeiten der Kinder für die Gestaltung des Unterrichts und die Auswahl der Themen maßgeblich.
Diese Arbeit wurde an der Universität Bremen als Zwischenprüfung im Fach Sachunterricht geschrieben und mit "sehr gut" benotet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biografie
- Thesen
- Philosophische Konzepte
- Erziehungstheorie
- Grundlagen und Definition von Erziehung
- Ziele der Erziehung
- Schulkonzept
- Wirken
- Laborschule Chicago
- Dewey in Deutschland
- Einflüsse auf deutsche Reformpädagogen
- Laborschule Bielefeld
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit John Dewey, einem amerikanischen Philosophen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt zunächst auf seiner Philosophie, insbesondere dem Pragmatismus, und hauptsächlich auf seiner Erziehungstheorie. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Deweys Werk in Bezug auf die Grundschulbildung, insbesondere den Sachunterricht.
- Deweys Philosophie und der Pragmatismus
- Grundlagen und Definition von Erziehung nach Dewey
- Ziele und Konzepte der Erziehung in Deweys Theorie
- Der Einfluss von Deweys Werk auf den Sachunterricht in der Grundschule
- Die praktische Umsetzung von Deweys Ideen in der Laborschule Chicago und anderen Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Werk John Deweys ein und betont die Bedeutung seiner Erziehungstheorie für den Sachunterricht in der Grundschule. Die Arbeit fokussiert auf Deweys Philosophie, insbesondere den Pragmatismus, und die praktische Umsetzung seiner Ideen in der Laborschule Chicago.
Biografie
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Stationen in John Deweys Leben. Es beschreibt seinen Werdegang vom Studium über seine ersten Lehrtätigkeiten bis hin zu seiner Professur an der University of Michigan. Der Einfluss von William T. Harris und George Sylvester Morris auf Deweys Werk wird ebenfalls dargestellt.
Philosophische Konzepte
Dieses Kapitel befasst sich mit Deweys philosophischen Grundlagen, insbesondere dem Pragmatismus. Es untersucht die Bedeutung von Erfahrung und Empirie für Deweys Denken und die Rolle des Experimentalismus in seiner Philosophie.
Erziehungstheorie
Dieses Kapitel behandelt Deweys Erziehungstheorie, die auf seinen philosophischen Grundprinzipien beruht. Es untersucht seine Definition von Erziehung, die Ziele der Erziehung und sein Konzept von Schule. Die Bedeutung von Interessen und Fähigkeiten der Kinder für den Unterricht wird hervorgehoben.
Wirken
Dieses Kapitel beleuchtet die praktische Umsetzung von Deweys Ideen in der Laborschule Chicago und die Verbreitung seiner Theorien in anderen Ländern, einschließlich Deutschlands.
Schlüsselwörter
John Dewey, Pragmatismus, Erziehungstheorie, Philosophie, Sachunterricht, Grundschule, Laborschule Chicago, Reformpädagogik, Entwicklungspsychologie, Erfahrung, Empirie, Experimentalismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer war John Dewey und was ist seine Bedeutung?
John Dewey war ein US-Philosoph und Reformpädagoge, dessen Erziehungstheorie maßgeblich auf dem Pragmatismus basiert und die Kindzentrierung betont.
Welchen Einfluss hat Dewey auf den Sachunterricht?
In der Grundschule findet sich sein Einfluss vor allem in der Vermittlung von Sachthemen, die sich an den Interessen und Entwicklungsphasen der Kinder orientieren.
Was ist der Kern von Deweys Pragmatismus?
Der Pragmatismus sieht Erfahrung und Empirie als zentral an. Wissen wird durch Handeln und Experimentieren (Experimentalismus) gewonnen.
Was war die Laborschule in Chicago?
Es war eine von Dewey gegründete Versuchsschule, in der er seine pädagogischen Konzepte praktisch erprobte, bevor sie weltweit Verbreitung fanden.
Wie wurde Dewey in Deutschland aufgenommen?
Während seine Reformpädagogik (z.B. Laborschule Bielefeld) bekannt ist, wurde seine Philosophie in Deutschland erst in den letzten Jahren intensiver beachtet.
- Citar trabajo
- Dipl.-Geogr. Elena Haupt (Autor), 2005, Erziehungstheorie und Pragmatismus nach John Dewey, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60131