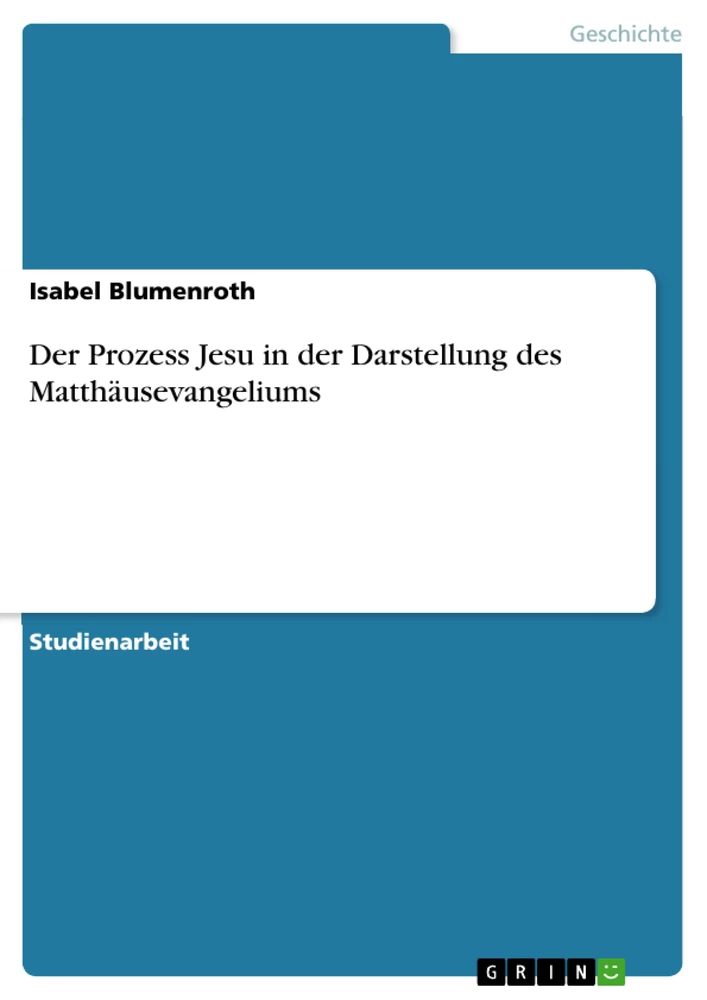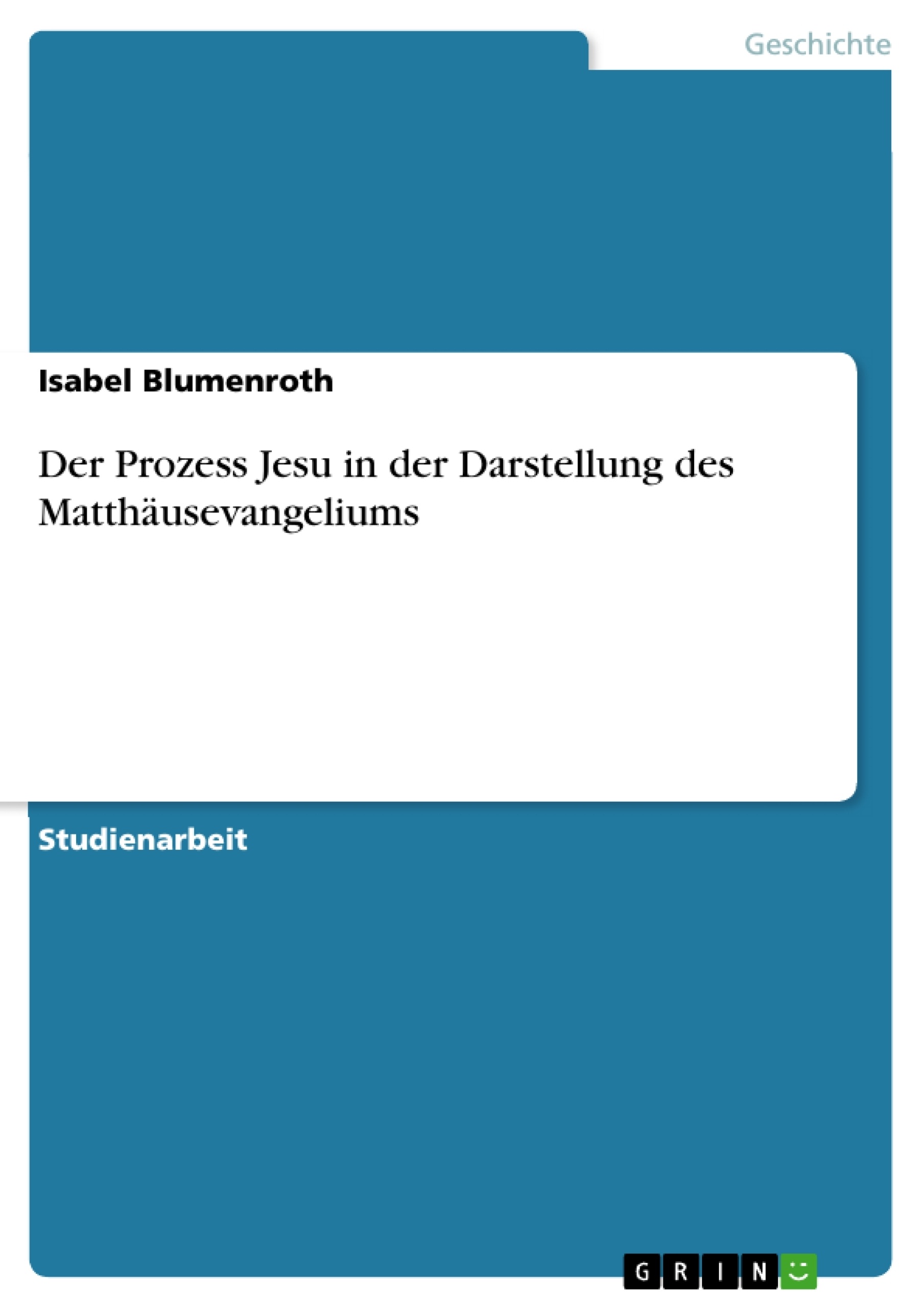[...] Für die historische Untersuchung der Begebenheiten um den Tod Jesu sind die Evangelien trotz ihres schwierigen Charakters dennoch die wichtigsten überlieferten Quellen; sie schildern die Begebnisse in einer Breite, die man in der römischen Historiographie vergeblich sucht. Da ihre Herkunft als Glaubenszeugnisse der jungen Christengemeinde allerdings begründete Zweifel an der unbedingten Historizität der Berichte aufwirft, ist es Aufgabe des Historikers, sorgfältig abzuwägen, zu analysieren und Wahrheit, Wahrscheinlichkeit und theologische Redaktion durch den Evangelisten voneinander zu trennen. Der Fokus dieser Arbeit liegt einerseits auf dem Matthäusevangelium als literarischer Quelle, andererseits auf der hinter ihrem Entstehen zu vermutenden theologischen sowie anwendungsbezogenen Botschaft. Da die Geschichtlichkeit der Begebenheiten jedoch auch unabdingbar mit der Untersuchung der redaktionellen Bearbeitung des Stoffes verknüpft ist, werden die meisten Erwähnungen der Historizität matthäischer Aussagen auf die Fußnoten beschränkt werden, um den Kerntext ganz der matthäischen Theologie widmen zu können. Selbstverständlich jedoch werden historische Gesichtspunkte dort Einzug in den Haupttext finden, wo sie absolut unerlässlich für die Interpretation des Evangeliums sind. Hauptanliegen dieser Arbeit soll es daher nicht sein, einen über jeden Zweifel erhabenen historischen Aufriss der Geschehnisse zu geben, sondern vielmehr die Theologie des Matthäus anhand der literarischen Redaktion des ihm als Basis dienenden Markusevangeliums aufzuzeigen. Zur Schaffung der nötigen Grundlagenkenntnisse wird dies zunächst durch eine kurze Einführung in die vorhandenen - auch außerbiblischen - Quellen zum Prozess Jesu von Nazaret, der Eigenschaften der Gattung "Evangelium" sowie einer Betrachtung der zeitlichen, historischen und theologischen Verhältnisse der Entstehungszeit des matthäischen Passionsberichts geschehen. Danach werden in chronologischer Reihenfolge die einzelnen Verhandlungen vor der jüdischen bzw. römischen Autorität im Detail und unter Beachtung matthäischen Sonderguts (wie etwa der Judas-Perikope) kritisch betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Übersicht über die biblischen und außerbiblischen Quellen
- 1.1 Das Werk: Überlieferung, Entstehung und literarische Gattung des Matthäusevangeliums
- 1.1.1 Historische Rahmenbedingungen: Der Verfasser und seine Gemeinde
- 1.1 Das Werk: Überlieferung, Entstehung und literarische Gattung des Matthäusevangeliums
- 2. Der religiöse Prozess: Die Verhandlung vor dem Synedrium
- 2.1 Betrachtung der matthäischen Darstellung des Synedrialprozesses: Von der Verhaftung bis zur Verurteilung
- 2.2 Matthäisches Sondergut: Die Judas-Perikope
- 3. Der politische Prozess: Die Verhandlung vor Pilatus
- 3.1 Betrachtung der matthäischen Darstellung des römischen Strafprozesses: Das Verhör vor Pilatus
- 3.1.1 Matthäisches Sondergut: Die Passah-Amnestie und der Traum der Frau des Pilatus
- 3.2 Betrachtung der matthäischen Darstellung des römischen Strafprozesses: „Blutruf“, Händewaschung und Todesurteil
- 3.1 Betrachtung der matthäischen Darstellung des römischen Strafprozesses: Das Verhör vor Pilatus
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung des Prozesses Jesu im Matthäusevangelium. Ziel ist es, die theologische Botschaft des Matthäus anhand seiner literarischen Bearbeitung des Markusevangeliums aufzuzeigen. Dabei wird die Geschichtlichkeit der Ereignisse im Kontext der redaktionellen Bearbeitung betrachtet. Die Arbeit berücksichtigt sowohl das Matthäusevangelium als literarische Quelle als auch die dahinterstehende theologische und anwendungsbezogene Botschaft.
- Das Matthäusevangelium als literarische Quelle und seine theologische Botschaft
- Der Vergleich der biblischen und außerbiblischen Quellen zum Prozess Jesu
- Analyse des religiösen Prozesses vor dem Synedrium
- Untersuchung des politischen Prozesses vor Pilatus
- Die Bedeutung des matthäischen Sonderguts für die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die komplexe Rezeptionsgeschichte der Evangelien ein und hebt die besondere Bedeutung des Matthäusevangeliums und seines Passionsberichts hervor. Sie betont die Notwendigkeit, bei der Untersuchung der Ereignisse um den Tod Jesu zwischen historischer Wahrheit und theologischer Redaktion zu unterscheiden. Der Fokus der Arbeit liegt auf der matthäischen Theologie, wobei historische Aspekte nur dort berücksichtigt werden, wo sie für die Interpretation unerlässlich sind.
1. Übersicht über die biblischen und außerbiblischen Quellen: Dieses Kapitel behandelt die vorhandenen Quellen zum Prozess Jesu. Es hebt die Bedeutung der Evangelien als wichtigste Quellen hervor, trotz der damit verbundenen Herausforderungen bezüglich der Historizität. Es werden kurz die wenigen außerbiblischen Quellen wie Josephus, Plinius, Tacitus und Sueton vorgestellt, wobei deren Relevanz für die detaillierte Prozessanalyse als begrenzt eingeschätzt wird. Das Kapitel betont die Einzigartigkeit der Evangelien als umfassende, wenn auch parteiische, Berichte.
Schlüsselwörter
Matthäusevangelium, Jesusprozess, Synedrium, Pilatus, Passionsbericht, theologische Redaktion, historische Quellen, außerbiblische Quellen, matthäisches Sondergut, Judaskus, Passah-Amnestie.
Häufig gestellte Fragen zum Matthäus-Evangelium und dem Prozess Jesu
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung des Prozesses Jesu im Matthäusevangelium. Sie untersucht die theologische Botschaft des Matthäus und seine literarische Bearbeitung des Markusevangeliums, wobei die Geschichtlichkeit der Ereignisse im Kontext der redaktionellen Bearbeitung betrachtet wird. Die Arbeit betrachtet sowohl das Matthäusevangelium als literarische Quelle als auch die dahinterstehende theologische und anwendungsbezogene Botschaft.
Welche Quellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt primär das Matthäusevangelium als literarische Quelle. Zusätzlich werden die anderen Evangelien als biblische Quellen betrachtet. Außerbiblische Quellen wie Josephus, Plinius, Tacitus und Sueton werden erwähnt, jedoch als begrenzt relevant für die detaillierte Prozessanalyse eingeschätzt. Der Fokus liegt auf der matthäischen Theologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Schlusswort. Kapitel 1 bietet einen Überblick über biblische und außerbiblische Quellen zum Prozess Jesu. Kapitel 2 analysiert den religiösen Prozess vor dem Synedrium, Kapitel 3 den politischen Prozess vor Pilatus. Jedes Kapitel betrachtet insbesondere das matthäische Sondergut.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind das Matthäusevangelium als literarische Quelle und seine theologische Botschaft; der Vergleich biblischer und außerbiblischer Quellen; die Analyse des religiösen Prozesses vor dem Synedrium; die Untersuchung des politischen Prozesses vor Pilatus; und die Bedeutung des matthäischen Sonderguts für die Interpretation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Unterschied zwischen historischer Wahrheit und theologischer Redaktion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Matthäusevangelium, Jesusprozess, Synedrium, Pilatus, Passionsbericht, theologische Redaktion, historische Quellen, außerbiblische Quellen, matthäisches Sondergut, Judaskuss, Passah-Amnestie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die theologische Botschaft des Matthäus anhand seiner literarischen Bearbeitung des Markusevangeliums aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht, wie Matthäus den Prozess Jesu darstellt und welche theologische Aussage er damit verbindet.
Wie wird das Matthäische Sondergut behandelt?
Das matthäische Sondergut, also die Textstellen, die nur im Matthäusevangelium vorkommen, spielt eine wichtige Rolle in der Analyse. Es wird untersucht, wie dieses Sondergut die Interpretation des Prozesses beeinflusst und zur theologischen Botschaft des Matthäus beiträgt. Beispiele hierfür sind die Judas-Perikope und die Passah-Amnestie.
Wie wird die Historizität des Ereignisses betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen historischer Wahrheit und theologischer Redaktion. Historische Aspekte werden nur dort berücksichtigt, wo sie für die Interpretation unerlässlich sind. Der Fokus liegt auf der matthäischen Theologie und ihrer Interpretation des Ereignisses.
- Arbeit zitieren
- M.A. Isabel Blumenroth (Autor:in), 2003, Der Prozess Jesu in der Darstellung des Matthäusevangeliums, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60198