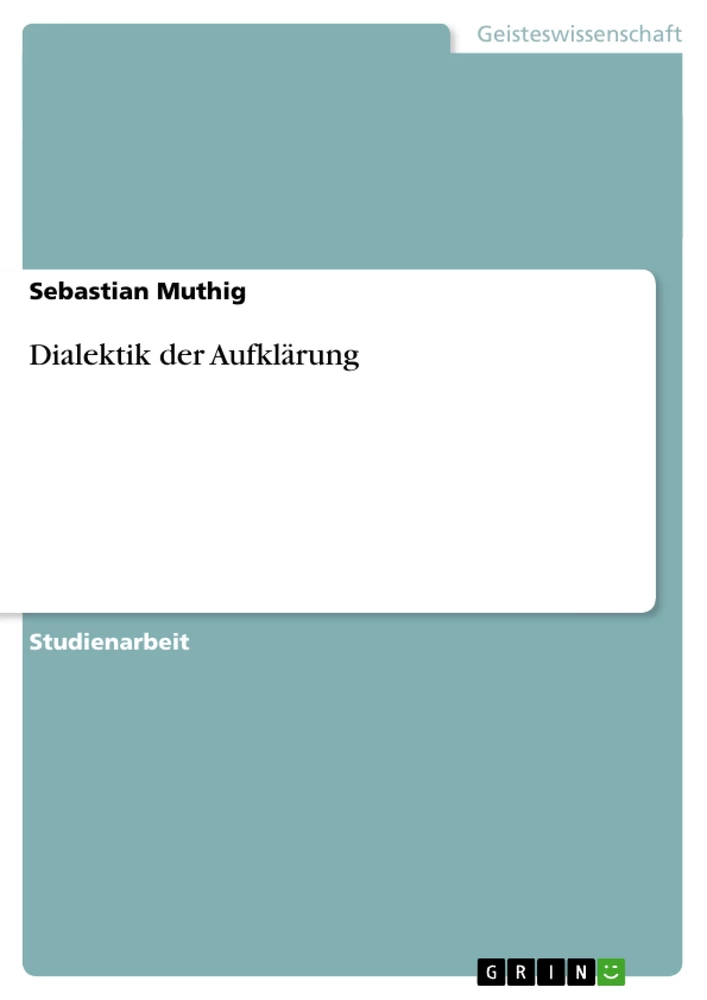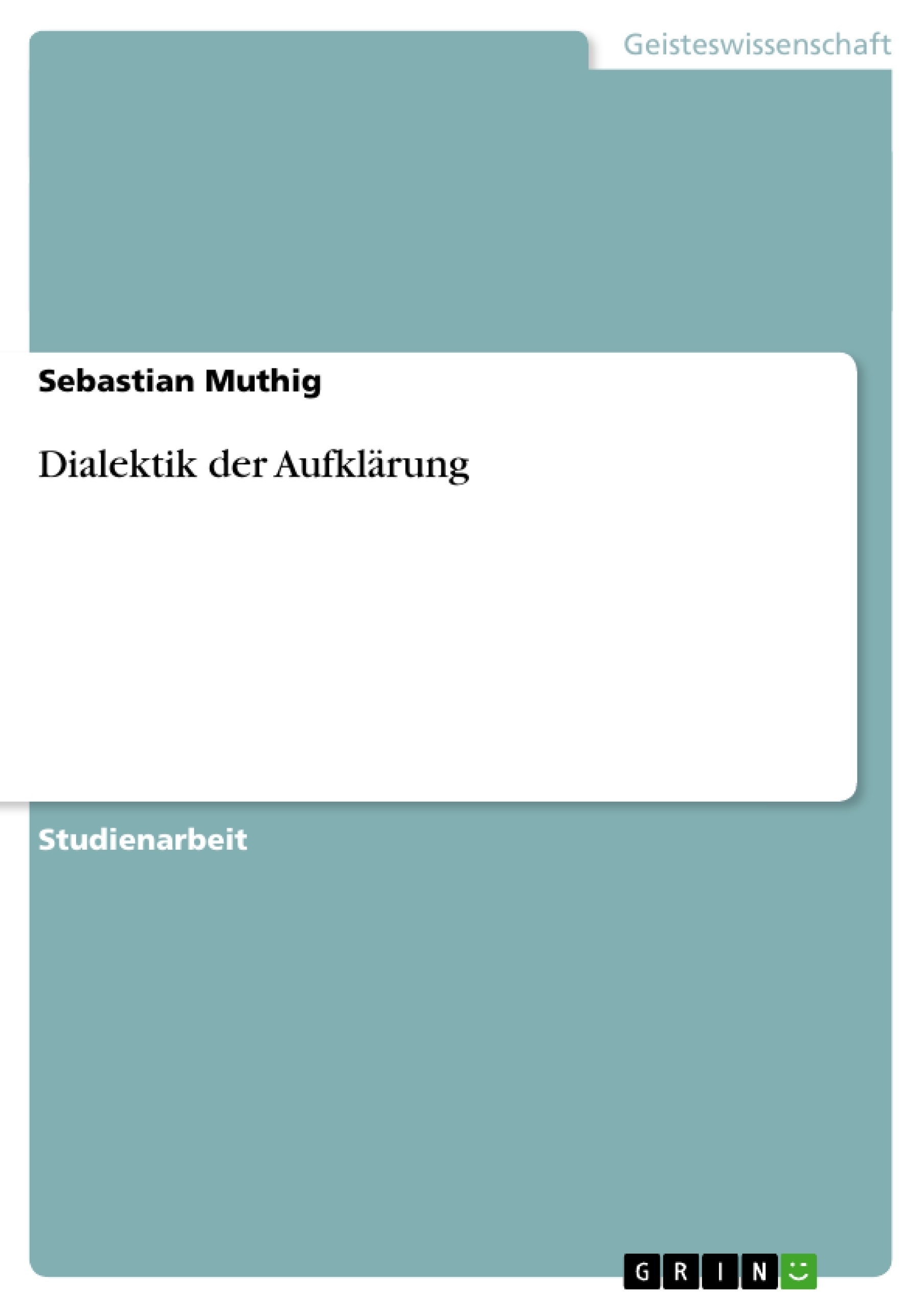Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Das Unbehagen in der Kultur
1.1. Die Ontogenese des Realitätsprinzips
1.2. Ersatzbefriedigung, Religion und Sublimierung
1.3. Kulturanforderungen
1.4. Liebe und Vergesellschaftung
1.5. Aggressionstrieb und Kultur
1.6. Genese von „Über-Ich“ und Gewissen
1.7. Das Unbehagen unter dem „Kultur-Über-Ich“
2. Grenzen der Aufklärung
2.1. Das Verhältnis der Juden zur bestehenden Ordnung
2.2. Antisemitismus als Ideologie eines „dynamischen Idealismus“
2.3. Die sozio-ökonomischen Ursachen des Antisemitismus
2.4. Die religiösen Motive des Antisemitismus
2.5. Die Ursachen der Idiosynkrasie als Konstituens des Antisemitismus
2.6. Die pathische Projektion und paranoische Reaktionsform
2.7. Die psychologische Enteignung der Triebökonomie der Subjekte und die „Ticketmentalität“ als Resultat des Wirtschaftsprozesses
3. Der Charakter als Determinante ideologischer Präferenzen
3.1. Der Individuationsprozeß
3.2. Autorität und Familie
3.2. Kausalität von Ideologie und Charakter
3.3. Konstruktion der F-Skala/psychologische Variablen
4. Typologie der Vorurteilsvollen und Vorurteilsfreien Charakterstrukturen
4.1. Das „Oberflächenressentiment“ und der „starre Vorurteilsfreie“
4.2. Das „konventionelle Syndrom“
4.3. Das „autoritäre“ Syndrom
4.4. Der „Rebell“ und „Psychopath“ (Rowdy)
4.5. Der „Spinner“
4.6. Der „manipulative“ Typus
4.7 Der „genuine Liberale“
5. Die Psychologie des Nazismus
5.1. Die psychologischen Bedingungen
5.2. Die wirtschaftlichen und politischen Ursachen
5.3. Die Ideologie
6. Epilog
7. Bibliographie
Prolog
Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Deutschen Reich am 30.1.1933 und dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933, scheiterte der Versuch einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Die Weimarer Republik erlebte ihren Untergang mit dem Aufstieg des Faschismus und des Dritten Reiches. Mit dem Nazismus folgte die planmäßige Verfolgung und Vernichtung von 6 Millionen Juden, Hunderttausenden slawischen „Untermenschen“, Sinti und Roma, „Asozialen“, Behinderten, Homosexuellen, Angehörigen von religiösen Minderheiten, politisch Andersdenkenden und Intellektuellen. Diese Terrorherrschaft mündete in den Zweiten Weltkrieg mit seinen mehr als 55 Millionen Toten. Ein zentrales Thema für die damals exilierten Mitglieder der Frankfurter Schule war die nicht zu leugnende schnelle Anpassung der deutschen Arbeiterschaft an das nationalsozialistische Herrschaftssystem. Hier drängte sich eine Verbindung von sozio-ökonomischen Strukturen und sozialpsychologischen Dispositionen geradezu auf. Ein Großteil der im Exil verfaßten Werke hatten den Nazismus, Antisemitismus und allgemein Autoritätsunterwürfigkeit zum Gegenstand.
Ganz in dieser Tradition der Frankfurter Schule erschien 1944 das Werk die „Dialektik der Aufklärung“[1] von Horkheimer und Adorno, welche beide im Exil existentiell am Holocaust gelitten hatten. In diesem Buch wird die von Ohnmachtsgefühlen begleitete Skepsis und der tiefe Pessimismus in den Analysen besonders deutlich. Wie in allen im Exil entstandenen Werken, zeugt auch dieses von der Überzeugung der Autoren, daß das Schicksal der Menschengesellschaft ein schlimmes Ende nehmen wird. Es geht nicht länger um die Verhinderung des Schlimmsten, um die Befreiung der Menschen, sondern nur noch um die Verhinderung des Schlimmsten, nämlich eine Verhinderung des Holocaust in einer faschistischen Welt. In der „Dialektik der Aufklärung“ wird von beiden Autoren der Versuch unternommen, die psychologischen Elemente des Antisemitismus zu bestimmen und zu analysieren. Im Verlauf ihrer Analyse kommen beide Autoren zu dem Schluß, daß sich das Postulat der Aufklärung (Autonomie und Freiheit durch logischen Rationalismus) als des „Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ mittels der Devise „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ (Kant) als Trugschluß erwiesen hat. „Die rastlose Selbstzerstörung der Aufklärung zwingt Denken dazu, sich auch die letzte Arglosigkeit gegenüber den Gewohnheiten und Richtungen des Zeitgeistes zu verbieten.“ (Vgl. Horkheimer u. Adorno, Dialektik der Aufklärung; S.16f.). Aus dem „stahlharten Gehäuse“ der Moderne (Max Weber) war eine „Wirklichkeit als Hölle“ geworden. In Teil 2 dieses Exposés werde ich den Versuch unternehmen ihre zentrale philosophisch rationalitätskritische, dialektische Sicht der Aufklärung in bezug auf den Holocaust zu rekonstruieren.
Adornos „Studien zum autoritären Charakter“[2] entstanden 1950 vor dem Hintergrund der allgemeinen, vor allem aber der sozialpsychologischen, Erklärungsversuche hinsichtlich der Anfälligkeit von Individuen für faschistische Ideologien, mit der Absicht solchen Phänomenen entgegenarbeiten zu können. Er orientierte sich an der Hypothese, daß politische, ökonomische und soziale Überzeugungen Einfluß auf die Charakterstrukturbildung nehmen, welche sich in potentiell antidemokratischen oder faschistischen Tendenzen äußern. Zu beantworten versuchte Adorno die Fragen: Wie kommt antidemokratisches Denken zustande? Welche Determinanten liegen dem zugrunde? Wie sieht das potentiell faschistische Individuum aus? Warum gibt es Personen, denen solches Denken nicht eigen ist? Er gelangte zu der Einsicht, daß eine Korrelation zwischen den fundamentalen strukturellen Familienverhältnissen und dem „autoritären Charakter“ besteht. Die allgemeine Aufgeschlossenheit der Eltern, vor allem die dem Kind durch die Mutter entgegengebrachte Liebe sind die bedeutendsten Faktoren, die für die Ausbildung einer „vorurteilsfreien“ Charakterstruktur verantwortlich sind. Da seiner Auffassung nach eine solche Analyse nur durch eine sozialwissenschaftlich bezogene Psychoanalyse gewährleistet werden kann, lag das Hauptgewicht seiner Erklärungsversuche der Charakterstrukturen auf der spezifischen Lösung der ödipalen Konfliktsituation[3] und ist somit stark an Freud orientiert. Bei den direkt zu messenden und zu beobachtenden Aspekten der Charakterstruktur folgt er dagegen in erster Linie der akademischen Psychologie.
In Teil 3 werde ich somit eine Einführung in die soziologischen, sozialpsychologischen und psycho-analytischen Grund- und Ausgangsüberlegungen geben um anschließend in Teil 4 schließlich zu einer Typologie der (anti-) autoritären Charaktere finden.
Freuds Auffassung von den menschlichen Beziehungen entspricht folgender: Der Einzelne ist mit biologischen Trieben ausgestattet, welche unbedingt befriedigt werden müssen. Für die Triebbefriedigung tritt das Individuum mit Objekten in Interaktion, wobei die Beziehung stets Mittel zum Zweck, aber niemals Selbstzweck ist. Durch die gesellschaftliche Unterdrückung von bestimmten Trieben kommt es zu deren Sublimierung in kulturell wertvolle Strebungen. Die Relation des Einzelnen zur Gesellschaft ändert sich nur soweit, als es durch die verstärkt gesellschaftliche Repression der Triebe (um so eine weiter stärkere Sublimierung zu erzwingen) oder die vermehrte, sozial legitimierte Triebbefriedigung (und dafür Kultur opfert) es dazu in der Lage ist. Da Freuds psychoanalytische Kulturtheorie[4] den psychoanalytischen Bezugspunkt der Arbeit des Instituts darstellt, erscheint es mir aus heuristischer Sicht notwendig diese zu Beginn im 1. Teil zu skizzieren, da sie den Ausgangspunkt der weiteren sozialpsychologischen und -philosophischen Reflexionen darstellt.
Von Freuds Interpretationshaltung weicht Erich Fromms Standpunkt in seinem Werk „Die Furcht vor der Freiheit“[5] ab. „Die These dieses Buches lautet, daß der modernen Mensch, nachdem er sich von den Fesseln der vorindustrialistischen Gesellschaft befreite, die ihm gleichzeitig Sicherheit gab und Grenzen setzte, sich noch nicht an die Freiheit – verstanden als die positive Verwirklichung seines individuellen Selbst - errungen hat; d.h., daß er noch nicht gelernt hat, seine intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten voll zum Ausdruck zu bringen. Die Freiheit hat ihm zwar Unabhängigkeit und Rationalität ermöglicht, aber sie hat ihn isoliert und dabei ängstlich und ohnmächtig gemacht. Diese Isolierung kann der Mensch nicht ertragen, und er sieht sich vor die Alternative gestellt, entweder der Last seiner Freiheit zu entfliehen und sich aufs neue in Abhängigkeit und Unterwerfung zu begeben oder voranzuschreiten zur vollen Verwirklichung jener positiven Freiheit, die sich auf die Einzigartigkeit und Individualität des Menschen gründet.“ (Fromm, Erich; ibid.; S.7f.). Seine Analyse gründet auf der Überzeugung, daß das Hauptproblem der Psychologie nicht die Befriedigung oder Nicht-Befriedigung von triebhaften Bedürfnissen an sich ist, sondern die spezifische Art der Bezogenheit des Individuums zur Außenwelt. An Stelle der ödipalen Konfliktsituation und deren spezifischen Lösung (bei Adorno) postuliert Fromm das Primat des Individuationsprozesses, - die Loslösung von den primären Bindungen -, dessen weitreichende Auswirkungen zu einer potentiell autoritären Charakterstrukturbildung führen können. Im Gegensatz zu Freud stehen seiner Meinung nach Triebbefriedigung und Kultur in einem umgekehrten Verhältnis: je größer die soziale Repression desto größer ist die Kultur und die Disposition zu neurotischen Störungen. In Bezug auf die Relation Gesellschaft - Individuum differiert Fromms Vorstellung einer dynamischen Beziehung im Kontrast zu Freuds statischer: die Gesellschaft hat nicht nur die Aufgabe der Unterdrückung von Bedürfnissen, sondern auch kreative Funktionen. So sind jene Triebe, welche die Unterschiede im Charakter der Menschen bedingen (z.B. Liebe, Haß, das Streben nach Macht und das Verlangen sich zu unterwerfen, etc.), Produkte des gesellschaftlichen Prozesses. Neben der Beantwortung der bereits oben angeführten Fragen gilt mein Interesse im 5. Teil desweiteren der Psychologie des Nationalsozialismus selbst: Was war so besonderes an dieser Ideologie, daß ihr Millionen Menschen bereitwillig folgten? Wie ist es zu erklären, daß sich eine so offensichtlich irrationale Ideologie solcher Popularität erfreuen und manifestieren konnte?
Kurzum, es geht mir um eine Analyse des Phänomens der Autoritätsunterwürfigkeit aus einer freudo-dialektischen Perspektiven vor dem Hintergrund des nationalsozialistischen Faschismus.
1. Das Unbehagen in der Kultur
1.1. Die Ontogenese des Realitätsprinzips
Freud zufolge erscheint uns gewöhnlich das Ich bzw. das eigene Selbst als selbständig, einheitlich und gegen alles andere abgegrenzt. Die Psychoanalyse konnte hingegen zeigen, daß dies ein Trugschluß ist, daß sich vielmehr das Ich nach innen ohne scharfe Grenze in ein unbewußtes seelisches Wesen, das Es, fortsetzt. Lediglich nach außen hin scheint das Ich abgrenzbar zu sein. Wird die Abgrenzung des Ichs gegen die Außenwelt aufgehoben oder das Ich-Gefühl generell Störungen unterworfen, so äußert sich das in den bekannten, pathologisch beschreibbaren, Krankheitsbildern. Die Frage besteht nun darin, wie sich dieses Ichgefühl ontogenetisch entwickelt hat. Zur Anerkennung eines „außerhalb“ und somit zur Loslösung des Ichs von der ursprünglichen Empfindungsmasse, kam es wahrscheinlich durch die häufigen, vielfältigen und unvermeidlichen Unlust- und Schmerzempfindungen, welche das unumschränkt herrschende Lustprinzip aufhoben und in Frage stellten. Die Einsetzung des Realitäts-prinzips dient dabei der praktischen Absicht, die verspürten und die drohenden Unlustempfindungen abzuwehren. Genuin enthält das Ich alles, später separiert es sich von der Außenwelt. Unser aktuelles Ichgefühl ist also ein Rudiment eines umfassenderen Gefühls, welches einer innigeren Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt entsprach. Es ist vergleichbar mit einem „ozeanischen“ Gefühl von „Ewigkeit“, von etwas Unbegrenztem, Schrankenlosen, welches als die Quelle der religiösen Energie angesehen werden kann. Man kann davon ausgehen, daß die Konservierung von Vergangenem im Seelenleben eher die Regel als die Ausnahme ist, daß es nicht notwendigerweise zerstört werden muß. Die religiösen Bedürfnisse können aus der infantilen Hilflosigkeit und der durch sie geweckten Vatersehnsucht abgeleitet werden, zumal sich dieses Gefühl durch die Angst vor der Übermacht des Schicksals erhalten wird.
1.2. Ersatzbefriedigung, Religion und Sublimierung
Die Religion, als System von Lehren und Verheißungen, sieht sich in die Lage versetzt, dem Subjekt die Rätsel der Welt vollständig erklären zu können, sowie ihm zu versichern, daß die Vorsehung über sein Leben wachen und etwaige Versagungen in einer jenseitigen Existenz gutmachen werde. Diese Vorsehung wird in der Form eines großartig erhöhten Vaters personifiziert. Die Entbehrungen und die Frage nach dem Sinn des Lebens führen zu Ersatzbefriedigungen, wie sie sich in einem solchen religiösen System finden lassen. Das Streben nach Glück ist nichts anderes als das Lustprinzip, welches das Leben eines jeden Menschen bestimmt. Es beherrscht den seelischen Apparat von Anbeginn an und konfligiert ständig mit der Welt. Unter dem Einfluß der Außenwelt verwandelt es sich in das Realitätsprinzip, welches an Stelle des Lustgewinnung die Leidvermeidung setzt. In der gesellschaftlichen Verweigerung der Befriedigung der Triebbedürfnisse ist nun die Ursache schweren Leidens anzusiedeln. Bei der Beherrschung des Trieblebens, waltet das Realitätsprinzip uneinge-schränkt. Es kommt zu einer Libidoverschiebung: die Triebziele werden derart verlagert, daß sie von der Versagung der Außenwelt nicht tangiert werden. Eine kulturell wertvolle Form stellt hierbei die Sublimierung dar, bei welcher der Lustgewinn aus physischer oder intellektueller Arbeit gezogen wird. „Keine andere Technik der Lebensführung bindet des Einzelnen so fest an die Realität als die Betonung der Arbeit, die ihn wenigsten in ein Stück der Realität, in die menschliche Gemeinschaft sicher einfügt. Die Möglichkeit, ein starkes Ausmaß libidinöser Komponenten, narzißtische, aggressive und selbst erotische, auf die Berufsarbeit und auf die mit ihr verknüpften menschlichen Beziehungen zu verschieben, leiht ihr einen Wert, der hinter ihrer Unerläßlichkeit zur Behauptung und Rechtfertigung der Existenz in der Gesellschaft nicht zurücksteht. Besondere Befriedigung vermittelt die Berufstätigkeit, wenn sie eine frei gewählte ist, also bestehende Neigungen, fortgeführte oder konstitutionell verstärkte Triebregungen durch Sublimierung nutzbar zu machen gestattet“ (a.a.O.; 438). Eine wahnhafte Umbildung der Wirklichkeit durch eine große Anzahl von Menschen ist signifikant für die Religionen. Sie sind ein Massenwahn in denen sich die Menschen Glücksver-sprechungen und Leidensschutz erhoffen[6]. Die Religionen drängten ihren Weg zum Glückserwerb und Leidensschutz allen Menschen in gleicher Weise auf, da sie historisch eine allumfassende Macht darstellten. Ihre Technik besteht darin, den Wert des Lebens herabzudrücken und das Bild der realen Welt wahnhaft zu entstellen. Dennoch ersparte die Religion vielen Menschen, durch die gewaltsame Fixierung eines psychischen Infantilismus und durch die Einbeziehung in einen Kollektivwahn, eine individuelle Neurose. Allerdings offenbart sich hierbei, daß der Preis für diese Trostmöglichkeit die bedingungslose Unterwerfung ist.
1.3. Kulturanforderungen
Unser Leiden resultiert aus der Übermacht der Natur, der Hinfälligkeit unseres eigenen Körpers und der Unzulänglichkeit der Einrichtungen, welche die Beziehungen der Menschen zueinander in Familie, Staat und Gesellschaft regeln. Der Kulturmensch wird in dem Maße neurotisch, wie die Gesellschaft ihm im Namen ihrer kulturellen Ideale Versagungen auferlegt. Kultur bezeichnet die Summe der Leistungen und Einrichtungen, in denen sich unser Leben von dem unserer tierischen Ahnen entfernt hat und dient einerseits dem Schutz des Menschen gegen die Natur und andererseits der Regelung der Beziehungen der Menschen untereinander. Unter den an die Individuen gestellten Kulturforderungen nehmen Schönheit (Ästhetik), Reinlichkeit und Ordnung eine besondere Stellung ein. Obwohl ihnen nicht die existentielle Funktion wie der Beherrschung der Naturkräfte zugeschrieben wird, so wird sie ebenso niemand mit den Status von Nebensächlichkeiten herabwürdigen wollen. Vielmehr ist man geneigt Kultur an den höheren psychischen Tätigkeiten, der intellektuellen, wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen der Menschheit festzumachen. Unter diese Ideen fallen die religiösen Systeme, die philosophische Spekulation und das, was man als die Idealbildung der Menschen bezeichnen kann, ihre Vorstellungen von einer möglichen Vollkommenheit der einzelnen Person, des Volkes, der ganzen Menschheit und die Anforderungen, die sie auf Grund solcher Vorstellungen erheben.
Der entscheidende kulturelle Schritt vollzog sich mit Zusammenschluß der Individuen zu einer Gemeinschaft, in welcher die Macht des Einzelnen durch die der Gemeinschaft substituiert wurde. Die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft beschränken sich in ihren Befriedigungsmöglichkeiten und unterwerfen sich einem gesatzten Recht. Die nächste kulturelle Anforderung ist die der Gerechtigkeit, während die individuelle Freiheit durch die Gemeinschaft eingeschränkt wird. „Was sich in einer menschlichen Gemeinschaft als Freiheitsdrang rührt, kann Auflehnung gegen eine bestehende Ungerechtigkeit sein und so einer weiteren Entwicklung der Kultur günstig werden, mit der Kultur verträglich bleiben. Es kann aber auch dem Rest der ursprünglichen, von der Kultur ungebändigten Persönlichkeit entstammen und so Grundlage der Kulturfeindseligkeit werden. Der Freiheitsdrang richtet sich also gegen bestimmte Formen und Ansprüche der Kultur oder gegen Kultur überhaupt“. (ibid.; 455). Die Hauptenergie der Menschheit wird für den Ausgleich zwischen den individuellen und den kulturellen Massenansprüchen aufgewendet. In diesem Prozeß nun werden bestimmte menschliche Triebanlagen in das umgewandelt, was gemeinhin als die Charaktereigenschaften des Individuums bezeichnet werden. Am Beispiel der Analerotik kann dies verdeutlicht werden: Das ursprüngliche Interesse des jugendlichen an der Exkretionsfunktion, ihren Organen und Produkten wandelt sich im Laufe des Wachstums in Sparsamkeit, Ordnungsinn und Reinlichkeit um, welche an und für sich wertvoll und willkommen sind, sich aber zu auffälliger Dominanz steigern können und dann das ergeben, was man als Analcharakter bezeichnet. Die Triebsublimierung ist ein besonders hervorstechender Zug der Kulturentwicklung, welche ermöglicht, daß höhere psychische Tätigkeiten, wissenschaftliche, künstlerische und ideologische eine so bedeutsame Rolle im Kulturleben übernehmen. Kultur basiert auf dem Verzicht und der Nichtbefriedigung (Unterdrückung, Verdrängung) von Trieben. Diese „Kulturversagung“ dominiert das große Gebiet der sozialen Beziehungen der Menschen und ist Ursache der Feindseligkeit, gegen die jede Kultur zu kämpfen hat.
1.4. Liebe und Vergesellschaftung
Eros (Macht der Liebe) und Ananke (Zwang zur Arbeit) sind also die Gründungsbedingungen menschlicher Kultur. Die Erfahrung der geschlechtlichen Liebe gewährt den Menschen die stärksten Befriedigungserlebnisse. In der Kultur bleibt diese Liebe in ihrer ursprünglichen Form und in modifizierter Form der zielgehemmten Zärtlichkeit bestehen. Beiden, sowohl der vollsinnlichen als auch der zielgehemmten Liebe, kommt die Funktion zu, eine größere Anzahl von Menschen intensiver aneinander zu binden, als es dem Interesse der Arbeitsgemeinschaft gelang. Sie gehen über die Familie hinaus und stellen neue Bindungen zu bisher Fremden her. Die genitale Liebe führt zu neuen Familienbindungen, die zielgehemmte zu „Freundschaften“, welche kulturell wichtig werden, weil sie manchen Beschränkungen der genitalen entgehen (z.B. der Ausschließlichkeit). Allerdings verliert das Verhältnis der Liebe zur Kultur im Laufe der Entwicklung seine Eindeutigkeit. Einerseits widersetzt sich die Liebe den Interessen der Kultur, andererseits bedroht die Kultur die Liebe mit empfindlichen Einschränkungen. Dies manifestiert sich in z.B. im Konflikt zwischen Familie und Gemeinschaft. So unterstützt die Gesellschaft Jugendliche bei ihrem Ablösungsprozeß von der Familie oft mit bestimmten Pubertäts- und Aufnahmeriten[7]. Die Gesellschaft entzieht der Sexualität einen Großteil ihrer psychischen Energie und verbraucht diese für sich selbst. Hierbei werden Mechanismen der Unterdrückung von sexueller Entfaltung entwickelt: „was von der Ächtung frei bleibt, die heterosexuelle genitale Liebe, wird durch die Beschränkungen der Legitimität und der Einehe weiter beeinträchtigt. Die heutige Kultur gibt deutlich zu erkennen, daß sie sexuelle Beziehungen nur auf Grund einer einmaligen, unauflösbaren Bindung eines Mannes an ein Weib gestatten will, daß sie die Sexualität als selbständige Lustquelle nicht mag und sie nur als bisher unersetzte Quelle für die Vermehrung der Menschen zu dulden gesinnt ist“. (a.a.O.; 464).
1.5. Aggressionstrieb und Kultur
Die psychoanalytische Forschung konnte aufzeigen, daß die sexuellen Versagungen von den Neurotikern nicht ertragen werden und sie deshalb ihre Symptome, als Ersatzbefriedigungen, ausbilden. Als das geschieht aus der Motivation der Kultur heraus all ihre Mitglieder libidinös aneinander zu binden. Dabei bietet sie große Kräfte, in Form zielgehemmter Libido, auf, um die Gemeinschaftsbande durch Freunschaftsbeziehungen zu stärken, um starke Identifizierung unter ihren Mitgliedern herzustellen. Hierfür ist die Einschränkung des Sexuallebens unvermeidlich. Das gesellschaftliche Gebot der Nächstenliebe gegenüber dem Fremden ist ein Produkt dieses Mechanismus. Allerdings übersieht es den mächtigen Anteil an Aggressionsneigung innerhalb der Individuen. Der Andere ist dem Einzelnen nicht nur potentieller Helfer oder Sexualobjekt, sondern repräsentiert ebenso die Möglichkeit der Aggessionsbefriedigung, der Ausbeutung seiner Arbeitskraft und Sexualität, der Aneignung seiner Besitztümer oder aber als Opfer für seine sadistischen Strebungen. Der Mensch ist des Menschen Wolf, sobald die hemmenden seelischen Gegenkräfte wegfallen. „Infolge dieser primären Feindseligkeit der Menschen gegeneinander ist die Kultur-gesellschaft beständig vom Zerfall bedroht. Das Interesse der Arbeitsgemeinschaft würde sie nicht zusammenhalten, triebhafte Leidenschaften sind stärker als vernünftige Interessen. Die Kultur muß alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen, ihre Äußerungen durch psychischen Reaktionsbildung niederzuhalten. Daher also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizieren und zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen, daher die Einschränkung des Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, das sich wirklich dadurch rechtfertigt, daß nichts anderes der ursprünglichen menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft“. (ibid.; 471). Eine große Anzahl von Menschen läßt sich nur in Liebe aneinander binden, indem die Aggression auf andere verschoben wird. Dieser „Narzißmus der kleinen Differenzen“ stellt eine bequeme und relativ harmlose Befriedigung der Aggressionsneigung dar, durch welchen den Mitgliedern einer Gemeinschaft das Zusammenleben erleichtert wird. Wenn die Kultur sowohl der Sexualität als auch der Aggressionsneigung des Menschen so große Versagung auferlegt, so wird deutlich, warum der Mensch unglücklich in der Kultur ist. Der Urmensch kannte keine Triebeinschränkung, allerdings war seine Sicherheit, dieses Glück zu genießen, eine sehr geringe. Der Kulturmensch hingegen, hat für ein Stück Glücksmöglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht.
Lebenserhaltende Triebe, wie z.B. Hunger, können als Ichtriebe bezeichnet werden. Liebe hingegen strebt nach Objekten, ist ein libidinöser Trieb. Beide dienen der Erhaltung der Art und treten einander gegenüber. Die Neurose ist das Resultat dieses Antagonismus zwischen Selbstbewahrung und den Anforderungen der Libido, ein Kampf, bei dem das Ich gesiegt hatte, um den Preis schwerer Leiden und Entbehrungen. Der Sadismus steht in unmittelbarer Verwandtschaft mit Bemächtigungstrieben ohne libidinöse Absicht. Beim Narzißmus ist das Ich selbst mit Libido besetzt. Diese narzißtische Libido wendet sich den Objekten zu, wird so zur Objektlibido und kann sich in narzißtische Libido zurückverwandeln. Der Begriff Narzißmus macht es möglich, traumatische Neurosen und viele den Psychosen nahestehenden Affektionen analytisch zu erfassen.
Im Gegensatz zu dem lebenserhaltenden und vergesellschaftenden Prinzip, muß ein auflösendes, destruktives angenommen werden: der Todestrieb. Nur die Dialektik dieser beiden Pole erlaubt eine Erklärung der Phänomene des Lebens. Dieser Todestrieb wendet sich gegen die Außenwelt und manifestiert sich als Aggression oder Destruktion. Nach innen äußert er sich in fortlaufender Selbstzerstörung. Der als Partialtrieb der Sexualität bekannte Sadismus ist eine besondere Mischung aus Liebesstreben und Destruktionstrieb. Im Masochismus wird eine Verbindung der nach innen gerichteten Destruktivität mit der Sexualität beobachtbar. Im Destruktionstrieb erfüllt sich das Ich seine Allmachtswünsche verschafft sich die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse und die Herrschaft über die „Natur“.
Eros vergesellschaftet die Menschen, bindet sie libidinöse aneinander, erschafft Kultur. Der natürliche Aggressionstrieb widersetzt sich diesem Prozeß. Dieser Trieb ist der Hauptvertreter des Todestriebes und teilt sich mit dem Eros die Weltherrschaft. Daher kann die Kulturentwicklung als ein beständiger Kampf zwischen Eros und Tod, Lebens- und Destruktionstrieb angesehen werden. „Dieser Kampf ist der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt und darum ist die Kulturentwicklung kurzweg zu bezeichnen als der Lebenskampf der Menschenart“ (a.a.O.; 481).
1.6. Genese von „Über-Ich“ und Gewissen
Das effektivste Mittel der Aggressionshemmung, besteht in der Introjektion, Verinnerlichung der Aggression. Sie wird gegen das eigene Ich gewendet und von diesem zum Teil übernommen und zu einem Über-Ich zusammengefaßt, welches dem übrigen gegenüberstellt und fortan als Gewissen gegen das Ich dieselbe strenge Aggressionsbereitschaft ausübt, welche das Ich gerne an anderen, fremden Individuen befriedigt hätte. Als Schuldbewußtsein kann die Spannung zwischen dem strengen Über-Ich und dem ihm unterworfenen Ich bezeichnet werden, welches sich als Strafbedürfnis äußert. Die Kultur schwächt die Aggressionslust des Individuums, indem es eine innere Instanz schafft, welche diese überwacht. Ein genuin natürliches Unterscheidungsvermögen zwischen Gut und Böse muß abgelehnt werden. Vielmehr ist die Angst vor Liebesentzug eine soziale Angst vor der elterlichen Autorität. Erst durch die Aufrichtung eines Über-Ich vollzieht sich eine qualitative Änderung. Die Gewissensphänomene werden auf eine neue Stufe gehoben, im Grunde kann man erst jetzt von Gewissen und Schuldgefühl sprechen. Hinfällig wird die Differenz zwischen Böses tun und Böses wollen, da sich vor dem Über-Ich auch die Gedanken nicht verbergen können. Dabei verhält es sich um so rigider, je tugendhafter ein Mensch ist.
Das Schuldgefühl hat also zwei Ursachen: die Angst vor der (elterlichen) Autorität und später vor dem Über-Ich. Das erstere fordert auf den Verzicht auf Triebbefriedigung, das andere drängt, da man das Fortbestehen der verbotenen Wünsche vor dem Über-Ich nicht verbergen kann, zur Bestrafung. „Der Triebverzicht hat nun keine voll befreiende Wirkung mehr, die tugendhafte Enthaltung wird nicht mehr durch die Sicherung der Liebe gelohnt, für ein drohendes äußeres Unglück – Liebesverlust und Strafe von Seiten der äußeren Autorität – hat man ein andauerndes inneres Unglück, die Spannung des Schuldbewußtseins, eingetauscht.“ (ebd.; 487). Die Aggression des Gewissens konserviert die Aggression der Autorität. Aus psychoanalytischer Perspektive kann gesagt werden, daß das Gewissen die Folge des Triebverzichtes ist, bzw. daß der uns von außen auferlegte Triebverzicht das Gewissen schafft, welches dann weiteren Triebverzicht fordert. Bedeutsam für die Genese des Über-Ichs und Gewissens sind mitgebrachte konstitutionelle Faktoren und die Einflüsse des Milieus der realen Umgebung. Das Schuldgefühl der Menschheit entstammt dem Ödipuskomplex, welcher bei der Tötung des Vaters durch die Bruderhorde erworben wurde. Damals wurde eine Aggression nicht unterdrückt sondern ausgeführt, dieselbe Aggression, deren Unterdrückung beim Kind die Ursache des Schuldgefühls ist. Die Reue ist das Ergebnis der ursprünglichen Gefühlsambivalenz gegen den Vater. Nachdem der Haß durch die Aggression befriedigt war, kam in der Reue über die Tat die Liebe zum Vorschein. Durch die Identifizierung mit dem Vater wurde das Über-Ich errichtet, vergleichbar mit der späten Rache des getöteten Vaters, um eine Wiederholung der Tat zu verhindern. Da die Aggressions-neigung gegen den Vater sich auch in den folgenden Generationen wiederholte, blieb ebenfalls das Schuldgefühl bestehen.
Es wird deutlich, welche Rolle die Liebe bei der Entstehung des Gewissens und der verhängnisvollen Unvermeidlichkeit des Schuldgefühls spielt. Das Schuldgefühl ist Ausdruck des Ambivalenzkonflikts zwischen Eros und Destruktionstrieb. Solange die Gemeinschaft sich nur auf die Familie beschränkt, äußert er sich im Ödipuskomplex, der Konstitution des Gewissens und dem Schuldgefühl. Wird die Familiengrenze transzendiert, so werden die Formen dieser Konflikte fortgesetzt und das Schuldgefühl verstärkt. „Da die Kultur einem inneren erotischen Antrieb gehorcht, der sie die Menschen zu einer innig verbundenen Masse vereinigen heißt, kann sie dies Ziel nur auf dem Wege einer immer wachsenden Verstärkung des Schuldgefühls erreichen. Was am Vater begonnen wurde, vollendet sich an der Masse. Ist die Kultur der notwendige Entwicklungsgag von der Familie zur Menschheit, so ist unablösbar mit ihr verbunden, als Folge des mitgeborenen Ambivalenzkonflikts, als Folge des ewigen Haders zwischen Liebe und Todesstreben, die Steigerung des Schuldgefühls vielleicht bis zu Höhen, die der Einzelne schwer erträglich findet“. (a.a.O.; 493).
1.7. Das Unbehagen unter dem „Kultur-Über-Ich“
Das Schuldgefühl ist im Grund nichts anderes als eine topische Abart der Angst, welche in seinen späteren Phasen mit der Angst vor dem Über-Ich zusammenfällt. Dieses wird nicht als ein solches empfunden, sondern bleibt zum größten Teil unbewußt oder äußert sich als ein Unbehagen, eine Unzufriedenheit, für welche man andere Motivierungen sucht. Lediglich die Religionen haben nie die Rolle des Schuldgefühls in der Kultur verkannt. Ihr Anspruch war der, die Menschheit von diesem Schuldgefühl, das sie Sünde nannten, zu erlösen. Anschaulich wird dies in der Art, wie im Christentum die Erlösung gewonnen wird: durch den Opfertod eines Einzelnen, der damit eine allen gemeinsame Schuld auf sich nimmt. „Das Über-Ich ist eine von uns erschlossene Instanz, das Gewissen eine Funktion, die wir ihm neben anderen zuschreiben, die die Handlungen und Absichten des Ichs zu überwachen und zu beurteilen hat, eine zensorische Tätigkeit ausübt. Das Schuldgefühl, die Härte des Über-Ichs, ist also dasselbe wie die Strenge des Gewissens, ist die dem Ich zugeteilte Wahrnehmung, daß es in solcher Weise überwacht wird, die Abschätzung der Spannung zwischen seinen Strebungen und den Forderungen des Über-Ichs, und die der ganzen Beziehung zugrunde liegende Angst vor dieser kritischen Instanz, das Strafbedürfnis, ist eine Triebäußerung des Ichs, das unter dem Einflusses sadistischen Über-Ichs masochistisch geworden ist, d.h. ein Stück des in ihm vorhandenen Triebes zur inneren Destruktion, zu einer erotischen Bindung an das Über-Ich verwendet. Vom Gewissen sollte man nicht eher sprechen, als bis ein Über-Ich nachweisbar ist; vom Schuld-bewußtsein muß man zugeben, daß es früher besteht als das Über-Ich, also auch als das Gewissen. Es ist dann der unmittelbare Ausdruck der Angst vor der äußeren Autorität, die Anerkennung der Spannung zwischen dem Ich und dieser letzteren, der direkte Abkömmling des Konflikts zwischen dem Bedürfnis nach deren Liebe und dem Drang nach Triebbefriedigung, dessen Hemmung die Neigung zur Aggression erzeugt. Die Übereinanderlagerung dieser beiden Schichten des Schuld-gefühls - aus Angst vor der äußeren und vor der inneren Autorität – hat uns machen Einblick in die Beziehungen des Gewissens erschwert. Reue ist eine Gesamtbezeichnung für die Reaktion des Ichs in einem Falles des Schuldgefühls, enthält das wenig umgewandelte Empfindungsmaterial der dahinter wirksamen Angst, ist selbst eine Strafe und kann das Strafbedürfnis einschließen; auch sie kann also älter sein als das Gewissen“. (ibid.; 496).
Wenn Triebstrebungen der Verdrängung unterliegen, so werden ihre libidinösen Anteile in Symptome, ihre aggressiven Komponenten in Schuldgefühle umgesetzt. Die individuelle Entwicklung ist das Produkt der Interferenz zweier Strebungen, die nach individuellem Glück (Egoismus) und die nach menschlichem Anschluß (altruistisch, kulturell), welche sich gegenseitig den Boden streitig machen.
In Analogie zur individuellen Entwicklung bildet auch die Gemeinschaft eine Art Über-Ich aus, unter dessen Einfluß sich die Kulturentwicklung vollzieht. Es hat einen ähnlichen Ursprung wie das des Einzelmenschen: es ruht auf dem Eindruck, den große Führerpersönlichkeiten hinterlassen haben. Das „Kultur-Über-Ich“ stellt ebenfalls rigide Idealforderungen auf, deren Nichtbefolgung durch „Gewis-sensangst“ bestraft wird. Die Ethik kann als ein Versuch angesehen werden, durch ein Gebot des Über-Ich zu erreichen, was bisher durch sonstige Kulturarbeit nicht erreicht werden konnte.
Das Über-Ich des Einzelnen kümmert sich in der Strenge seiner Gebote und Verbote zu wenig um das Glück des Ichs, da es den Widerständen gegen ihre Befolgung, der Triebstärke des Es und den Schwierigkeiten der realen Umwelt nicht ausreichend Rechnung trägt. Ebenso wird die seelische Konstitution des Menschen nicht berücksichtigt, ob es dem Menschen überhaupt möglich ist, daß Gebot zu befolgen. Dem Ich wird vielmehr die absolute Herrschaft über das Es eingeräumt. „Das Gebot >>Liebe dienen Nächsten wie dich selbst<< ist die stärkste Abwehr der menschlichen Aggression und ein ausgezeichnetes Beispiel für das unpsychologische Vorgehen des Kultur-Über-Ichs. Das Gebot ist undurchführbar; eine so großartige Inflation der Liebe kann nur deren Wert herabsetzen, nicht die Not beseitigen“. (a.a.O.; 503). Die Schicksalsfrage der Menschheit ist davon abhängig, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusam-menlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstriebes Herr zu werden.
2. Grenzen der Aufklärung
2.1. Das Verhältnis der Juden zur bestehenden Ordnung
Nach Horkheimer und Adorno ist der Antisemitismus, die Idiosynkrasie des jüdischen Volkes und Glaubens durch die Faschisten, sowie der damit einhergehende Vernichtungswille, das Produkt der falschen gesellschaftlichen Ordnung. Im Faschismus verkörpern die Juden nicht bloß eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches, von deren Vernichtung das Schicksal der Menschheit, insbesondere das des eigenen Volkes abhängt. Die Juden werden als das absolute Objekt der Herrschaft definiert, mit dem nur noch verfahren werden soll. Dadurch werden sie tatsächlich zum auserwählten Volk im negativen Sinne. In dem, von den Antisemiten konstruierten Klischee des „ewigen Juden“ (Ahasver: der ewig herumirrende Jude), reproduziert sich ihr eigenes Wesen; die skrupellose Gier nach Besitz, Aneignung und grenzenloser Macht, welche sie als die eigentlichen geheimen Herrscher erscheinen läßt. “Den Juden, mit dieser ihrer Schuld beladen, als Herrscher verhöhnt, schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können“[8]. Die dieser Doktrin entgegengesetzte liberale Sicht, sieht die Einheit der Menschen als prinzipiell verwirklicht an und hilft dadurch das Bestehende zu rechtfertigen. Die Apologie erfolgt durch die Annahme, daß die Juden lediglich aufgrund ihrer kulturell-religiösen Tradition eine Gemeinschaft bilden und somit frei von nationalen oder Rassenmerkmalen sind. Jüdische Merkmale beziehen sich lediglich auf die nicht assimilierten Ostjuden. Dieser These liegt das durchaus positive Ideal einer Gesellschaft zugrunde, in welcher sich Haß und Gewalt nicht länger reproduzieren und Objekte suchen, an denen sie sich betätigen können.
Die Existenz der Juden erregt bei der bestehenden Allgemeinheit Anstoß durch deren mangelnde Anpassung. Aufgrund ihres konservativ-orthodoxen Festhaltens an eigenen Traditionen und Ordnungen des Lebens, war das Verhältnis der Juden zu den Herrschenden immer geprägt von Gier und Furcht. Sie wurden immer beherrscht und waren abhängig von der Willkür oder der Güte der Mächtigen. Zu Erfolg kamen nur jene, die ihre Identität leugneten, die Differenzen zur herrschenden Ordnung aufgaben und den Charakter übernahmen, den die Gesellschaft bis heute den Menschen aufzwingt. Im Wesen der Assimilierten wurde die Dialektik von Aufklärung und Herrschaft, das Doppelverhältnis des Fortschritts zu Grausamkeit und Befreiung, besonders evident. Durch die Anpassung überwanden die Arrivierten die Beherrschung durch andere und konnten in das neuzeitliche Bürgertum aufsteigen, welches allerdings im Begriff war sich regressiv auf das völkische, die Rasse als deren Konstituens, zurück zu besinnen. Rasse bedeutet nicht unmittelbar das naturhaft partikulare, sie ist vielmehr die Reduktion auf das Naturhafte, auf bloße Gewalt, die Besonderheit, die im Bestehenden gerade das Allgemeine ist. Sie ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums im Kollektiv. Die liberale Idee der „Harmonie der Gesellschaft“, zu der sich die angepaßten Juden bekannten, mußten sie als die der Volksgemeinschaft gegen sie selbst erfahren.
Der Antisemitismus entstellt nicht die Ordnung, sie bedarf seiner, wie der Verfolgung überhaupt, deren Wesen die Gewalt ist.
2.2. Antisemitismus als Ideologie eines „dynamischen Idealismus“
Der Vorteil des Antisemitismus als Volksbewegung liegt in der Ideologie; diejenigen, die ihn ausüben, vergessen ihre ökonomische Vergeblichkeit und Nichtigkeit dadurch, daß die Unterdrückten ihnen gleichgestellt werden und somit auch nicht mehr besitzen als sie. Er hilft nicht den Menschen, sondern ihrem Vernichtungsdrang; der Gewinn liegt in der Sanktionierung durch das Kollektiv. Seine Zweck-mäßigkeit für die Herrschenden liegt in der Ablenkung und seiner Funktion als Korruptionsmittel und terroristischem Exempel. Propagiert wird er von den Mächtigen, ausgeübt von den Ohnmächtigen, den der Subjektivität beraubten Subjekte, dem Volk. Rational, ökonomisch oder politisch können antisemitische Verhaltensweisen nicht erklärt werden, da die mit Herrschaft verknüpfte Rationalität ihrerseits Schuld daran trägt. „Der Antisemitismus ist ein eingeschliffenes Schema, ja ein Ritual der Zivilisation, und die Progrome sind die wahren Ritualmorde. In ihnen wird die Ohnmacht dessen demonstriert, was ihnen Einhalt gebieten könnte, der Besinnung, des Bedeutens, schließlich der Wahrheit.“ (Cf. Horkheimer u. Adorno; op. cit.; S. 153). Aufgrund seiner Intentionslosigkeit ist der Antisemitismus ein Ventil der Ohnmacht; Opfer, wie auch die Täter - sobald sie sich als Norm fühlen - sind untereinander beliebig auswechselbar, je nach der Konstellation können es Vagabunden, Juden, Katholiken oder Protestanten sein. Es gibt keinen genuinen Antisemitismus und keine geborenen Antisemiten, vielmehr ist ein „ dynamischer Idealismus “ verantwortlich für die Ideologisierung der Rettung der Familie, des Vaterlandes und der Menschheit. Die Gefolgschaft der Apologeten, die weder ökonomisch noch sexuell auf ihre Kosten kommt, hat den Haß internalisiert ohne zu wissen warum; sie wollen keine Entspannung, da sie keine Erfüllung kennen. Dadurch, daß der Judenhasser den Betrug an sich bemerkt, wird die Rationalisierung des Motivs, wider Willen, zu einem vermeintlich echten. Die Tat wird schließlich zum autonomen Selbstzweck, der die eigene Zweck-losigkeit überdeckt; die Verzweifelten sehen sich als die einzigen Verteidiger der Wahrheit, als Erneuerer der Erde, die auch den letzten Winkel noch reformieren müssen. „Zwischen Antisemitismus und Totalität bestand von Anbeginn der innigste Zusammenhang. Blindheit erfaßt alles, weil sie nichts begreift.“ (Siehe Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S.154).
Der Liberalismus versprach den Menschen Glück, auch dort wo keine Macht ist und gewährte den Juden Besitz ohne Befehlsgewalt. Doch die Massen fühlten sich betrogen, da dieses allgemeine Versprechen eine Farce bleibt solange soziale Klassen existent sind. Durch die prinzipielle Versagung muß die Unterdrückung der Verwirklichung dieser Idee, welche die eigene Sehnsucht reflektiert, ständig wiederholt werden. Der Haß und die Zerstörungslust der Zivilisierten, die den schmerzhaften Zivilisationsprozeß nie ganz vollziehen konnten, richtet sich gegen das Fremde, den Juden. Der Gedanke an Glück ohne Macht erscheint dem Einzelnen unerträglich, da diese Verbindung erst Glück bedeuten würde. Das Konstrukt einer Verschwörung lüsterner jüdischer Bankiers, die den Bolsche-wismus finanzieren, ist bezeichnend für die eingeborenen Ohnmacht. Das gute Leben ist ein Zeichen von Glück, wie es dem Intellektuellen möglich ist, der das Privileg hat sich Gedanken zu machen und nicht durch Mühsal und Körperkraft Schweiß vergießen muß um sich zu ernähren. „Der Bankier wie der Intellektuelle, Geld und Geist, die Exponenten der Zirkulation, sind das verleugnete Wunschbild der durch Herrschaft Verstümmelten, dessen sich die Herrschaft zu ihrer eigenen Verewigung bedient.“ (Zit. n. Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S.155).
2.3. Die sozio-ökonomischen Ursachen des Antisemitismus
Der bürgerliche Antisemitismus besitzt eine spezifisch ökonomische Ursache; die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise. Mit dem Übergang des Feudalismus in den Merkantilismus, jener Frühform des Kapitalismus, vollzog sich auch ein Wechsel im Ansehen der bis dato geringgeschätzten Arbeit („Arbeit schändet nicht“). Produktion wurde hoffähig und aus den absoluten Monarchen und Fürsten wurden Manufakturherren und Fabrikanten, deren Handeln geleitet war von rationaler Kalkulation, Disposition, Kauf und Verkauf von Waren. Durch ihr Monopol über die Produktions-mittel, waren jene Produzenten in der (Macht-) Position die expropriierte, formell freie Lohnarbeiter-schaft - welche der einzig Mehrwert schaffende Faktor in der kapitalistischen Produktionsweise ist - auszubeuten und den Mehrwert zu appropriieren. Die vermeintlich produktive Arbeit der Kapitalisten bildete jene Ideologie, welche den Bezug ihres Gehaltes rechtfertigte, sowie das Wesen des Arbeitsvertrags, und die Natur dieses Wirtschaftssystems überdeckte. In dieser Gesellschaft ist die Politik nicht mehr ein Geschäft, sondern das Geschäft die ganze Politik, indem den Juden das ganze ökonomische Unrecht der Klassen aufgebürdet wird. Ihnen war seit jeher der Zugang zum Ursprung des Mehrwertes verwehrt geblieben, so daß sie notwendigerweise in den Handel- und Finanzbereich, die Zirkulationssphäre, ausweichen mußten.
Durch die Exploitation erkannten die Proletarier, deren Entlohnung auf Grundlage des kulturellen Minimums stattfand, wie wenig Güter auf dem Markt auf sie entfielen und vor allem welche Güter sie sich nicht leisten konnten. Im Verhältnis des Lohns zu den Preisen drückt sich erst aus, was den Arbeitern vorenthalten wird und was sie unfreiwillig mit dem Prinzip der Entlohnung angenommen haben. Den jüdischen Kaufmännern und Händlern wurde nun die Schuld des ganzen Systems zugeschrieben; sie werden als die Materialisten, Schacherer und Wucherer diffamiert. „Die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein“. (Horkheimer u. Adorno; ebd.; S.156).
Brachten es Juden zu hohen Positionen in Industrie und Verwaltung, dann nur über das Opfer der Taufe - der Selbstverleugnung und der stillschweigenden Übernahme der allgemeinen Meinung über die Juden -, sowie doppelter Ergebenheit und doppeltem Fleiß. Durch die Geschichte hindurch wurden die Juden niemals in die Völker Europas integriert. Sie befanden sich stets, als Schutzjuden, in einem Abhängigkeitsverhältnis, als Objekt der Gnade, den Monarchen und dem absoluten Staat ausgeliefert. Die Mächtigen taten dies nur solange sie einen Nutzen daraus ziehen konnten, auch wenn die Juden auf ihren Bürgerrechten und ihrem Individualismus bestanden. Gerade weil sie die kapitalistische Existenzform und die römische Zivilisation in Europa verbreiten halfen, sie im Einklang mit ihrer patriarchalen Religion die Vertreter städtischer, bürgerlicher und schließlich industrieller Verhältnisse waren, so zogen sie den Haß derer auf sich, die darunter zu leiden hatten. „Seinen ausschließenden, partikularen Charakter erfahren sie nun an sich selbst.“ (Horkheimer u. Adorno; op. cit.; S.157).
2.4. Die religiösen Motive des Antisemitismus
Die Behauptung, daß der völkische Antisemitismus frei von religiösen Motiven sei („es geht nur um die Reinheit des Volkes und der Nation“), ist eine Rationalisierung und verleugnet seine ihm immanente religiöse Tradition. „Das Bündnis von Aufklärung und Herrschaft hat dem Moment ihrer Wahrheit den Zugang zum Bewußtsein abgeschnitten und ihre verdinglichten Formen konserviert.“ (Cf. Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S.158). Der fanatische Glaube, die unbeherrschte Sehnsucht (nach Erlösung), ist die inhaltlich abgeänderte Form des religiösen Fundamentalismus, die als völkische Rebellion kanalisiert wird. Bei den deutschen Christen blieb von der Religion der Liebe nur der Antisemitismus, der Haß gegen jene, welche den Glauben nicht teilen, übrig.
Der jüdische Gott, der als Schöpfer und Beherrscher die Natur vollends unterwirft, geht aus der Gestalt eines Naturdämons in den Zustand des absoluten Selbst über. Die in dieser Entfremdung begründete, unbeschreibliche Macht und Herrlichkeit, die Erhöhung auf eine universale, transzendentale Ebene - welche nur durch den Gedanken erreicht werden kann -, läßt ihn als den Geist, das andere Prinzip erscheinen, der das Individuum aus dem Naturkreislauf befreien kann (im Gegensatz zu den mythischen Göttern). In seiner Abstraktheit und Metaphysik potenziert sich zugleich der Schrecken von der unmeßbaren Gnadenlosigkeit, was Ausdruck findet in Verstrickung von Schuld und Verdienst; es gibt kein Heilsversprechen. Der vorchristlich-jüdische Glaube war kongruent mit der allgemeinen Selbsterhaltung. Der heidnische Opferritus, welcher eine wichtige Funktion für die theokratische Herrschaftspraxis hatte, vollzog eine Entwicklung von der unmittelbaren Furcht-befreiung zur geheiligten Tradition des familiären und staatlichen Lebens. Im Christentum sublimierte er hingegen in die rationale Regelung des Arbeitsprozesses. Durch den menschlichen (Opfer-) Tod Jesu, dem göttlichen Mittler, wird das Moment der Gnade hervorgehoben; der Schrecken vor dem Absoluten wird durch das Wiederfinden des Einzelnen in der Gottheit gemildert. Es ist die menschliche Selbstreflexion im Absoluten, die Vermenschlichung Gottes. Durch dieses reflektive Moment wird der Fortschritt gegenüber dem Judentum begründet. Da das Absolute dem Endlichen angenähert wird, wird das Endliche verabsolutiert. Es wird als das geistige Wesen deklariert, was sich vor dem Geist als natürliches Wesen erweist. In der Entfaltung des Widerspruchs gegen diese Anmaßung besteht der Geist. Das Christentum wird durch die gedankliche Bindung ans gedanklich Suspekte zur Religion. Das der Profanität überlassene, entwertete Dasein (d. Individuums) bekommt das Postulat der Überwindung der Selbsterhaltung, durch Nachahmung Christi, aufoktroyiert. Diese affirmative Sinngebung des Selbstvergessens ist insofern trügerisch, als das der (katholische oder protestantische) Erlösungsweg doch nicht das Ziel garantieren kann (e. g. die calvinistische Prädestinationslehre). Die Unverbindlichkeit des geistlichen Heilsversprechens ist das jüdische und negative Element in der christlichen Doktrin, was von den Gläubigen verdrängt wird. Die Ahnung dieser Verdrängung kann ihrerseits nur dadurch verdrängt werden, indem sich die Christen ihr ewiges Heil am weltlichen Unheil derer bestätigen, die dieses Opfer der Vernunft nicht vollbrachten. Darin liegt der religiöse Ursprung des Antisemitismus. Die Anhänger der Vaterreligion werden von den eigenen Söhnen gehaßt, welche denken, daß sie es besser wüßten. „Das Ärgernis für die christlichen Judenfeinde ist die Wahrheit, die dem Unheil standhält, ohne es zu rationalisieren und die Idee der unverdienten Seligkeit gegen Weltlauf und Heilsordnung festhält, die sie angeblich bewirken sollen. Der Antisemitismus soll bestätigen, daß das Ritual von Glaube und Geschichte recht hat, indem er es an jenen vollstreckt, die solches Recht verneinen.“ (Vgl. Horkheimer u. Adorno; ed. cit.; S.161).
2.5. Die Ursachen der Idiosynkrasie als Konstituens des Antisemitismus
Der Antisemitismus beruft sich auf die Idiosynkrasie des Besonderen, des Nonkonformen, was nicht dem gesellschaftlichen Fortschritt entspricht. Die Norm ist das Allgemeine, das sich in die Zweckzusammenhänge der Gesellschaft einfügt. Diese Aversion und Hypersensibilität gegenüber dem Fremden, von deren Überwindung die Emanzipation der Gesellschaft vom Antisemitismus abhängt, sind Rudimente der biologischen Urgeschichte, archaische Schemata der Selbsterhaltung. Es sind biologische Reaktionen, denen eine autonome Dynamik immanent ist; in ihnen vollzieht sich die Angleichung an die unbewegte Natur. „Indem aber das Bewegte dem Unbewegten, das entfaltetere Leben bloßer Natur sich nähert, entfremdet es sich ihr zugleich (...).“ (Cf. Horkheimer/Adorno; a.a.O.; S. 161).
Im Laufe der Zivilisation wurde das eigentlich mimetische (nachahmende) Verhalten, das organische Anschmiegen an das Andere - in der magischen, prähistorischen Phase - durch die organisierte Handhabung der Mimesis und in der historischen Epoche durch die rationale Praxis, die Arbeit, ersetzt. In der Verhinderung eines Rückfalls in mimetische Daseinsweisen liegt die Bedingung der Zivilisation. Durch soziale und individuelle Erziehung werden die Menschen in ihrer objektivierenden Verhaltensweise von Arbeitenden und somit vor einer Regression, einer Angleichung an die Natur, bewahrt. In der Konstitution des Ichs manifestiert sich der Übergang von reflektorischer Mimesis zu beherrschter Reflexion. „Anstelle der leiblichen Angleichung an Natur tritt die >>Rekognition im Begriff<<, die Befassung des Verschiedenen unter Gleiches.“ (Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S. 162). Gleichheit entsteht unter der Bedingung der Angleichung ans Ding im blinden Vollzug des Lebens, oder der Vergleichung des Verdinglichten in der wissenschaftlichen Begriffsbildung. Dadurch entsteht der Zwang zur gesellschaftlichen Herrschaft über die Natur, der sich in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung reproduziert. Wissenschaft und Technik bewerkstelligen dies durch in Stereotypen aufbewahrte Regelmäßigkeiten bzw. Wiederholungen und die Automatisierung der Prozesse; durch ihre Umwandlung von geistigen in blinde Prozesse.
Dem, in der bürgerlich-rationalisierten Produktionsweise zivilisatorisch geblendeten, Individuum begegnen die eigenen verdrängten und tabuisierten mimetischen Verhaltensweisen, in Gestalt rudimetärer Züge, bei anderen oder Fremden wieder und begründet dadurch seine Aversion derselben. Diese undisziplinierte Mimik kommt in den obsolet erscheinenden, verdinglichten menschlichen Beziehungen zum Vorschein, deren Attribute Drohen, Flehen oder Schmeicheln sind und in denen sich persönliche Machtverhältnisse reflektieren. Die bloße Existenz des Anderen ist das Ärgernis. Die Idiosynkrasie, welche der Antisemitismus als Motiv vorgibt, richtet sich gegen die Unfähigkeit der Beherrschung des eigene mimetischen Impulses. Der eigentliche Sinn des faschistischen Formelwesens - der rituellen Disziplin, der Uniformen und der gesamten Apparatur - ist es mimetisches Verhalten (z.B. die Imitation des Jüdischen) zu ermöglichen, ohne offenkundig das Realitätsprinzip zu verletzen. Die Nase des Juden ist das principium individuationis, das dem Einzelnen den besonderen Charakter ins Gesicht schreibt. Im Geruch vollzieht sich die Einheit von Wahrnehmung als auch des Wahrgenommenen und zeugt von dem Drang sich ans Andere zu verlieren. In der Zivilisation gilt Geruch als Schmach, als Zeichen niederer sozialer Schichten, minderer Rassen und unedler Tiere, deren Hingabe es dem Zivilisierten nur erlaubt ist, insoweit es rationalisiert wird; d.h. solange außer Frage steht, daß es der Ausrottung dieses Triebes gilt. „Indem der Zivilisierte die versagte Regung durch seine unbedingte Identifikation mit der zu versagenden Instanz desinfiziert, wird sie durchlassen. Wenn sie die Schwelle passiert, stellt Lachen sich ein. Das ist das Schema der antisemitischen Reaktionsweise.“ (Horkheimer u. Adorno; ebd.; S. 165).
Um den Augenblick der autoritären Freigabe des Verbotenen zu zelebrieren, versammeln sich die Antisemiten; der Antisemitismus allein macht sie zum Kollektiv und konstituiert die Gemeinschaft der Art- und Volksgenossen. Alle konterrevolutionären Symbole sind die Nachahmung magischer Praktiken, die Mimesis der Mimesis. Der Totalitarismus des Faschismus liegt darin begründet, daß er die Rebellion der unterdrückten Natur und somit die der Triebe unmittelbar für die Herrschaft zunutze macht. Dafür bedarf es des Juden, um den Differenzen und dadurch der eigenen „Menschlichkeit und Gleichheit“ gewahr zu werden. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Juden als Individuen tatsächlich jene mimetischen Züge tragen, oder ob sie ihnen lediglich unterstellt werden. Auf diese Weise werden die tabuisierten, die der Arbeit in ihrer herrschenden Ordnung zuwiderlaufenden Regungen in konformierende Idiosynkrasien umgesetzt. Durch die Projektion unterschwelliger Gelüste auf die Juden - denen der Vorwurf der mimetischen Opferpraxis, des blutigen Rituals gemacht wird -, werden die eigenen Handlungen als rationales Interesse rehabilitiert und rationalisiert. Es kann vollstreckt werden, was projiziert wird. Meist übertrifft die Vollstreckung des Bösen noch den bösen Inhalt der Projektion. „Die völkischen Phantasien jüdischer Verbrechen, der Kindermorde und sadistischen Exzesse, der Volksvergiftung und internationalen Verschwörung definieren genau den antisemitischen Wunschtraum und bleiben hinter seiner Verwirklichung zurück.“ (Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S. 166f.). An dem Sieg der Gesellschaft über die Natur, dem Aufstieg der Zivilisation, waren die Juden maßgeblich mit beteiligt, sowohl durch Aufklärung als auch Zynismus. Ihnen, als dem ältesten überlebenden Patriachat, der Inkarnation des Monotheismus, ist gelungen, worum sich das Christentum vergebens bemühte; die Umwandlung der Tabus in zivilisatorische Maximen, die Entmächtigung der Magie durch ihre eigene Kraft. Die mimetische Angleichung an die Natur wird durch die Pflichten des Rituals aufgehoben, ohne durch das Symbol in die Mythologie zu verfallen. Von den Antisemiten, den Vollstreckern des alten Testamentes, welche vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, werden sie dessen beschuldigt, was sie als erste überwunden hatten; die Verführbarkeit durch das Untere, des Dranges zu Tier und Erde, sowie der Idolatrie durch das Ritual und den Begriff des Koscheren.
2.6. Die pathische Projektion und paranoische Reaktionsform
Der Antisemitismus beruht auf falscher Projektion. Geschlechtliche Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht zugelassen bzw. verdrängt werden, werden dem Objekt, dem prospektiven Opfer, zugeschrieben. Der Faschismus politisiert dieses Verhalten; das Objekt der Krankheit wird realitäts-gerecht bestimmt, das Wahnsystem zur vernünftigen Norm erhoben und Abweichungen zur Neurose gemacht. Der als Feind Auserwählte wird schon als solcher wahrgenommen. Die Störung liegt in der mangelnden Differenzierung des Subjektes zwischen dem eigenen und fremden Anteil an der Projektion. Der zugrundeliegende Mechanismus der Projektion von Sinneseindrücken ist so alt wie die Zivilisation und diente dem ursprünglichen Zweck von Schutz und Fraß. In gewisser Weise ist jede Wahrnehmung Projektion. Im Menschen wurde die Projektion automatisiert und wie andere Schutz- und Angriffsleistungen in Reflexe umgewandelt. Es fand eine Sublimation oder Vergeistigung zu den wissenschaftlichen Methoden der Naturbeherrschung statt. Analog der kantischen Erkenntniskritik bedeutet dies, daß das Universum, das System der Dinge, von dem die Wissenschaft lediglich den abstrakten Begriff bildet, das anthropologisch unbewußte Erzeugnis jener selbsttätigen Projektion ist. Mit der Herausbildung des Individuums, im Rahmen des Vergesellschaftungsprozesses, differenziert sich das affektive vom intellektuellen Leben; der Einzelne muß lernen seine Projektion zu kontrollieren. „Indem er unter ökonomischen Zwang zwischen fremden und eigenen Gedanken und Gefühlen unterscheiden lernt, entsteht der Unterschied von außen und innen, die Möglichkeit von Distanzierung und Identifikation, das Selbstbewußtsein und das Gewissen.“ (Vgl. Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S. 168).
- Wie vollzieht sich die Entartung der kontrollierten zur falschen Projektion, die zum Wesen des Antisemitismus gehört?
Die physiologische, naiv-realistische, Lehre von der Wahrnehmung gilt seit dem Kantianismus als obsoleter Zirkelschluß. Die allgemein anerkannte Position des repräsentativen (indirekten) Realismus erklärt die subjektive Wahrnehmung als ein Produkt des Gehirns: Durch die gelenkte Projektion der Sinnesdaten und der Anordnung der perzipierten Eindrücke und punktuellen Indizes durch den Verstand, kommt es zu einem induktiven Analogieschluß, einem Urteilsschluß (Assoziation) über die Existenz eines physischen Phänomens bzw. der Externalität selbst. Dies geschieht auf der Grundlage der unmittelbaren Evidenz des Bewußtseinsereignisses von Sinnesdaten. Diese Hypothesen, über das mögliche Erscheinungsbild der Außenwelt, erlauben uns in den alltäglichen Aktionen und Reaktionen zu bestehen. Nach Schopenhauer und Helmholtz besteht eine verschränkte Beziehung von Subjekt und Objekt; das Wahrnehmungsbild enthält tatsächlich Begriffe und Urteile. Weil zwischen dem wahr-haften Objekt und dem unbezweifelbaren Sinnesdatum[9] ein Abgrund besteht, da nur ein kleiner Ausschnitt aus der Mannigfaltigkeit von Vorgängen in der Externalität erfahren werden kann, muß das Subjekt diesen auf eigene Gefahr überbrücken[10]. Um den Gegenstand zu reflektieren wie er ist, muß das Subjekt die Einheit des Dinges in seinen mannigfaltigen Eigenschaften und Zuständen erneut - durch Erinnerung - erschaffen[11]. Durch die synthetische Einheit von äußeren und inneren Eindrücken konstituiert sich rückwirkend das Ich. Das identische Ich ist das späteste konstante Projektionsprodukt. Es hat sich als einheitliche und zugleich exzentrische Funktion in einem Prozeß entfaltet, der sich historisch erst mit den sich entfaltenden Kräften der menschlichen physiologischen Konstitution vollziehen konnte. „Auch als selbständig objektiviertes freilich ist es nur, was ihm die Objektwelt ist. (...). Nur in der Vermittlung, in der das nichtige Sinnesdatum den Gedanken zur ganzen Produktivität bringt, deren er fähig ist, und andererseits der Gedanke vorbehaltlos dem übermächtigen Eindruck sich hingibt, wird die kranke Einsamkeit überwunden, in der die ganze Natur befangen ist.“ (Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S.169). Nicht in der vorbegrifflichen Einheit von Wahrnehmung und Gegenstand, sondern in ihrem reflektierten Antagonismus besteht die Möglichkeit zur Aussöhnung. Die Differenzierung vollzieht sich im Subjekt, das die Außenwelt im eigenen Bewußtsein hat und gleichzeitig als anderes erkennt. Daher vollzieht sich jenes Reflektieren, das Leben der Vernunft, als bewußte Projektion.
Das pathologische am Antisemitismus ist nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin: da das Subjekt nicht mehr den Gegenstand reflektiert, reflektiert es nicht mehr auf sich selbst und verliert dadurch die Fähigkeit zur Differenz. Das Mittel der Herrschaft - auch der absoluten - wird in der hemmungslosen Projektion zum eigenen und zugleich fremden Zweck, zum Zweck überhaupt erhoben. Mit der regressiv feindseligen Ausrichtung dieses Projektions-mechanismus gegen Menschen, tritt das kranke Individuum dem anderen im Größen- oder Verfolgungswahn gegenüber. Bei beiden Möglichkeiten steht das Subjekt im Zentrum einer Welt, die zum ohnmächtigen oder allmächtigen Inbegriff des auf sie Projizierten wird. Der Paranoiker perzipiert die Außenwelt nur wie es seinen Zwecken entspricht; sie ist lediglich Gelegenheit für seinen Wahn, die Wiederholung seines zur abstrakten Sucht entäußerten Selbst.
Die Menschen unterwerfen sich dem Faschismus, da er sie nicht als Subjekte ansieht, sondern monadologisch degradiert. Weil dem Blick des Irren die Reflexion fehlt, fühlen sich die Reflexions-losen davon angezogen. „Das zwangshaft projizierende Selbst kann nichts projizieren als das eigene Unglück, von dessen ihm selbst einwohnendem Grund es doch in seiner Reflexionslosigkeit abgeschnitten ist. Daher sind die Produkte der falschen Projektion, die stereotypen Schemata des Gedankens und der Realität, solche des Unheils.“ (Cf. Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S.172).
Entsprechend der psychoanalytischen Theorie projiziert das Ich, unter dem starken Druck eines rigiden Über-Ichs, die vom Es ausgehenden - aufgrund ihrer Stärke dem Individuum selbst gefährlichen - Aggressionsgelüste als böse Intentionen in die Außenwelt. Da die in Aggressionen transformierten Triebe meist homosexueller Natur sind, werden diese vom Subjekt als der Feind in der Welt erfahren, was ihm einen besseren Umgang damit ermöglicht.[12] „Aus Angst vor der Kastration wurde der Gehorsam gegen den Vater bis zu deren Vorwegnahme in der Angleichung des bewußten Gefühlslebens ans kleine Mädchen getrieben und der Vaterhaß als ewige Ranküne verdrängt. In der Paranoia treibt dieser Haß zur Kastrationslust als allgemeinem Zerstörungsdrang. Der Erkrankte regrediert auf die archaische Ungeschiedenheit von Liebe und Überwältigung. Ihm kommt es auf psychische Nähe, Beschlagnahmen, schließlich auf die Beziehung um jeden Preis an. Da er sich die Begierde nicht zugestehen darf, rückt er dem anderen als Eifersüchtiger oder Verfolger auf den Leib (...).“ (Vgl. Horkheimer u. Adorno; op. cit.; S.172). Dabei sind die Objekte der Fixierung, wie die Vaterfigur in der Kindheit, substituierbar.
Jede Wahrnehmung enthält unbewußt begriffliche und jedes Urteil phänomenalistische Elemente. Da zur Wahrheit Einbildungskraft gehört, kann es dem daran mangelnden Paranoiker passieren, daß er die Wahrheit für Illusion und die Phantasie für Realität hält. Das der Wahrheit, dem objektivierden Akt, immanente Element der Imagination wird dauerhaft exponiert; der unbedingte Realismus der zivilisierten Welt kulminiert im Faschismus. Der Paranoiker insistiert auf der Emanzipation seines Wahns, in dem Wahrheit und Sophistik identisch sind. Perzeption - die nur möglich ist, insofern ein Ding als bestimmtes, z.B. als Fall einer Gattung angenommen wird - ist vermittelte Unmittelbarkeit, in welcher Subjektives der scheinbaren Selbstgegebenheit des Objekts zugeschrieben wird. Dem Leibnizschen und Hegelschen Idealismus zufolge, vermag lediglich die Philosophie - die ihrer selbst bewußte Arbeit des Gedankens - die in der Wahrnehmung unmittelbar gesetzten und daher stringenten Begriffsmomente als begriffliche zu identifizieren, sie ins Subjekt zurück zunehmen und ihrer anschaulichen Gewalt zu entkleiden. „Der naiv Verabsolutierende, (...) ist ein Leidender, er unterliegt der verblendenden Macht falscher Unmittelbarkeit.“ (Horkheimer u. Adorno; ed. cit.; S.174). Diese Verblendung ist ein konstitutives Element des Urteils, dessen formulierter Inhalt das Behauptete nicht als isoliert oder relativ erscheinen lassen darf. Jedes Urteil, auch das negative, ist seinem Wesen nach versichernd. Das paranoische liegt in der Unfähigkeit des Gedankens das eigene Urteil zu negieren, es nimmt sich selbst für wahr. In der Perpetuierung des immergleichen Urteils wird der Mangel an Konsequenz im Denken evident. Das gesamte Denken tritt in den Dienst des partikularen Urteils, da das Subjekt unfähig ist das Scheitern des absoluten Anspruchs gedanklich zu vollziehen und somit sein Urteil zu modifizieren. Diese Positivität ist die Schwäche des Paranoikers. Beim Gesunden, dem zur Negation und Reflexion Fähigen, wird die Macht der den Schein begründenden Unmittelbarkeit gebrochen. Dieser Vorgang entbehrt jeglicher Aggression, welche dem Paranoiker immanent ist. Da die psychische Energie der Paranoia aus jener libidinösen Dynamik entspringt - wie von der Psychoanalyse erkannt wurde -, so bedeutet dies, daß ihre objektive Immunität in der Vieldeutigkeit begründet liegt, welche vom hypostasierten Akt nicht trennbar ist. Selektionstheoretisch ließe sich sagen, daß während der Evolution des menschlichen Bewußtseins diejenigen Individuen überlebt haben, bei denen die Kraft der Projektionsmechanismen am weitesten in die rudimentären logischen Fähigkeiten hinein reichten oder am wenigsten durch allzu frühe Ansätze der Reflexion gemindert waren. In der Wissenschaft wird dies an dem Hang zu Definitionen deutlich. Dort wird ein bestimmtes Gebiet durch gesellschaftliche Bedürfnisse bestimmt, gedanklich abgegrenzt und bis ins kleinste Detail untersucht, ohne es zu transzendieren[13]. Durch sein psychologisches Schicksal vermag der Paranoiker nicht seinen designierten Interessenskomplex zu überschreiten. Die Paranoia ist der Schatten der Erkenntnis, in dem sich die menschliche Begabung und Erfindungskraft im Bann der technischen Zivilisation selbst liquidiert.
Die falsche Projektion, das isolierte Schema der Selbsterhaltung, usurpiert selbst den Bereich der Kultur; das Reich der Freiheit und Bildung. Paranoia ist das Symptom der Halbgebildeten, deren Wahnsystem - als Versuch der Welt gewalttätig einen Sinn zu geben - sie selber sinnlos macht. Das Individuum diffamiert den Geist und die Erfahrung von denen es ausgeschlossen ist und bürdet anderen die Schuld auf, welche eigentlich die Gesellschaft trägt. Die Halbbildung hypostatiert, im Gegensatz zur bloßen Unbildung, das beschränkte Wissen als Wahrheit und kann den Bruch von innen und außen, von individuellem Schicksal und gesellschaftlichen Imperativen nicht aushalten[14]. Die paranoiden Bewußtseinsformen streben die Bildung von Bünden und Sekten an, deren Glaubenssysteme die fetischisierten Formelwesen von Wissenschaft und Religion (Akademien, Hierarchien und Fachsprachen) widerspiegeln. Die rational durchgestalteten und bestimmten Glaubenssysteme der Vergangenheit, die von den Völkern als geschlossen paranoide Formen aufgenommen wurden, ließen Freiraum für Bildung und Geist, und wirkten dadurch in gewisser Weise der Paranoia entgegen. Das Moment der Entlastung von der Paranoia wird in der Kollekivität sozialisiert; das Mitglied löst seine Paranoia durch die Teilnahme an der kollektiven ab, und klammert sich leidenschaftlich an die objektivierten, kollektivierten und bestätigten Formen des Wahns. Dadurch überwindet der Einzelne die Angst seinen Wahn allein erleben zu müssen. Möglicherweise war das einer der großen Beiträge der Religion zur Erhaltung der Art.
Heute allerdings wird Bildung, welche mit dem bürgerlichen Eigentum Verbreitung fand, unter das Primat der ökonomischen Verwertbarkeit subsumiert und erschafft somit in ungeahntem Ausmaß neue Bedingungen für die Paranoia der Massen. Das gebildete Bewußtsein unterliegt selbst einem Prozeß der Verdinglichung, da die reale Emanzipation der Menschen nicht simultan mit der Aufklärung des Geistes erfolgte. Kultur wurde zur informatorisch verbreiteten Ware, das Denken auf die Erfassung des isoliert Faktischen reduziert und gedankliche Zusammenhänge als unbequeme und unnütze Anstrengungen abgelehnt. „Der aufs Wissen abgezogene Gedanke wird neutralisiert, zur bloßen Qualifikation auf spezifischen Arbeitsmärkten und zur Steigerung des Warenwertes der Persönlichkeit eingespannt.(...). Schließlich ist unter den Bedingungen des Spätkapitalismus die Halbbildung zum objektiven Geist geworden.“ (Vgl. Horkheimer u. Adorno; a.a.O.; S. 177).[15]
In der totalitären Phase der Herrschaft wird das paranoische Wahnsystem zur ultima ratio erhoben und den, durch die Kulturindustrie verblendeten, Beherrschten aufoktroyiert. Herrschaft bedarf des kranken Bewußtseins um sich am Leben zu erhalten und nur Paranoide lassen sich die Verfolgung gefallen, in welche Herrschaft übergehen muß, in der sie andere verfolgen dürfen. Im Faschismus erstirbt das Gewissen und mit ihm die Fähigkeit zur Reflexion im Sinne der Durchdringung von Aufnahmefähigkeit und Einbildungskraft. Indem die Industrie der moralischen Entscheidung des unabhängigen ökonomischen Subjekts den wirtschaftlichen Boden entzieht, verkümmert die Reflexion. Das Gewissen, die Verantwortung des Individuums für sich und die Seinen, die Hingabe des Ichs an das substantielle Draußen, die Fähigkeit das Anliegen der anderen zum eigenen zu machen, wird gegenstandslos und durch die Leistungen des Einzelnen für den Apparat substituiert. Es kommt nicht mehr zur Austragung des eigenen Triebkonflikts, aus dem sich die Gewissensinstanz herausbildet. Anstatt der Internalisierung des gesellschaftlichen Gebotes, erfolgt die unmittelbare Identifikation mit der stereotypen Werteskala des faschistoiden Systems. Aufgrund der Dominanz, dieses so offenkundig bösartigen Herrschaftssystems, ist das ohnmächtige Individuum nur durch blinde Fügsamkeit in der Lage sein Schicksal zu ertragen. In dieser Situation bedarf es Seitens der Mächtigen eines Sündenbockes, auf den die Schuld geschoben werden kann; die Juden. Sie verkörpern jene Eigenschaften, die von der totalitär gewordene Herrschaft diffamiert werden: das Glück ohne Macht, der Lohn ohne Arbeit, die Heimat ohne Grenzen und die Religion ohne Mythos. Die herrschaftliche Aversion dieser Züge beruht auf dem Verlangen derselben in den Köpfen der Beherrschten. Herrschaft kann nur solange bestehen, wie die Beherrschten das Ersehnte zum Verhaßten machen. Dies gelingt durch die pathische Projektion, denn auch der Haß führt zur Vereinigung mit dem Objekt; in der Zerstörung, den Negativum der Versöhnung. Aus der Unfähigkeit zur Versöhnung, welche der höchste Begriff des Judentums und dessen ganzer Sinn die Erwartung ist, entspringt die paranoische Reaktionsform. Erst in der Befreiung und Immunität des Gedankens gegen Herrschaft und in der Abschaffung der Gewalt wäre die ideelle Emanzipation der Juden als Menschen, sowie der Schritt aus einer antisemitischen in eine humanistische Gesellschaft möglich. „Mit der Überwindung der Krankheit des Geistes, die auf dem Nährboden der durch Reflexion ungebrochenen Selbstbehauptung wuchert, würde die Menschheit aus der allgemeinen Gegenrasse zu der Gattung, die als Natur doch mehr ist als bloße Natur, indem sie ihres eigenen Bildes innewird. Die individuelle und gesellschaftliche Emanzipation ist die Gegenbewegung zur falschen Projektion, (...).“ (Horkheimer u. Adorno; ebd.; S.179).
2.7. Die psychologische Enteignung der Triebökonomie der Subjekte und die „Ticketmentalität“ als Resultat des Wirtschaftsprozesses
Lange Zeit galten in Deutschland antisemitische Gesinnung und völkisches Vokabular lediglich als Attribute bürgerlich-aufsässiger, konservativ-liberaler oder bloß reaktionärer Haltung. Doch in ihr war bereits der Keim des Chauvinismus und des universalen Mordes, des Genozids, angelegt. Ursprünglich zeugte das antisemitische Urteil von einer Stereotypie des Denkens, doch heute ist sie allein davon übriggeblieben. Wer den Faschismus eine Chance einräumt, erklärt sich einverstanden bzw. verpflichtet sich geradezu, mit der Zerschlagung der Gewerkschaften und der Verfolgung der Kommunisten, auch die Juden zu vernichten. Im Faschismus entfalten sich spezifische soziale Mechanismen, bei denen die tatsächliche Erfahrung der Einzelnen mit den Juden keine Rolle spielt; an die Stelle der Erfahrung tritt das Klischee (die Reduktion auf Freund-Feind-Denken) und an die der Phantasie das der Rezeption. Die kategoriale Arbeit wird in der Ära der Serienproduktion durch deren Schema, die Stereotypie, ersetzt. Das Urteil beruht nicht mehr auf dem wirklichen Vollzug der dialektischen Synthesis, sondern auf blinder Subsumtion. In der spätindustriellen Gesellschaft erfolgt der Rückgriff auf den urteilslosen Vollzug des Urteils; der Rezipient ist im Prozeß der Wahrnehmung nicht mehr gegenwärtig. In den Denkmodellen, wie der Erlebniswelt des Einzelnen werden blinde Anschauungen und leere Begriffe unvermittelt vereint; das Individuum verliert die Fähigkeit zur Anstrengung des Urteilens und damit zur Unterscheidung von Wahrheit und Falschheit.
Da die technische Entwicklung körperliche Arbeit weitestgehend überflüssig macht und diese Entwicklung auch auf die geistige Arbeit übertragen wird, wird Denken als obsoleter Luxus abgelehnt, sofern es nicht in höchst spezialisierter Form, in manchen Bereichen der Arbeitsteilung, der beruflichen Ausbildung oder Ausübung dient. Darin liegt das Geheimnis der Verdummung, die dem Antisemitismus zugute kommt. Die Gleichgültigkeit gegen das Individuum folgt aus dem Wirtschafts-prozeß, da es zum Hemmnis der Produktion wurde. Weil die fortschrittlichste Form notwendigerweise zur Vorherrschenden wird, formt das Prinzip der ökonomischen Rationalität auch die letzten Einheiten der Wirtschaft um; den Betrieb ebenso wie den Menschen. Im Konkurrenzkampf ersetzte das Warenhaus das Spezialgeschäft alten Stils und das von der Bevormundung in früheren Wirtschafts-zeiten emanzipierte Individuum (im Rahmen der Individuation aus tradierten Verhältnissen) verdingt sich als Proletarier auf dem Arbeitsmarkt, oder strebt als Unternehmer die Verwirklichung des Idealtyps des homo oecomomicus an.
Der psychische Apparat repräsentiert die diffizile Dynamik von Unbewußtem und Bewußtem, von Es, Ich und Über-Ich. In ihm findet die Auseinandersetzung mit dem Über-Ich, der gesellschaftlichen Kontrollinstanz im Individuum, dem Gewissen, statt, welches dem Ich schließlich erlaubt die Triebe in den Grenzen der Selbsterhaltung zu halten. Als Resultat der fehlerhaften Bewältigung dieser Triebökonomie werden die Neurosen angesehen, deren Symptome als Herstellungsversuch eines „Kompromisses“ zwischen Wunsch und Abwehr interpretiert werden. Sie helfen die durch Konflikte ausgelösten Ängste zu bewältigen und eine Ersatzbefriedigung (entstellte oder abwegige Erreichung des Triebziels) zu ermöglichen. Erst dieser Prozeß ermöglichte das einigermaßen freie Zusammenspiel der Subjekte, in welchem die Marktwirtschaft besteht. In den Zeiten der Weltkriege und des Monopolkapitalismus werden die Subjekte der Triebökonomie psychologisch enteignet und von der Gesellschaft bevormundet, da diese sie schneller betreibt. Der Einzelne braucht seine Handlungen nicht mehr in einer inneren Dialektik von Gewissen, Trieben und Selbsterhaltung zu begründen, sondern ihm werden die Entscheidungen von den Verbänden, der Verwaltung und der Kulturindustrie abgenommen. „Gehörte im Liberalismus Individuation eines Teils der Bevölkerung zur Anpassung der Gesamtgesellschaft an den Stand der Technik, so fordert heute das Funktionieren der wirtschaftlichen Apparatur die durch Individuation unbehinderte Direktion der Massen.“ (Cf. Horkheimer u. Adorno; ed. cit.; 182). Durch die ökonomisch bestimmte Richtung der gesellschaftlichen Totalität verkümmern im Individuum jene Organe, die im Sinne der autonomen Entwicklung seiner Existenz wirkten. Im Fortschreiten der Industriegesellschaft wird der Mensch, als Träger der Vernunft, zum Objekt der Repression; die Irrationalität der Anpassung an die Realität wird für den Einzelnen vernünftiger als die Vernunft. Die Dialektik der Aufklärung schlägt somit objektiv in den Wahnsinn der politischen Realität um.
Die Menschheit teilt sich in wenige bewaffnete Machtblöcke auf, die sich feindlich gegenüberstehen. Der von den Politikern propagierte ideologische Antagonismus ist dabei selbst nur eine Ideologie der blinden Machtkonstellation, bei der es nebensächlich bleibt, ob es nun eine faschistische oder eine kommunistische Doktrin ist. Beide Denkmodelle sind Produkte der Industrialisierung und überlassen dem apathischen Einzelnen im wesentlichen nur vorentschiedene Pseudoentscheidungen. Erst die Passivität der Massen ermöglicht diese Machtstrukturen, deren Verdinglichung die Vorstellung vom wahren Sachverhalt verschleiert. Mit der Wahl des „Tickets “ (für eine der Seiten) vollzieht sich die Anpassung an den zur Wirklichkeit erstarrten Schein, der sich dadurch selbst reproduziert. „Realitätsgerechtigkeit, Anpassung an die Macht, ist nicht mehr Resultat eines dialektischen Prozesses zwischen Subjekt und Realität, sondern wird unmittelbar vom Räderwerk der Industrie hergestellt. Der Vorgang ist einer der Liquidation anstatt der Aufhebung, der formalen anstatt der bestimmten Negation. Nicht indem sie ihm die ganze Befriedigung gewährten, haben die losgelassenen Produktionskolosse das Individuum überwunden, sondern indem sie es als Subjekt auslöschten. Eben darin besteht ihre vollendete Rationalität, die mit ihrer Verrücktheit zusammenfällt.“ (Horkheimer u. Adorno; ibid.; 185). In dem Mißverhältnis zwischen dem Individuum und dem Kollektiv verbirgt sich der Widerspruch von Ohnmacht und Allmacht, der absolute Gegensatz der Versöhnung. Allerdings verschwinden mit der Überwindung des Subjekts nicht auch jene psychologischen Determinanten, auf welche sich die falsche Gesellschaft stützt. Vielmehr fügen sich die Charaktertypen dadurch präzise in das Räderwerk ein; das System bedarf jener zwanghaften, unfreien und irrationalen psychologischen Mechanismen der Individuen. Der dem reaktionären Ticket inhärente Antisemitismus entspricht dem destruktiv-konventionellem Syndrom, dessen Haß sich nicht ursprünglich gegen die Juden richtet und nicht auf einer gegen sie ausgebildeten Triebrichtung beruht. Vielmehr werden die empirischen Elemente der Antisemitismus durch das Ticketdenken potenziert.
Der Antisemitismus erhält sein undurchdringliches Wesen dadurch, daß sich die Psychologie des Einzelnen und deren Inhalte nur noch durch die gesellschaftlich vorgegebenen synthetischen Schemata herstellen lassen. Die antisemitischen Exekutanten wie die „verantwortungsfreien“ Zuschauer, die Administration totalitärer Herrschaftssysteme wie der einfache Familienvater, das Parteimitglied wie der (Zyklon B-) Fabrikarbeiter, führen lediglich die von der Wirtschaft verhängten Urteile aus. All dies geschieht, obwohl die typisch jüdischen Eigenschaften gar nicht mehr existent sind. Unter dem nivellierenden Druck der spätindustriellen Gesellschaft wurden die den einstigen Unterschied konstituierenden Religionen, durch erfolgreiche Assimilation, in Kulturgüter umgewandelt. Ökonomisch gab es den Juden nicht mehr. Der faschistische Antisemitismus muß in gewisser Weise sein Objekt erst erfinden, an dem er sich betätigen kann. Die zum gesellschaftlichen Existenzial erhobene Paranoia muß sich ihr Ziel selbst setzen. Aufgrund derselben Ursachen und Determinanten - der Reduktion auf die abstrakte Arbeitsform -, deren dynamische Entwicklung zum Ticktdenken jeglicher ideologischer Richtung führt, erscheinen die Tickets als untereinander auswechselbar. Nicht erst das antisemitische Ticket ist antisemitisch, sondern die Ticketmentalität selbst. Auch wenn die „psychologisch humaneren“ Individuen vom progressiven Ticket angezogen werden, so verwandelt die Absenz der Erfahrung auch deren Anhänger in Feinde der Differenz; die der Progressivität immanente Freiheit wird sukzessiv unter die machtpolitischen Strukturen subsumiert. In der Wut auf die Differenz werden die Ressentiments der beherrschten Subjekte gegen die Minoritäten evident. Selbst die Juden unterliegen dem Ticketdenken ebenso wie die faschistoiden Jugendverbände. Im Nebel der Verhältnisse von Eigentum, Besitz, Verfügung und Management entzieht sich die gesell-schaftlich verantwortliche Elite als Minderheit der theoretischen Bestimmung. Von der Diskrepanz zwischen rassischer Ideologie und der Wirklichkeit der Klassen bleibt lediglich der Unterschied gegenüber der Majorität übrig. „Wenn aber das fortschrittliche Ticket dem zustrebt, was schlechter ist als sein Inhalt, so ist der Inhalt der faschistischen so nichtig, daß er als Ersatz des Besseren nur noch durch verzweifelte Anstrengung der Betrogenen aufrecht erhalten werden kann.(...). Während es keine Wahrheit zuläßt, an der es gemessen werden könnte, tritt im Unmaß seines Widersinns die Wahrheit negativ zum Greifen nahe, von der die Urteilslosen einzig durch die volle Einbuße des Denkens getrennt zu halten sind. Die ihrer selbst mächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte die Grenzen der Aufklärung zu durchbrechen.“ (Horkheimer u. Adorno; op. cit.; S. 186).
3. Der Charakter als Determinante ideologischer Präferenzen
Da in der heutigen Zeit feudal-religöse Autoritäten an gesellschaftlicher Bedeutung verloren haben, besteht nun die Autoritätsgebundenheit des Individuums in der bedingungslosen Anerkennung der bestehenden Macht und konventioneller Werte, wie äußerlich-korrektes Benehmen, Erfolg, Fleiß, Tüchtigkeit, physische Sauberkeit, Gesundheit und unkritisches Verhalten. Innerhalb dieses Konventionalismus ist hierarchisches Denken und Unterwürfigkeit gegenüber den idealisierten moralischen Autoritäten vorherrschend. Es wird eine Veräußerlichung des Lebensgefühls manifest, welche in der Anerkennung der gegebenen Ordnung beruht. Das Ich sieht sich den Anforderungen der Selbstbestimmung angesichts der übermächtigen sozialen Kräfte und Einrichtungen nicht mehr gewachsen. Die Verachtung aller eigentlich subjektiven Kräfte, geistigen und phantasievollen Regungen, dient der Aufrechterhaltung einer falschen Sicherheit. Die Welt wird das Raster von Gut und Böse gepreßt und die unveränderliche Natur oder selbst okkulte Mächte müssen herhalten, um eigenes, verantwortliches Denken zu vermeiden. All dem liegt das tiefe „Unbehagen in der Kultur“ und der unbewußte Wunsch nach Zerstörung (selbst der eigenen Person) zugrunde. Ausdruck dafür ist der Zynismus und die Menschenverachtung, welche vom totalitären Charakter vor allem bei den von ihm auserwählten oder aufoktroyierten Feinden projektiv wiedergefunden werden. Es läßt sich psychologisch nachweisen, daß die betreffenden Charaktere in ihrer Kindheit emotionalen Traumata erlegen sind und als Schutzhandlung wiederholen was ihnen selbst widerfahren ist. Deutlich wird der erlebte Mangel an Liebe in der auffälligen Beziehungslosigkeit und der generellen emotionalen Flachheit ihres Empfindens. Ihnen ist die Fähigkeit überhaupt lebendige Erfahrungen zu machen weitgehendst abhanden gekommen. Neben der Veräußerlichung, daß alles Unannehmbare oder Negative einer übermächtigen Gewalt zugeschrieben wird, sind diese Subjekte in ihrem eigenen Ich gefangen und unfähig über das beschränkte Eigeninteresse oder das der Gruppe hinauszugehen.
Es läßt sich feststellen, daß heute in breiten Teilen des sozialen Zusammenlebens solche Bewußtseins-formen wirken, welche man eigentlich nur bei Vorurteilsvollen erwarten sollte. Es geht hierbei um die formale Beschaffenheit des vorherrschenden Denkens überhaupt. So ist beispielsweise Stereotypie und (Vor-) Urteilsbildung nicht nur auf diese totalitären Charaktere beschränkt, auch besteht die Tendenz unpersönliche Verhältnisse personalisiert und nicht auf reflexivem Wege transzendiert und verstanden werden. Dieses „kulturelle Klima“, als Produkt des Mechanisierungs- und Bürokratisierungsprozesses, veranlaßt die Individuen zu „Ticket“-Denken und Anpassung.
3.1. Der Individuationsprozeß
Der Prozeß der Individuation[16] bedeutet die fortschreitende Loslösung des Individuums von seinen ursprünglichen Bindungen. Diese „primären Bindungen“ beinhalten Sicherheit und mögliche Orientierung bei gleichzeitigem Mangel an Individualität; sie behindern die Entwicklung zu einem freien, produktiven, autonomen und sich seiner kritischen Vernunft zu bedienen fähigen Individuum. Dies impliziert, „daß die eine Seite des Wachstumsprozesses der Individuation das Wachstum der Stärke des Selbst ist“[17], begrenzt durch die gesellschaftlichen Umstände. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr der zunehmenden Vereinsamung und Isolierung, da die primären Bindungen neben Sicherheit eine ursprüngliche Einheit mit der Welt boten.
Ist die Stufe der völligen Individuation erreicht, sieht sich der Betreffende vor das Problem der Neuorientierung gestellt; der Notwendigkeit, den Ohnmachts-, Unsicherheits- und Einsamkeits-gefühlen zu begegnen. Eine (positive) Möglichkeit besteht in dem spontanen Tätigsein und der aktiven Solidarität mit den Mitmenschen, deren Prämissen die Entwicklung der inneren Stärke und Produktivität sind. Auf diese Weise kann er mit der Welt in Beziehung treten und seinen emotionalen, sinnlichen und intellektuellen Fähigkeiten, ohne Aufgabe der Unabhängigkeit und Integrität seines individuellen Selbst, Ausdruck verleihen.
Bieten die sozialen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen jedoch keine, für diese positive Entwicklung notwendige, adäquate Grundlage, so sieht sich das Individuum gezwungen, neue, ihm Sicherheit versprechende Bindungen einzugehen. Dies geschieht durch Unterwerfung – auf Kosten der Stärke und Integrität des Selbst – unter „sekundäre“ Bindungen als Fluchtmechanismus.
Die Dialektik des individuellen Wachstumsprozesses gilt analog für den kohärenten Prozeß der wachsenden menschlichen Freiheit; die Freiheit von Bindungen auf der negativen Seite und die Freiheit zu einer (potentiell) positiven Verwirklichung der Individualität und autonomen Rationalität auf der anderen Seite.
Die historische Dimension des Individualisierungsprozesses, ausgehend vom Ende des Mittelalters, verursacht durch die Renaissance[18], weitergeführt durch die Reformation (Protestantismus/Calvinsche Prädestinationslehre[19] ) und forciert durch den Aufstieg des Kapitalismus[20], verdeutlicht die fundamentalen Änderungen der Gesellschaftsstruktur und damit verbunden der Persönlichkeit des Menschen bis in die moderne Gesellschaft. „Der Einzelne wird von wirtschaftlichen und politischen Fesseln frei (...). Aber gleichzeitig wird er auch von all jenen Bindungen frei, die ihm zuvor Sicherheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit gaben.“ (Fromm, E.; a.a.O.; S. 51). Die neugewonnene Freiheit erweckt in ihm ein tiefes Gefühl der Unsicherheit und Ohnmacht, des Zweifels, der Verlassenheit und Angst. Wenn es ihm nicht möglich ist von der negativen zur positiven Freiheit zu gelangen, muß das Individuum Erleichterung von diesen Gefühlen finden um in der Welt bestehen zu können. Befriedigung findet das entstandene psychologische Bedürfnis durch Unterwerfung unter einen (faschistischen) Führer oder durch zwanghafte Konformität zur Demokratie[21].
3.2. Autorität und Familie
Die Entwicklung der modernen Zivilisation befreite in erster Linie nicht das Individuum, sondern primär die bürgerliche Familie. Ihre Emanzipation vom Feudalismus formte sie zu einer pseudo-feudalen, hierarchisch strukturierten Institution, welche im Konflikt mit der industrialisierten Gesellschaft steht, welche für sich Rationalität proklamiert: die ausschließliche Herrschaft des Prinzips der Berechenbarkeit und des freien Tauschs. Mit der Substitution der feudalen Knechtschaft durch den Arbeitsvertrag etablierte sich auch die patriarchale Herrschaft des Mannes innerhalb der Familie. Die Beziehung zum Feudalherrn wurde veräußerlicht, verdinglicht und kalkulierenden Gedanken subsumiert. Die Menschen wurden sich ihrer Existenz als autonome Wirtschaftssubjekte bewußt. Dennoch behielt die Volkswirtschaft des 19. Jahrhunderts, für die das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit typisch ist, die Familie als funktionierende ökonomische Einheit bei. Im Mittelstand war die familiäre Autorität noch halbwegs intakt, da der Erfolg der Unternehmen größtenteils auf der Solidarität der Familie beruhte. Mit der zunehmenden Entwicklung veränderte sich aber auch das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, schwand der Respekt vor dem Familienoberhaupt und die Autorität im Hause erhielt eine irrationale Färbung.
Der Respekt vor Gesetz und Ordnung, verkörpert durch den Staat, ist untrennbar mit dem der Kinder vor ihren Eltern verbunden. Die Elemente unseres kulturellen Systems, der soziale Kitt sozusagen, resultieren aus den Gefühlen, Einstellungen und Überzeugungen, welche in der Familie wurzeln. Die Autorität der Nation ist von der Autorität der Familie abhängig. In der westlichen Zivilisation entfernt sich die Familie zusehends von der konventionellen Idee einer wirtschaftlichen Einheit: sie wird durch die Geschichte ihres Sinngehaltes entleert und schlägt in Ideologie um, wie man am Ahnenkult nachzuweisen in der Lage ist. Die Ehe wird von der Gesellschaft derart hypostasiert, daß Ehe und Familie synonym werden. Sie wird zu einem pragmatischen Verhältnis, zu einer Zweckbeziehung, in der Kinder aus rein äußerlichen Gründen aufgezogen werden. War der Einzelne in früheren Zeiten noch Teil einer gleichsam organischen Wesenseinheit, welche seinem Leben Sinn gab und in seinen Handlungen ständig präsent war, so tendieren die Individuen heute dahin soziale Atome zu werden. Namen werden zu reinen Erkennungsmarken, zu Etiketten, und Individualität regrediert zu einer Reihe von Fähigkeiten und Eigenschaften, welche der ökonomischen Verwertbarkeit unterliegen. Dieselben ökonomischen Veränderungen, welche die Familie zerstören, führen die Gefahr des Totalitarismus mit sich. Durch die Familie (in der Krise) werden jene Dispositionen hervorgebracht, welche die Menschen zur blinden Unterwerfung prädisponieren.
Die Beziehung zwischen Kind und Eltern ist eine ambivalente zwischen Liebe und Haß. Das Kind merkt, daß der Vater keineswegs jenen machtvollen, unparteiischen Richter und großzügigen Beschützer darstellt, als der er sich geriert. Die sozial bedingte Schwäche des Vaters ermöglicht es dem Kind nicht, sich mit ihm zu identifizieren. Vom Kind werden jene Forderungen und Hoffnungen abgelehnt, welche sonst eine Anpassung an die Außenwelt, die Loslösung von der Familie verzögerte. Die liebevolle Mimesis des selbstsicheren, klugen Mannes, der sich seinen Pflichten widmet, war in früheren Zeiten eine Quelle moralischer Autonomie für das Individuum. Heute erhält das heranwachsende Kind anstatt eines Vaterbildes nur die abstrakte Vorstellung einer willkürlichen Macht. Dadurch sehnt es sich nach einem stärkeren, machtvolleren Vater, einem Über-Vater, wie ihn die faschistische Ideologie suggeriert. Obwohl die gefühlsmäßige Beziehung zu den Eltern bereits grundlegend gestört ist, wird dem Kind noch von der Familie die autoritäre Unterwürfigkeit indoktriniert. Später wird der Vater häufig durch ein Kollektiv (Team, Klasse, Partei, Staat) ersetzt. Je mehr die Abhängigkeit von der Familie auf eine rein psychologische Funktion im Seelenleben des Kleinkindes reduziert wird, desto abstrakter und unbestimmter wird sie im Bewußtsein des Heranwachsenden; und nicht selten generiert sich daraus eine allgemeine Breitschaft, jede beliebige Autorität zu akzeptieren, wenn sie nur stark genug ist.
Diese Entwicklung wird durch den Wandel in der Rolle der Mutter gefördert: in den gebildeten städtischen Schichten legen Frauen eine höchst praktische Einstellung in Bezug auf Kinder an den Tag. Mutterschaft wird als ein Beruf angesehen und die Haltung der Frau den Kindern gegenüber ist sachlich und pragmatisch. Ihre genuine Spontaneität, Fürsorge und Wärme löst sich auf; der Mutterkult schlägt von einer Mythologie, im strengen Sinne des Wortes, in eine Reihe starrer Konventionen um. Für ihre begrenzte Zulassung zur wirtschaftlichen Welt des Mannes haben die Frauen mit der Übernahme der Verhaltensschemata einer restlos verdinglichten Gesellschaft ihren Tribut entrichtet. Ihre Konsequenzen reichen bis in die Mutter-Kind-Beziehung hinein. Einst war die Mutter Mittlerin zwischen dem Kind und der Realität, und stattete es mit einem Gefühl von Sicherheit aus, aus welchem sich ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Individualität entwickeln konnte. Heute erfährt das Kind nicht mehr die uneingeschränkte Liebe seiner Mutter, kann seine eigene Liebesfähigkeit nicht entfalten. Das Kind unterdrückt das Kindliche in sich und verhält sich wie ein berechnender kleiner Erwachsener ohne beständiges, unabhängiges Ich, dafür aber mit einem ungeheuren Maß an Narzißmus. Seine Hartgesottenheit und gleichzeitige Unterwürfigkeit angesichts realer Macht prädisponieren es für totalitäre Anschauungen.
In der totalen organisatorischen Erfassung unseres Lebens, welche die ehemals von der Familie eingenommene Privatsphäre in sozial kontrollierte Freizeit verwandelte, wird die Herrschaft der Frau über diese Sphäre der organisierten Kultur evident. Eine Herrschaft, welche – wieviel Gutes sie auch immer zu bewirken vermag – die traditionelle Rückständigkeit der Frau hervorkehrt.
Es läßt sich empirisch aufzeigen, daß besonders für faschistische Propaganda anfällige Individuen häufig eine Ideologie vertreten, welche eine starre und unkritische Identifizierung mit der Familie propagiert. Ebenso läßt sich nachweisen, daß sich diese Personen in der frühen Kindheit der familiären Autorität absolut unterwarfen[22]. Bemerkenswerter Weise unterhielten sie aber niemals eine echte Beziehung zu ihren Eltern, sondern akzeptierten diese nur in einer ganz konventionellen und äußerlichen Weise. Diese Verbindung von Kälte und Unterwürfigkeit kennzeichnet den potentiellen Faschisten von Heute in signifikanter Weise.
Der von faschistisch gesinnten Menschen idealisierte Elternkult beruht in den meisten Fällen auf der Bewunderung eines strengen und strafenden Vaters. Die Feindseligkeit ihm gegenüber kehrt sich nun ausschließlich gegen Schwache und Unterdrückte. Die Anerkennung der Familie dient dem Individuum dazu, seinem sozialen Narzißmus Ausdruck zu verleihen, bei welchem der autoritäre Charakter stets konventionell und stereotyp agiert. Das Vaterbild ist das einer strengen, gerechten, erfolgreichen, für sich stehenden und gelegentlich großzügigen Respektsperson. Die Mutter hingegen vereint Standardeigenschaften wie Weiblichkeit, praktisches Geschick, gutes Aussehen, Sauberkeit und Gesundheit.
Das Phänomen des sado-masochistischen Charakters ist symptomatische für eine Zeit, die an der familiären Autorität festhält, obwohl sich die innere Substanz der Familie aufgelöst hat. Der abstrakten Verherrlichung der Familie entspricht der beinahe vollständige Mangel einer (positiven oder negativen) Beziehung zu den Eltern überhaupt. Die Unterwürfigkeit gegenüber dem Vater, eine verdrängte und unbewußt gehaltene Rebellion gegen ihn, bleibt der entscheidende Mechanismus bei der Ausprägung sozialer und politischer Überzeugungen.
Das gesamte Gefühlsleben des autoritätsgebundenen Charakters trägt Züge von Oberflächlichkeit und emotionaler Kälte, die manchmal Merkmalen nahestehen, welche bei bestimmten Psychotikern beobachtbar sind. Bedeutsam ist die generelle Verachtung des Mitgefühls, worin sich die Liebe der Mutter zu ihrem Kind erkennen ließe. Die bewußte Ablehnung der Liebe zur Mutter resultiert aus dem gewonnenen Eindruck, daß die Frau aufgrund ihres Geschlechts etwas Schwaches und Verächtliches darstellt. Die rigide Disjunktion zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit entspricht der allgemeinen Tendenz, in starren Disjunktionen und Stereotypen zu denken. Aus dem gestörten Verhältnis zur Mutter resultiert neben Härte, Rücksichtslosigkeit und übertriebener Männlichkeit, auch ein solches gegenüber dem anderen Geschlecht im allgemeinen. Aus dem anti-femininen Effekt resultiert letztendlich auch die Ablehnung all dessen, was als „anders“ eingeschätzt wird. Es kann vermutet werden, daß eine grundlegende Beziehung zwischen Homosexualität, Autoritätsgebundenheit und dem gegenwärtigen Verfall der Familie besteht.
3.3. Kausalität von Ideologie und Charakter
Ideologien; Systeme und Meinungen, Attitüden und Wertvorstellungen sind Ausdruck bestimmter historischer und sozialer Prozesse (welche Marx nach ihrer Partikularität beurteilte) und vertreten die rationalen Interessen bestimmter Gruppen. Ihnen liegen die individuellen Bedürfnisse zugrunde, und je nach dem Grad der (Un-) Befriedigung variiert die Empfänglichkeit des Einzelnen für bestimmte Ideologien. Sie haben die Aufgabe, das Individuum an die Gesellschaft zu assimilieren und führen bei ihm/ihr zur Ausbildung eines bestimmten Denkmusters. Während sich diese Denkmuster unter „Vorurteilsfreien“ stärker differenzieren, so weisen sie bei „Autoritären“ auffällig viele Gemeinsam-keiten auf, die sich zu Syndromen zusammenfassen lassen.
Mit Hilfe standardisierter statistischer Methoden (Fragebögen) wollte Adorno überprüfen, inwiefern diese Denkformen beim Einzelnen in sich konsistent sind und in Gruppen Verbreitung finden[23]. Dabei erwiesen sich die Diskrepanzen zwischen den Angaben und dem „wirklich gedachten“, was vom geistigen Klima der jeweiligen sozialen Situation abhängig ist, als äußerst problematisch. Ausdruck findet dies in dem disgruenten Verhältnis von Ideologie und Handlungsbereitschaft.
Die Frage der Potentialität ist von größter praktischer Bedeutung, da sie in die Gesamtideologie des Individuums eingebettet ist. Das von der objektiven Situation abhängige Verhalten kann der Charakterstruktur (Organisation von Bedürfnissen, welche das konsistente Handeln in allen Situationen veranlassen) nicht gleichgesetzt werden; die bestimmenden Kräfte sind als (Re-) Aktions-potential zu verstehen, dem antagonistisch das hemmende Verhaltenspotential gegenübergestellt ist. In eben diesem Potential ist auch die Ursache für den Widerstand gegen antidemokratische Tendenzen zu suchen. Zur Manifestation des Aktionspotentials kommt es erst durch die Gegebenheit einer adäquaten gesellschaftlichen Rahmenbedingung, Die Charakterentfaltung ist, neben der genossenen Erziehung, bedingt durch sozio-ökonomische Umstände, in denen das Kind aufwächst, Da der Charakter gegen tiefgreifende Veränderungen gefeit, wenn auch modifizierbar erscheint, kann er als Determinante ideologischer Präferenzen betrachtet werden. Die Annahme, daß sich Menschen mit politischen oder sozialen Gruppen identifizieren, die ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vertreten, hat nur eingeschränkte Gültigkeit, da es häufig vorkommt, daß Individuen irrational entgegen ihren eigenen ökonomischen Interessen handeln. Vielmehr beruht dieser Prozeß auf dem Bedürfnis, sich einer Gruppe anzupassen – deren Meinungen, Attitüden und Wertvorstellungen zu übernehmen, diese zu favorisieren und andere Gruppen zu degradieren – und hat somit seine Ursache in der Charakterstruktur. Dies geschieht durch die Generalisierung institutionalisierter Vorurteile gegenüber Fremdgruppen, oftmals bei jeglicher Absenz eigener Erfahrungen mit dieser. Neben den situationsbedingten Faktoren liegt der Schwerpunkt auf dem psychologischen Moment, da der Faschismus eine durch Unterwerfung und aktive Kooperation der Volksmajorität gewährleistete Massenbasis für seinen politischen Erfolg voraussetzt und in erster Linie an die emotionalen Bedürfnisse und nicht an das rationale Selbstinteressen appelliert.
3.4. Konstruktion der F-Skala/psychologische Variablen
Auf der Grundlage der Resultate verschiedener vorausgegangener Befragungen (A-S-, E- und PEC-Skala) und diverser anderen Studien zu diesem Thema wurde die Faschismus-Skala konstruiert, mit der potentiell faschistische Charakterzüge gemessen werden sollten[24]. Sie enthielt in enger Wechsel-wirkung zueinander stehende Variablen, welche jede für sich genommen einen zentralen Zug im Individuum, mit Relevanz sowohl die den Ethnozentrismus als auch für bestimmte Meinungen und Attitüden hinsichtlich dem Autoritarismus bildet. Die Grundüberlegung war, daß infolge einer gesellschaftlichen Tabuisierung der Triebbefriedigung das Individuum aggressive Impulse hegt, Diese können moralisierend auf Fremdgruppen verdrängt werden und unter anderem zur autoritären Aggression führen. Eine andere Möglichkeit besteht in der für das „Ich“ akzeptablen Form der Feindseligkeit der Variablen „Destruktivität u. Zynismus“.
Folgende Variablen wurden in die Faschismus-Skala integriert:
a). Der „Konventionalismus“ zeichnet sich durch eine starre Bindung an die tradierten Werte des Mittelstandes aus, die im Begriff sind der Rationalität zu weichen (z.B. Kirche) und deren rigide Internalisierung durch das „Über-Ich“. Konventionalistische, überangepaßte Individuen sind in der Lage, ihren moralischen Kodex gegen einen anderen einzutauschen und somit dem Diktat äußerer Mächte zu folgen.
b). Bei der „Autoritären Unterwürfigkeit“ geht die Bereitschaft zur unkritischen Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten und der Wunsch nach einem starken Führer (masochistische Tendenzen) ebenfalls auf eine mißlungene „Über-Ich“-Bildung zurück. Der Einzelne ist empfänglich für Manipulation (Propaganda) und tendiert zum Ethnozentrismus.
c). Signifikant für die „Autoritäre Aggression“ ist die Projektion der ursprünglichen Aggressionen gegen die Autorität der Eigengruppe auf Fremdgruppen, welche gegen die Konventionen verstoßen. Auf sie werden die eigenen, als inakzeptabel empfundenen, Triebe umgeleitet und verurteilt. Die Ursache für dieses sadistische Äquivalent zu b). liegt in der mißlungenen Internalisierung des „Über-Ich“ durch eine „Ich“-Schwäche.
d). Der „Anti-Intrazeption“ liegt ebenfalls eine „Ich“-Schwäche zugrunde und ist gekennzeichnet durch Widerstand gegen subjektive, sensible und phantasievolle Regungen.
e). „Aberglaube und Stereotypie“: Der Aberglaube korreliert mit dem Ethnozentrismus und bedeutet die Disposition, das persönliche Schicksal von mystischen oder phantastischen, heteronomen Determinanten abhängig zu machen; die Tendenz, die eigene Verantwortung externen Kräften unterzuordnen. Stereotypie, als Bereitschaft in rigiden Kategorien zu denken und unter Vorurteile zu subsumieren, ist eine Form der Beschränktheit in psychologischen und sozialen Fragen.
f). „Machtdenken und Robustheit (Kraftmeierei)“: Die „Ich“-Schwäche und Bewältigung bestimmter sozial geächteter Triebe veranlassen das Individuum seine „Ich“-Eigenschaften überzubewerten. Der Machtkomplex findet Ausdruck in der Identifikation mit der Macht bei gleichzeitiger Unterwerfung; menschliche Beziehungen werden in Kategorien (z.B. Führer - Gefolgschaft; stark – schwach...) geordnet.
g). In „Destruktivität und Zynismus“ äußert sich rationalisierte, nicht moralisierende allgemeine Feindseligkeit und Menschenverachtung.
h). Die „Projektivität“ dient dazu, „Es“-Triebe unbewußt zu halten, sie auf andere zu übertragen und sie deswegen zu verachten. Projektivität bedeutet ebenfalls die Disposition, Vorstellungen von „bösen Mächten in der Welt“ für real zu erachten.
i). Das übermäßige „Interesse an der Sexualität“ ist ein Zeichen für die Unterdrückung der eigenen sexuellen Triebe. Oft geht sie mit einer allgemeinen Strafsucht für Übertreter des Sexualkodex einher.
4. Typologie der Vorurteilsvollen und Vorurteilsfreien Charakterstrukturen
Gestützt auf die Ergebnisse der Fragebögen, lassen sich Syndrome sowohl der vorurteilsvollen (H) als auch der vorurteilsfreien (N) Charakterstrukturen formulieren, die einander teilweise antagonistisch gegenübergestellt werden können. Ich möchte vorwegnehmen, daß die ersten beiden Syndrome der Vorurteilsvollen keine psychologischen, sondern soziologische Typen repräsentieren.
4.1. Das „Oberflächenressentiment“ und der „starre Vorurteilsfreie“
Das Phänomen des Oberflächenressentiments stellt keinen psychologischen Typus im eigentlichen Sinne dar, sondern repräsentiert einen soziologischen Typ, insofern die Motivationen rational erklärt werden können. Bei Vertretern dieses Syndroms lassen sich bewußte oder vorbewußte institutionalisierte Manifestationen feststellen. Das Subsumieren unter Stereotypen dient der Rationalisierung von persönlichen Schwierigkeiten, vor allem von sozio-ökonomischen Ängsten (z.B. der Furcht vor dem Absinken in der sozialen Hierarchie), um sie psychologisch überwinden zu können. Die (pseudo-) rationale Qualität dieses Klischee-Denkens zeichnet sich dadurch aus, daß die Personen im allgemeinen fähig sind auch ggf. ihre Vorurteile zu modifizieren. Desweiteren muß ihnen die Fähigkeit zur Differenzierung von konkreter Erfahrung und übernommener Stereotypie zuerkannt werden.
Bezeichnend ist die Einstellung in Rassefragen, die durch starke – den mechanisch von außen übernommenen, traditionellen Schemata der Stereotypie entsprungenen – Vorurteile gegenüber Minderheiten geprägt und trotzdem frei von starrer Projektion und destruktivem Strafwillen erscheint. Aggressivität äußert sich nur gegenüber Gruppen, mit denen konkurriert und deshalb bestimmte materielle oder gesellschaftliche Nachteile assoziiert werden.
Die Aversion von bestimmten Minoritäten, im Rahmen der „Sündenbock-Theorie“, dient dem Versuch, sich vom eigenen Versagen und dem damit verbundenen Schuldgefühl zu befreien. Dies geschieht durch Umwälzung der persönlichen Last auf personalisierte Wesen einer Gruppe, die dann als Verursacher für bestimmte gesellschaftliche Tendenzen verantwortlich gemacht werden, deren wirklicher Ursprung in der Realität ganz woanders zu suchen ist (z.B. im ökonomischen Gesamtprozeß). Dieser Mechanismus ist, genauso wie die von außen übernommene Stereotypie, von der Person institutionalisiert worden.
Die Bedeutung dieses primär soziologischen Phänomens für das faschistische Potential sollte nicht unterschätzt werden, zumal die Charakterstruktur zweifelsohne die des Vorurteilsvollen ist, auch wenn das libidinöse Gewicht auf dem Vorurteilsklischee zu liegen scheint.
Dem „Oberflächenressentiment“ (H) kann der Gegentyp des „starren Vorurteilsfreien“ (N) zugeordnet werden. Er zeichnet sich durch bestimmte stereotype Züge bezüglich seiner Vorurteilslosigkeit aus; sie beruht nicht auf konkreter Erfahrung, sondern ist Bestandteil einer allgemeinen äußerlichen Oberflächenideologie und nicht der Charakterstruktur. Teilweise nimmt der Einsatz für Minderheitenrechte zwanghafte, rigide Züge mit paranoiden Tendenzen an. Der Widerstand richtet sich hauptsächlich gegen das Vorurteil als eine der Prämissen des Faschismus.
Vertretern dieses Syndroms ist neben deduktivem und destruktivem Denken ein rationalisiertes Strafbedürfnis inhärent. Im allgemeinen charakterisieren ihn starke „Über-Ich“-Tendenzen, bei denen ein Kollektivbild (Freud: archaische Gestalt der Bruderhorde) die väterliche Autorität verdrängt hat. Vorzufinden ist dieser Typ v.a. bei jungen progressiven Menschen, insbesondere bei Studenten.
4.2. Das „konventionelle Syndrom“
Die Stereotypie dieses Syndroms hat ihre Ursache in der Idealisierung und Identifikation mit einer bestimmten Gruppierung und deren Ideologie, der das Individuum angehört, oder mit der es sympathisiert. Daraus resultierende Aversionen gegen andere Gruppen äußern sich in „vorbewußten“ (ihnen selbst nicht einmal bewußten) Vorurteilen, die sie kritiklos von außen übernehmen und internalisieren. Diese Vorurteile sind insofern nicht rational, da sie nicht mit den eigenen Problemen und Sorgen in Beziehung stehen, daraus ergibt sich, daß sie keine bedeutende Funktion in der Psyche besitzen. Es besteht ebenso eine erhebliche Diskrepanz von Vorurteil und Erfahrung im Umgang mit Fremdgruppe. Feindseligkeit gegenüber Minoritäten findet ihren Ausdruck in der emphatischen Trennung von Eigen- und Fremdgruppe und ist als wesentlicher Bestandteil einer allgemeinen Konformität in die Charakterstruktur integriert. Besonders wichtig erscheint hierbei, daß die eigene Unzufriedenheit hinter die Zustimmung zu den vorherrschenden konventionellen Maßstäben gestellt wird. Zu aggressiven Impulsen kommt es in der Regel nicht, da das Individuum die Werte und Normen der Zivilisation, des Staates und des „Anstandes“ als absolut anerkennt. Dies zeugt von einem ungefestigten „Über-Ich“, unter dessen veräußerlichten Instanzen der Einzelne weitgehend steht und beeinflußt wird. Häufig ist eine gewisse Rigidität des Konventionalismus erkennbar, in der Überzeugung der Unveränderlichkeit von Eigenschaften von Fremdgruppen, ebenso wie er gegen Extreme überhaupt gerichtet ist.
Beispielhaft für Vertreter dieses Syndroms ist die Angst anders zu sein; Frauen legen Wert auf Sauberkeit und Weiblichkeit, Männer legen ihre Priorität darauf, „richtige“ Männer zu sein. Ein weiteres Charakteristikum für dieses Syndrom ist das Streben nach sozialer Sicherheit.
Das Phänomen der Konformität ist das in der heutigen Gesellschaft unter „Normalen“ am weitesten verbreitete; das Individuum hört auf, es selbst zu sein und assimiliert sich adäquat den gesellschaftlichen Gegebenheiten. An die Stelle des ursprünglichen Selbst, als des genuinen Urhebers aller geistiger Aktivität, tritt das Pseudo-Selbst als Stellvertreter, das lediglich die Rolle spielt die von ihm erwartet wird. Der Verlust der Identität ist verursacht durch die Surrogation der genuinen Akte des Denkens, Fühlens und Wollens durch Pseudo-Akte; subjektiv als eigen rezipierte geistige Akte sind nichts anderes als von außen suggerierte. Um die aus dieser Selbst-Substitution resultierende Unsicherheit und Hilflosigkeit zu überwinden, muß sich das Individuum anpassen und Anerkennung durch andere finden. Dadurch steigt die Bereitschaft sich neuen, Sicherheit versprechenden und Selbstzweifel mindernden, Autoritäten zu unterwerfen.
Diesem Syndrom der Vorurteilsvollen (H) kann kein Vorurteilsfreier (N) zugeordnet werden.
4.3. Das „autoritäre“ Syndrom
Bei diesem, dem Gesamtbild der Vorurteilsvollen (H) am repräsentativsten Syndrom, wird der Ödipuskonflikt auf sadomasochistische Weise gelöst: wobei derartige Triebbefriedigung in Charakterzüge umgesetzt und somit in die Charakterstruktur integriert werden und folgt somit dem „klassischen“ psychoanalytischen Modell.
Der diesem Syndrom inhärente Narzißmus hat seine Ursache in der ödipalen Konfliktsituation, in welcher der Junge (das Mädchen) die Mutter (den Vater) allein besitzen will, in seinem Vater (Mutter) eine(n) Konkurrenten (-in) sieht und mit ihm (ihr) konkurriert. Dieser Vorgang führt zu Haßgefühlen gegen den gleichgeschlechtlichen Elternteil und setzt ein starkes „Ich“ voraus, daß es dem Kind erlaubt, die ödipalen Wünsche zu verdrängen, und sich später mit dem entsprechenden Elternteil identifizieren zu können. Erst wenn die intrapsychische Struktur im Alter von 5–6 Jahren voll entwickelt ist – dieser Prozeß vollzieht sich parallel mit der vollen Entfaltung der kognitiven Eigenschaften – kann es zur Verdrängung kommen. Kommt es in der frühen diadischen Phase zu einer Störung der Mutter-Kind-Interaktion, so führt dies zu einer schwachen „Ich“-Bildung und somit zur narzißtischen Selbstwertproblematik, Ohnmachtsgefühlen und Allmachtsphantasien.
Der Narzißmus ist im weitesten Sinn als Selbstliebe – die auf den eigenen Körper bezogene erotische Sensibilität – zu verstehen. Von der Psychoanalyse wird die (vorübergehende) Abwendung der Libido von äußeren Objekten als eine Regression (sekundärer Narzißmus) auf die (normale) frühkindliche Lustgewinnung am eigenen Körper (primärer Narzißmus) aber auch als die im „Ich“-Ideal zu findende dauerhafte Selbstliebe des Menschen verstanden[25].
In der Kindheit wird die ursprüngliche Liebe zur Mutter tabuisiert, mit der Folge, daß es aufgrund der unzureichenden Interaktion (Anerkennung) zwischen Mutter und Kind zu keiner narzißtischen Selbstbestätigung kommt. Das Resultat dieser Entwicklung ist ein schwach ausgebildetes „Ich“, ein kaum vorhandenes Selbstbewußtsein und der Haß gegen den Vater. Es formt sich ein „Über-Ich“ mit äußerst rigiden Ansprüchen, verursacht durch die Introjektion der rigiden väterlichen Moralvor-stellungen, welches sich als unvereinbar mit dem „Ich“ herausstellt. Nach Adorno resultiert aus dieser Nichtidentifikation des „Ich“ mit dem „Über-Ich“ unter anderem auch die Unmündigkeit. Diese ist mit verursacht durch die bewußte soziale Repression – vor allem durch das derzeitige Bildungssystem – jeglicher individueller Versuche, sich autonom und kritisch des eigenen Verstandes, im Rahmen des von der Aufklärung postulierten Sinnes, zu bedienen[26].
Durch Reaktionsbildung wird die Aversion in Liebe für den Vater umgewandelt, allerdings gelingt diese Transformation nicht vollständig, wodurch es zu dieser besonderen Art von „Über-Ich“-Bildung kommt und das Kind Orientierung bei anderen Autoritäten sucht. Das Individuum findet soziale Anpassung unter exogenen gesellschaftliche Zwänge nur durch restriktive interne Triebverdrängung; die sadomasochistische Triebstruktur ist daher sowohl Bedingung, als auch Resultat sozialer Assimilation.
Die Flucht ins Autoritäre ist gekennzeichnet durch das Streben nach eigener Unterwerfung auf der einen Seite und Beherrschung anderer auf der anderen Seite. Bei diesem Fluchtmechanismus wird die Unabhängigkeit und Integrität des Selbst aufgegeben, indem sie mit einer heteronomen Macht (Natur, Personen, Institutionen, etc.) fusionieren, der sich unterworfen wird. Oft wird diese masochistische Abhängigkeit, deren Tendenzen den narzißtischen Gefühlen von Minderwertigkeit, Ohnmacht und individueller Bedeutungslosigkeit entspringen, von Betroffenen als Liebe oder Loyalität rationalisiert. Die Neigung sich selbst herabzusetzen und leiden zu machen, kann Ausdruck in der masochistische Perversion oder dem moralischen Masochismus finden. Mit dem Masochismus korreliert, trotz der vermeintlichen Paradoxie, der Sadismus, dessen eine Form darin besteht, andere Objekte von sich abhängig zu machen, um auf diesem Wege absolute Macht über sie zu erlangen. Die zweite Form besteht in dem Impuls, andere auszubeuten und auszunutzen, sowohl in materieller Hinsicht als auch in emotional-intellektueller Hinsicht. Eine weitere Form des Sadismus besteht in dem Verlangen, andere physisch und vor allem psychisch leiden zu sehen.
Die Beziehung des Sadisten zu seinem Objekt ist ebenfalls wie die masochistische eine symbiotische Dependenz-Relation, da sein Gefühl der Stärke lediglich darauf basiert, daß er Macht über andere besitzt. Da die sadistischen Neigungen unbewußt sind, werden sie stärker rationalisiert als die masochistischen Dispositionen. Beiden Ausprägungen sind destruktive Züge inhärent, die im allgemeinen beim Sadismus bewußter und unmittelbarer zum Ausdruck kommen.
Aus psychologischer Sicht resultieren beide Tendenzen aus dem selben Grundbedürfnis, das der Unfähigkeit entstammt, die Isolation und Schwäche des eigenen Selbst zu ertragen. Somit sind diese neurotischen Manifestationen nur Mittel zum Zweck, Sicherheit durch „sekundäre“ Bindungen zu erlangen. Sie müssen als erfolgloser Versuch angesehen werden, den Konflikt zwischen innerer Abhängigkeit und dem Streben nach (positiver) Freiheit zu bewältigen. Im Gegensatz dazu haben „normale“, gut assimilierte Menschen ihr Selbst völlig aufgegeben, um so zu werden, wie man es von ihnen erwartet, Dabei geht ihnen jede genuine Individualität und Spontaneität verloren.
Da sado-masochistische Dispositionen in fast jeder Charakterstruktur vorzufinden sind, müssen sie nicht unbedingt von neurotischer Art sein. Vielmehr hängt es von den speziellen Aufgaben ab, die der Betreffende in einer sozialen Situation zu erfüllen hat und den kulturspezifischen Gefühls- und Verhaltensmuster, um die Charakterstruktur als „pathologisch-neurotisch“ oder „normal“ bezeichnen zu können.
Der Begriff des „autoritären Charakters“ benennt die Persönlichkeitsstruktur, welche die menschliche Grundlage für faschistische Empfänglichkeit bildet. Die Psychodynamik des autoritären Charakters ist geprägt von der Ambivalenz von masochistischer Bewunderung und Unterwerfung unter Autoritäten auf der einen Seite, und dem Wunsch selbst eine Autorität zu verkörpern, andere beherrschen oder unterdrücken zu können – als Sadismus zum Ausdruck kommende, auf Fremdgruppen (die als Ersatz für den gehaßten Vater dienen) projizierte Aggressivität – auf der anderen Seite. „Für ihn setzt sich die Welt zusammen aus Menschen mit und ohne Macht, aus Über- und Untergeordneten. Aufgrund seiner sado-masochistischen Strebungen kennt er nur Beherrschung oder Unterwerfung. Aber niemals Solidarität. Unterschiede bezüglich Geschlecht oder Rasse sind für ihn daher Zeichen der Über-legenheit oder Minderwertigkeit.“ (Fromm, a.a.O., S.129). Der Glaube an die Autorität besteht nur so lange sie stark ist und sich auf Imperative stützt. Sie hilft ihm, sein Gefühl von Ohnmacht zu überwinden, indem er in dieser unanfechtbaren und unveränderlichen Macht aufgeht. Eine besondere Stellung in der, von emotionalen Strebungen bestimmten, autoritären Weltanschauung nimmt das unausweichliche „Schicksal“ ein; sich ihm zu unterwerfen zeugt von „wahren“ Heroismus. Läßt diese Autorität nun Anzeichen von Schwäche erkennen, so verwandelt sich dich ursprüngliche Liebe und Achtung des Individuums in Haß und Verachtung gegen sie. Die gesamte autoritäre Weltanschauung ist in ihrem Wesen nach nihilistisch und relativistisch geprägt.
Die dem autoritären Syndrom kohärente zwanghafte Stereotypie, hat, neben der ökonomischen Komponente der Identifikation mit der eignen Gruppe, die psychologische Funktion das libidinöse Potential – das der anal-sadistischen Entwicklungsphase (Freud) entspringt – dem rigiden „Über-Ich“ unterzuordnen und kann eine stark zwanghafte Handlung nach sich ziehen (religiöse Überzeugungen zeichnen sich oft durch Zwanghaftigkeit und ein starkes Strafbedürfnis aus). Es ist ebenfalls die Disposition zum Aberglauben[27] vorhanden.
Charakteristisch für dieses Syndrom ist die Unzufriedenheit mit dem sozialen Status und die Konformität. Beides war typisch für den unteren Mittelstand in Europa: Nach Horkheimer und Adorno führte, aus historischer Perspektive, die Monopolbildung und Kapitalakkumulation im 19. Jahrhundert zur Deklassierung vieler Selbständiger zu Angestellten. Die damit verbundene wirtschaftliche Verun-sicherung des Vaters reflektiert sich psychologisch im aggressiven Verhalten den Kindern gegenüber wieder. Diese erkennen die Schwäche des Vaters und verachten ihn deswegen. Nach Parson weicht das Verbleichen der Vaterfigur der Dominanz der Muttern verbunden mit deren Vorbildnahme auch durch die Söhne. Diese Identität muß später verdrängt werden, damit sich das Kind mit dem Vater erneut identifizieren kann.
Als Gegentyp des autoritären Syndroms kann das Phänomen des „protestierenden Vorurteilsfreien“ bezeichnet werden, dessen Vertreter (-in) ein starkes, hochentwickeltes „Über-Ich“ aufweist, das nicht nur gegen den eigenen Vater, dessen Werte und Normen das Individuum verinnerlicht hat, sondern gegen jede heteronome Autorität opponiert. Ein völlig autonomes, von äußeren Gesetzen unabhängiges Gewissen ist es, welches das progressive Denken in sozialen Fragen (Aversion von sozialer Ungerechtigkeit, wie z.B. die Manifestation von Rassenvorurteilen) bestimmt. Die solidarische Identifikation mit Minoritäten ist allerdings etwas stereotyp und manchmal mit zwanghaften Zügen behaftet.
Auf der anderen Seite ist für Vertreter (-innen) dieses Syndroms der neurotische Hang, sich mit sich selbst zu beschäftigen – ein Zeichen für Schwächegefühle – sowie die Neigung zur Introversion signifikant. Sie sind unsicher, von Zweifeln und Skrupel geplagt. „Obwohl sie unautoritär denken, sind sie aber verkrampft und daher unfähig, so energisch zu handeln, wie ihr Gewissen es vorschreibt. Sie sind so gehemmt oder sogar psychisch gelähmt, als sei die Verinnerlichung ihres Gewissens zu gut gelungen.“ (Adorno, a.a.O., S. 344). Begleitet wird dies oft durch konformistische Korrektheit in gesellschaftlichen Fragen und Anzeichen sexueller Hemmungen. Zurückführen kann man diese Eigenschaften eher auf psychische als auf rationale Ursachen: auf gravierende Familienkonflikte in der Kindheit, wie z.B. die Scheidung der Eltern und er daraus resultierenden spezifischen Lösung des Ödipuskompexes.[28]
4.4. Der „Rebell“und „Psychopath“ (Rowdy)
Vertreter dieses Syndroms rebellieren gegen die väterliche Autorität, anstatt sich mit ihr zu identifizieren, wobei unter Umständen die masochistischen Tendenzen verschwinden können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die väterliche Autorität durch eine andere zu ersetzen. Diese, allen Vorurteilsvollen gemeinsame, Eigenschaft einer veräußerlichten „Über-Ich“-Struktur, läßt die autoritäre Struktur im wesentlichen unberührt.
Verbleiben die masochistischen Tendenzen gegenüber der Autorität hingegen auf unbewußter Ebene, so führt das Opponieren auf manifester Ebene zu einem besonders destruktiv geprägten irrationalen und starren Haß gegen jede Art von Autorität. In diesem Fall substituiert das Individuum seine Abhängigkeit lediglich durch negative Übertragung, verbunden mit dem Drang gegen Schwächere vorzugehen. Da diese Reaktion psychologisch im Grunde kaum von der echt unautoritären zu differenzieren ist, sind die Hauptkriterien dafür allein das politische und soziale Verhalten.
Charakteristisch für diesen Typ ist der Hang zum exzessiven Ausleben der Triebe (Es), wie z.B. übermäßiges Trinken, Homosexualität und die Bereitschaft zu Gewalttaten. Die extremste Ausformung dieses Syndroms repräsentiert der „Rowdy“ (in der psychiatrischen Terminologie der „Psychopath“), der sich durch Infantilität und Asozialität auszeichnet. Dies hat seine Ursache in einem, durch die Folgen der Ödipuskonfliktes völlig verkümmerten „Über-Ich“ und der daraus resultierenden Regression auf Omnipotenzphantasien der frühesten Kindheit. Sein Sadismus richtet sich vorurteilslos gegen jedes hilfloses Opfer. In religiösen Glaubensfragen gebärt er sich als Fanatiker, der sich nicht an die bestehenden Gesetze und Normen hält. Seine Haupteigenschaft liegt in der Ungeduld, seine Lust zu befriedigen, ein Zeichen für eine ebenfalls schwache „Ich-Bildung“; er ist ein Narzißt. Die masochistische Komponente und das daraus resultierende Strafbedürfnis liegen ebenfalls in der Ödipussituation begründet: Da es dem Individuum unmöglich erscheint sich eine postödipale Anpassung eigen zu machen, kann es den daraus resultierenden – als Schuld empfundenen – Vatermord- und Inzestphantasien nur durch Buße begegnen. „Daß solche Handlungen eine Art >>neurotischen Gewinn<< darstellen, muß dabei auch berücksichtigt werden. Die Tatsache, daß Strafe gesucht, empfangen und akzeptiert wird, ist aber nicht alles: sie beziehen aus dem Strafakt unmittelbar noch narzißtischen >>Gewinn<< als Surrogat für das ursprüngliche Bedürfnis. All das vollzieht sich natürlich im Unterbewußtsein, ist nicht direkt zu belegen, aber stets wahrzunehmen“[29].
Dieses Syndrom spielte im nationalsozialistischen Deutschland eine bedeutende Rolle: die Bereitschaft, jedem Führer zu folgen, resultierte aus der außergewöhnliche Anfälligkeit für jede Art von Propaganda. Sie waren wirtschaftlich entwurzelte Nihilisten, überzeugt davon, daß es nicht das Leben selbst sei, worauf es ankomme, sondern eine „Chance“. Aus ihren Reihen stammte das Potential, aus welchem sich die SA ihre Schläger rekrutierte.
Das Ziel der (u.a.) diesem Syndrom inhärenten Destruktivität ist nicht die Symbiose mit dem Objekt, sondern dessen Zerstörung. Durch die Beseitigung jeglicher Bedrohung durch die Außenwelt wird dem atomisierten Individuum geholfen seine Ohnmacht und Isolierung erträglich zu machen. Derartige, nicht unmittelbar bewußte, Impulse werden oft als Liebe, Pflicht, Gewissen oder ähnliches rationalisiert. Können andere Personen oder heteronome Dinge nicht als Objekte der Destruktivität eines Menschen lokalisiert werden, besteht die Tendenz zur Umwandlung von Feindseligkeit in Autodestruktivität. Die Hauptursache für den Destruktivismus ist in der Angst vor der „Vereitelung des Lebens“ (Fromm; a.a.O.; S. 133ff.) – die Unterdrückung bzw. Versagung der persönlichen, sinnlichen, emotionalen, intellektuellen, spontanen und kreativen Fähigkeiten – und nicht in der Versagung von einzelnen triebhaften Wünschen zu suchen.
Freud gelangte in einer seiner späteren Theorien zu der Einsicht, daß es in jedem Menschen zwei bestimmende Grundstrebungen gebe: ein auf das Leben ausgerichteter Trieb, welcher der sexuellen Libido entspricht, und den Todestrieb, der auf die Vernichtung des Lebens abzielt. Dieser Todestrieb sei ein notwendiger und unabänderlicher Teil des Lebens, der einer biologischen Veranlagung entstammst und die Ursache der Destruktivität bildet. Doch scheint diese Theorie nicht hinreichend genug, da sie nicht ausreichend berücksichtigt, daß das Ausmaß der Destruktivität bei differenten Menschen und sozialen Gruppen oft stark variiert. So fand sie im Charakter des Kleinbürgertums in Europa größere Verbreitung, als etwa in den oberen Schichten oder der Arbeiterklasse. Vielmehr scheinen die beiden Grundstrebungen in einem besonderen Kausalverhältnis zu stehen: „Anders gesagt, der Lebenstrieb und der Destruktionstrieb sind nicht voneinander unabhängige Faktoren, sondern sie stehen in einem umgekehrten Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Je mehr der Lebenstrieb vereitelt wird, um so stärker wird der Zerstörungstrieb; je mehr Leben verwirklicht wird, um so geringer ist die Kraft der Destruktivität. Destruktivität ist das Ergebnis ungelebten Lebens“ (Fromm; a.a.O.; S. 136)[30]. Für das Aufkommen des Nazismus spielte die Destruktivität eine entscheidende Rolle, da dieser an die destruktiven Tendenzen in den Menschen appellierte und für seine Zwecke instrumentalisierte.
Analog zum „psychotischen H“ existiert der „impulsive Vorurteilsfreie“, repräsentiert durch völlig angepaßte Personen, deren starkes „Es“ niemals mit dem „Ich“ und dem „Über-Ich“ integriert werden konnte. Sie sind Vorurteilen abgeneigt, was ein Ausdruck der libidinösen Veranlagung ist und aufgrund ihres Einfühlungsvermögens zu konsistenter und radikaler Gesellschaftskritik fähig. Den „Impulsiven“ scheint ein geschwächtes „Ich“, „Über-Ich“ und daraus resultierend eine gewisse Labilität eigen, es besteht die potentielle Gefahr psychotischer und schizoider Tendenzen. „Dieses Syndrom erstreckt sich von den Libertins über die >>Süchtigen<< jeder Art und bestimmte asoziale Charaktere wie Prostituierte und nicht gewalttätige Kriminelle bis zu gewissen Psychopathen.“ (Adorno; a.a.O.; S. 348).
4.5. Der „Spinner“
Allgemein bezeichnend für das autoritäre Syndrom ist die Frustration, die in der ständigen Unter-drückung des „Es“ durch die Introjektion der väterlichen Moralvorstellungen begründet liegt. Vertretern dieses Syndroms ist es nicht gelungen sich das Realitätsprinzip eigen zu machen; sie setzen der Realität, die durch Vorurteile degradiert wird, emphatisch eine innere Scheinwelt entgegen, die sie erhöhen. Daraus resultiert das pathologische Gefühl innerer Überlegenheit und der ständige Versuch Eindruck auf andere machen zu wollen. Die Ursache dafür ist in der Triebversagung – sowohl in der Kindheit als auch im späteren Leben – durch die Außenwelt zu suchen. Der von strengen Tabus gequälte „Spinner“ ist gekennzeichnet durch Projektivität, Mißtrauen, Beziehungswahn (die übermäßige Relevanz von innerem Rang und äußerem Status), Paranoia und einer Affinität zur Psychose. Die Stereotypie ist, gleich einem religiösen Glauben, institutionalisiert worden und dient der Bestätigung der eigenen Projektivität. So weist der Haß in Rassenfragen paranoide Tendenzen auf und ist gegen jede nur erdenkliche Minorität gerichtet. Der geäußerte Antisemitismus wurzelt in einer falschen Mystifizierung des Blutes, der Projektion und dem sexuellen Neid. Vergleichbar mit dem Stadium des Fanatismus, für das er besonders anfällig erscheint, ist seine Zwanghaftigkeit. Weitere charakteristische Eigenschaften für dieses Syndrom sind den anderen Gruppen willkürlich unterstellte Konspirationsideen, die Halbbildung und der fast magische Glauben an die Naturwissenschaften, welcher von besonderer Anfälligkeit für etwaige Rassentheorien zeugt. Neben der ihnen eigenen Isolation ist ebenso die Nichtintegration in den ökonomischen Produktionsprozeß signifikant für den „Spinner“. Vorzufinden ist dieses Syndrom innerhalb einer bestimmten pseudo-intellektuellen Gruppierung, oberhalb deren Bildungsniveau – genau wie unter der Arbeiterschaft – es nicht vorzufinden ist. Obwohl dieses Syndrom kulturell nur untergeordnete Bedeutung hat, ist es für die Individualpsychologie von bedeutender Relevanz. Dem „Spinner“ kann, ähnlich wie dem „konventionellen“ Syndrom, kein Gegentypus zugeordnet werden.
4.6. Der „manipulative“ Typus
Dieser potentiell gefährlichste Typus ist gekennzeichnet durch eine extreme Stereotypie, bei der emphatisch die Eigen- der Fremdgruppe gegenübergestellt wird. Das Prinzip, die Welt durch schematische, administrative Bereiche zu ordnen, ist das Bestimmende. Dieses (politische) Freund-Feind-Denken beinhaltet totalitäre und destruktive Implikationen; der Antisemitismus ist verdinglicht. Bezeichnend für dieses Syndrom ist die Unfähigkeit, emotionale Beziehungen einzugehen, (derartige Impulse werden unterdrückt) und die Sucht die Natur beherrschen zu wollen. Freundschaft existiert nicht; an dessen Stelle steht die Loyalität, gleichbedeutend mit der absoluten und bedingungslosen Identifikation, unter Aufgabe jeglicher Individualität, mit der Eigengruppe. Eindeutig schizophrene Tendenzen sind zu erkennen, welche nicht durch die übliche Introversion begründet sind, sondern durch einen zwanghaften Überrealismus; dem Verlangen, alles auf das Objekt zu reduzieren, welches nach Belieben manipuliert werden kann, Der manipulative Aspekt erstreckt sich oft auch auf die Berufswahl. Auf diesen manipulierbaren Dingen und Objekten haftet auch die Libido des Individuums, während er sie gleichzeitig als vollkommen gefühllos und unbeteiligt erachtet und ihnen pathologisch-gleichgültig gegenübersteht.
Der zwanghafte Sadismus (Freud: „analer Charakter“) unterscheidet sich vom „autoritären Syndrom“ durch das Nebeneinander von einer bestimmten Hohlheit und Oberflächlichkeit und einem extremen Narzißmus. „Symbolhaft für die vielen Vertreter dieses Syndroms unter antisemitisch-faschistischen Politikern ist Deutschland ist Himmler. Ihre nüchterne Intelligenz und die fast komplette Absenz von Affekten macht sie wohl zu denen, die keine Gnade kennen. Da sie alles mit den Augen des Organisators sehen, sind sie prädisponiert für totalitäre Lösungen. Ihr Ziel ist eher die Konstruktion von Gaskammern als das Progrom. Sie brauchen die Juden nicht einmal zu hassen, sie „erledigen“ ihre Opfer auf administrativem Weg, ohne mit ihnen persönlich in Berührung zu kommen.“ (Adorno, a.a.O., S.335). Das diesem Syndrom inhärente besessene Interesse am Sexuellen und die erhebliche Differenz zu deren Erfahrung hat seine Ursache in einem schwerwiegenden seelischen Trauma in der prägenitalen Phase. In metaphysischen Überzeugungen ist häufig eine naturalistisch-nihilistische Einstellung zu verzeichnen.
Der antagonistische Gegentypus zum „manipulativen“ Syndrom (H) ist der „ungezwungene Vorurteilsfreie“ (N). Diesem Syndrom ist die Eigenschaft der Aversion zur Gewaltbereitschaft inhärent, sowie die Furchtlosigkeit vor Frauen, resultierend aus einer weitgehend konfliktfreien und von weiblichen Figuren dominierten Kindheit. Die Absenz von allgemeiner Aggressivität, auch dem Vater gegenüber, entspringt einem gut entwickelten „Über-Ich“, ebenso wie die Angst jemanden zu verletzen und die neurotische Unentschlossenheit bzw. Entscheidungsunfähigkeit. Wenn auch der Wunsch nach Sicherheit artikuliert wird, ist dieser Typus weitgehend frei von dem Streben nach materieller Bereicherung. „Sie sind nicht neidisch und nicht unzufrieden. Sie zeigen einen gewissen inneren Reichtum, das Gegenteil von Zwang, die Fähigkeit zu genießen, Phantasie und Sinn für Humor, der manchmal zur Selbstironie wird, Doch ist diese Selbstironie ebenso wenig destruktiv, wie ihre übrige Haltung; die scheint die Bereitschaft derjenigen, die – nicht aus neurotischem Zwang, sondern aus einem starken Gefühl innerer Sicherheit – die eigenen Schwächen bekennen.“ (Adorno, a.a.O., S. 350).
Erklärt werden kann dieses Phänomen nur durch eine dynamische Charakterstruktur, bedingt durch die Absenz träumerischer Erlebnisse und Defekte, in der keine der Freudschen Kontrollinstanzen erstarrt oder dominierend (analog: regressiv) erscheinen. Der Verdacht einer Regression auf eine infantile Entwicklungsstufe ist nur ein oberflächlicher Eindruck. Da den „Ungezwungenen“ die Subsumtion unter Stereotypen, Gewalttätigkeit sowie politischer Radikalität völlig fremd erscheinen, gehören sie zu denen, die besonders immun gegen politischen oder psychischen Faschismus sind, wenngleich von ihnen keine konkreten Aktionen dagegen zu erwarten wären.
Soziologisch betrachtet, findet dieses genuine Volkselement vor allem im unteren Mittelstand Verbreitung. Der „ungezwungene Vorurteilsfreie“ ist mit dem „protestierenden Vorurteilsfreien“ der am häufigsten vorkommende Typus dieser Kategorie.
4.7 Der „genuine Liberale“
Der „genuine Liberale“ kann keinem der vorurteilsvollen Syndrome gegenübergestellt werden; er teilt einige Merkmale mit anderen vorurteilsfreien Syndromen. Vertreter dieses Typus können als ausgeprägte Individualisten mit einem starken Sinn für Autonomie und Unabhängigkeit und mit Interesse am Ästhetischen bezeichnet werden. Durch ihre besondere Ungehemmtheit und Offenheit in Reaktionen und Ansichten kommt ihre Zivilcourage oftmals entgegen jeglichen rationalen Bedenken zum Ausdruck. Emphatisch identifizieren sie sich mit Minoritäten, bedingt durch ihre persönliche Auffassung vom Individuum, ohne zwanghafte oder überkompensierende Tendenzen. „Minderheiten müssen die gleichen Rechte haben wie Mehrheiten, sie sind ja auch nur Menschen und sollen genauso viele Rechte haben wie die Mehrheit. Es sollte nur Individuen geben, und sie sollten als Individuen beurteilt werden.“ (Adorno, a.a.O., S. 355). Hauptbestandteil ihrer Liebe ist vor allem das Mitgefühl mit dem Subjekt und nicht das Verlangen nach dem Objekt. In der Charakterstruktur herrscht ein ideales Gleichgewicht zwischen „Ich“, „Über-Ich“ und „Es“. Sie sind selten narzißtisch; das nicht libidinös besetzte „Ich“ ist gut entwickelt, während „Es“-Tendenzen bereitwillig zugegeben und die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden[31].
5. Die Psychologie des Nazismus
5.1. Die psychologischen Bedingungen
Der Nazismus ist ein psychologisches Problem, dessen psychologische Faktoren man aus dem sozio-ökonomischen Kontext heraus verstehen muß. Aus dieser Tatsache ergibt sich die Problematik der Charakterstrukturen der Menschen die ihm folgten und die der psychologischen Merkmale der Ideologie selbst. Betreffend der Persönlichkeitsstrukturen muß differenziert werden zwischen den aktiven Anhängern, die sich stark vom Nazismus angezogen fühlten und jenen, die sich dieser herrschenden Ideologie beugten, ohne wesentlichen Widerstand zu leisten, obwohl sie nicht zu deren Bewunderern gehörten. Psychologisch ist diese Passivität auf eine innere Müdigkeit und Resignation zurückzuführen, resultierend aus dem Zweifel am Wert einer politischen Organisation und Aktivität und dem Mißtrauen gegen ihre Führer (dies galt u.a. für die Arbeiterschaft). Weitere Beweggründe waren die Angst vor der Isolierung und die relative Schwäche moralischer Prinzipien, die jeder Partei helfen den Großteil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, wenn sie erst einmal an der Macht ist.
Im Gegensatz zur Arbeiterschaft und dem liberalen und katholischen Bürgertum, die eine ablehnende und resignative Haltung zur Nazi-Ideologie einnahmen, wurde sie vom Kleinbürgertum, das sich aus Geschäftsleuten, Handwerkern und kleinen Angestellten zusammensetzte, bereitwillig akzeptiert. Die Affinität des Kleinbürgertums zu dieser Ideologie ist im Gesellschaftscharakter dieser sozialen Schicht zu suchen. Typische Charakterzüge waren unter anderem der Übertriebene Respekt (Vorliebe) vor der Autorität und damit kohärierend der Haß auf die Schwachen, die Pedanterie, eine gewisse Feindseligkeit und vor allem das Prinzip der Sparsamkeit – sowohl in wirtschaftlicher als auch in psychologischer Hinsicht. Ebenfalls wichtige Faktoren waren der Zusammenbruch der Monarchie und der Verlust des Ersten Weltkrieges. Die Autorität der Monarchie und der Religion, sowie die Stellung der Familie vermittelten dem Einzelnen das sichere Gefühl einen festen Platz in einem stabilen sozio-kulturellem System zu besitzen. Loyalität und Unterwürfigkeit gegenüber der Autorität waren für ihn eine befriedigende Lösung seiner masochistischen Strebungen, Nach dem Krieg veränderte sich die ökonomische Situation außerordentlich; die Inflation, die 1923 ihren Höhepunkt erreichte und die Wirtschaftsdepression des selben Jahres verstärkten die psychologischen Probleme des alten Mittel-standes. Der Niedergang der alten gesellschaftlichen Autoritätssymbole wie Monarchie und Kirche hatte auch Einfluß auf die individuelle Autorität der Eltern, so daß die letzte Instanz der Sicherheit, die Familie, ebenfalls ins Wanken geriet. Die daraus erwachsende gesellschaftliche Frustration – vor allem im Kleinbürgertum – führte zur Rationalisierung bzw. Projektion der eigenen sozialen Benachteiligung auf die Benachteiligung der Nation und somit zur Aversion des Versailler Vertrages.
Diese psychologischen Bedingungen waren nicht die Ursache des Nazismus, sondern nur die menschliche Basis, auf der er sich entwickeln konnte. Für die weiter Analyse des Nazismus muß man sich auch mit den rein ökonomischen und politischen Ursachen auseinandersetzen.
5.2. Die wirtschaftlichen und politischen Ursachen
In der Weimarer Republik sah sich die besitzende Klasse einem Reichstag gegenüber, in dem 40% der Delegierten sozialistische oder kommunistische Gruppen repräsentierten, welche mit dem bestehenden Gesellschaftssystem unzufrieden waren. Die Vertreter des deutschen Kapitalismus, Großindustrielle und die halb-feudalen Großgrundbesitzer fürchteten um ihre wirtschaftlichen Interessen und Privilegien. Sie erhofften sich durch Unterstützung Hitlers – ohne die er niemals an die Macht gekommen wäre -, daß er den sie bedrohenden emotionalen Unwillen umleiten und gleichzeitig das Volk in den Dienst ihrer eigenen ökonomischen Interessen stellen würden. „Aber während die Nazis alle anderen Schichten der Bevölkerung wirtschaftlich entschädigten, dienten sie den Interessen der wichtigsten Machtgruppen des deutschen Industrie. Das Nazi-System ist die „Stromlinienform“ des deutschen Vorkriegsimperialismus und setzt den Weg da fort, wo die Monarchie gescheitert war“. (Fromm; a.a.O.; S. 160).
5.3. Die Ideologie
Dem Nazismus waren niemals irgendwelche genuin politischen oder wirtschaftlichen Prinzipien inhärent; sein eigentliches Prinzip war ein radikaler Opportunismus. Er zog seine Vorteile aus den tiefen psychologischen Wirkungen der sozio-ökonomischen Veränderungen, besonders dem Nieder-gang des Mittelstandes, der wachsenden Macht des Monopolkapitalismus und dem daraus resultierenden Verlagen nach Unterwerfung, sowie nach Beherrschung der Machtlosen. Da Hitler ein typischer Vertreter des Kleinbürgertums war – mit der gleichen autoritären Charakterstruktur -, konnte er sich emotional und gesellschaftlich mit ihm identifizieren (bzw. vice versa). Durch die politische Ideologisierung und die so geweckten psychischen Kräfte, wirkte der Nazismus letztendlich den ursprünglichen ökonomischen Interessen dieser Bevölkerungsschicht entgegen; sie verlor ihre alte soziale und ökonomische Stellung, bei gleichzeitiger emotional-psychologischer Befriedigung ihrer sado-masochistischen Strebungen.
Die nationalsozialistische Ideologie gründete sich in erster Linie auf Hitlers Autobiographie „Mein Kampf“, welche eine ausgesprochen repräsentative Illustration des autoritären Charakters darstellt und somit für die Analyse des Nazismus prädestiniert ist. Eine außerordentlich bedeutende Rolle bei der Verbreitung der Ideologie spielte die Propaganda. Hitlers sadistisches Streben nach Macht über die Massen, das bei ihm identisch mit dem Selbsterhaltungstrieb war, fand unter anderem Ausdruck in seiner Beziehung zum Volk – das er zugleich liebte und verachtete – und der destruktiven Einstellung seinen politischen Gegnern gegenüber, die vernichtet oder bedingungslos unterworfen werden sollten. Für die Rationalisierung seines Machtstrebens bediente er sich des Begriffes einer höheren Macht (die Natur, die Geschichte, Gott oder das Schicksal), dessen irdischer Verfechter er sei und der auch er sich unterzuordnen habe. Der Wille zur Macht, der die Nazi-Führer und -Eliten beseelte, sei in den ewigen Gesetzen der Natur begründet die sie erkannt haben und befolgen. Darwins Theorie „Der Kampf ums Dasein“, dem selbst kein sado-masochistischer Charakter inhärent ist, wurde für diesen Zweck populistisch mißbraucht, Hitler projizierte den Grundsatz, daß die natürliche Selektion zur Dominanz des Stärkeren über die Schwächeren führe, auch auf den ökonomischen Gesamtprozeß, wodurch er für die liberalen Grundsätze eines uneingeschränkten Wettbewerbes eintrat. Dem Volk seinerseits wurden als Objekte des auslebbaren Sadismus politische und rassistische Minderheiten dargeboten, die als schwach und dekadent bezeichnet wurden, und welche es zu beherrschen galt. Unverhohlen äußerte sich dies im offen artikulierten Wunsch nach Weltherrschaft, die nur zum Besten der unterworfenen Völker sei und zu der Kultur der Welt beitrage.
Eine weitere Rationalisierung für seinen Sadismus findet sich in der Verteidigung des „unschuldigen“ deutschen Volkes gegen die „bösen und aggressiven“ Angriffe anderer; durch Propagandalügen – welche die gleiche emotionale Aufdringlichkeit wie paranoide Beschuldigungen besaßen - wurden den Gegnern Eigenschaften zugeschrieben, die auf der anderen Seite als die eigenen Ziele proklamiert wurden. Dieser Abwehrmechanismus hatte die Aufgabe, den eigenen Sadismus und die eigene Destruktivität zu verbergen, Der außerordentliche Propagandawert resultierte aus der dem Kleinbürgertum inhärenten ähnlichen autoritären Charakterstruktur und der damit korrelierenden Anfälligkeit für solche paranoiden Anschuldigungen.
Hitler verachtete alle Machtlosen, die versuchten gegen eine bestehende Macht zu opponieren, selbst wenn dies aus den gleichen politischen Motiven heraus, wie z. B. der Kampf um die nationale Freiheit heraus geschah. Für den sado-masochistischen Charakter typische Eigenschaften, wie die Liebe zu dem Mächtigen und der Haß auf die Machtlosen, können viele der politischen Handlungsweisen Hitlers und seiner Gefolgschaft erklären. „Hitler haßte die Weimarer Republik, weil sie schwach war, und er bewunderte die Großindustriellen und Militärs, weil sie über Macht verfügten. Er hat nie gegen eine etablierte starke Macht gekämpft, sondern immer nur gegen Gruppen von denen er annahm, daß sie im Grunde schwach waren.“ (Fromm; a.a.O.; S.168f.).
Die masochistische Seite der Ideologie, das Verlangen, das Selbst auszulöschen und sich einer starken Macht unterzuordnen, fand Ausdruck in der ständigen Indoktrination des Einzelnen, er solle seine persönliche Bedeutungslosigkeit akzeptieren, sich in einer höheren Macht auflösen und stolz darauf sein an deren Stärke teilhaben zu dürfen. In der Phrase „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ spiegelte sich die geforderte individuelle Atomisieren, der Verzicht auf das Recht die eigenen Interessen, die individuelle Meinung und das eigene Glück zu vertreten wieder. Diese Philosophie der Selbstver-leugnung und des Opferbringens – welche von der Schule an internalisiert werden sollte – diente lediglich dem Zweck, dem Volk klarzumachen, daß es verzichten und sich unterordnen muß, damit der Führer und die nationalsozialistische Elite ihr Machtstreben verwirklichen können. Für Hitler war von den o.g. höheren Mächten vor allem die Natur jene herausragende Größe, der es sich zu unterwerfen galt. Während die Menschen hingegen (als Ausdruck der evolutorischen Entwicklung) beherrscht werden durften und mußten.
Doch die nationalsozialistische Ideologie befriedigte nicht allein die Wünsche und Sehnsüchte des Kleinbürgertums; mit ihren politischen Methoden setzten die Nazis das in die Praxis um, was ihre Ideologie versprach. Sie errichteten eine Hierarchie, in der sich jeder einem anderen unterzuordnen hatte, und andererseits jeder jemanden unter sich hatte, über den er herrschen bzw. Macht ausüben konnte. „Denen aber, denen der Genuß über andere zu herrschen und sie sich zu unterwerfen, versagt blieb und die resigniert dem Glauben ans Leben, an ihre Selbstbestimmung und alles übrige verloren haben, gibt sie eine Richtung an und eine Orientierungsmöglichkeit.“ (Fromm; a.a.O.; S. 172). Somit befriedigte der Nazismus, angesichts dieser psychologischen Situation, die emotionalen Bedürfnisses der Bevölkerung und hat somit primär eine psychologische Funktion. Man kann die Funktion einer autoritären Ideologie und Praxis mit der Funktion neurotischer Symptome vergleichen; sie resultieren beide aus einer unerträglichen psychologischen Situation und stellen einen Lösungsversuch dar, der das Weiterleben ermöglicht. Die Ursache für diesen Prozeß liegt in der dynamischen menschlichen Natur begründet, welche das Individuum veranlaßt nach befriedigenden Lösungen zu suchen und soweit eine Möglichkeit besteht diese zu erreichen. Da allerdings die – für die neurotische Lösung notwendigen – Bedingungen unverändert bleiben, führt diese weder zum Glück, noch zur Entfaltung der Persönlichkeit. Die Flucht in eine symbiotische Bindung kann das Leiden temporär mindern, aber sie kann es nicht beseitigen.
6. Epilog
Die Nachhaltigkeit, mit welcher die mit Herrschaft und Ökonomie verknüpfte Rationalisierung als Ursache antisemitischer und autoritätsunterwürfiger Verhaltensweisen benannt wird, zeugt von der Überzeugung der Autoren, daß sich die Aufklärung in ihr Gegenteil verkehrt hat. Vernunft hat sich in eine praktischer, instrumenteller Art verwandelt. Sie dominiert nicht nur die Ökonomie sondern das Denken selbst und manifestiert sich in positivistischem, deduktivem, stereotypem, pragmatischem und nicht-transzendierendem Reflektieren. Durch die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, mit all ihren immanenten Begleiterscheinungen, wird den Individuen die Fähigkeit zur kritischen Reflexion und Vernunft genommen. Die ökonomischen Zwänge der Warenförmigkeit und wissen-schaftlichen Betriebsführung durchdringen selbst die letzten Bereiche des sozialen Lebens, welche sich der autopoietischen Kulturanforderungen nicht entziehen können. Bis in die Familie, als dem letzen Zufluchtsort der Individuen, reicht der Einfluß der Mechanismen sozialer Herrschaft und Kontrolle mit der Folge einer Nivellierung des Denkens und weitreichender Konformität. Die ohn-mächtigen Subjekte werden ihrer Subjektivität beraubt und entfremden sich dadurch nicht nur von dem Arbeitsprozeß, sondern vor allem von einander. Die gegenwärtig beobachtbaren Pathologien der Moderne erscheinen als ein notwendiges, dialektisches Moment der ausgehenden Aufklärung, ihrer eigenen inhärenten Logik. Die Loslösung aus tradierten Bindungen hat es den Individuen nicht erlaubt sich ihrer neu gewonnen Freiheiten bewußt zu werden, um sie in positivem Sinne autonom, spontan und in Liebe zueinander zu gestalten. Vielmehr sehnen sie sich nach Sicherheit versprechenden Beziehungen zurück und neigen zur Unterwerfung unter autoritäre Wertesysteme jeglicher Art oder suchen sich Fluchtmechanismen, welche dem Subjekt individuell Linderung versprechen. Auch wenn diese – wie auch immer gearteten - Manifestationen sich als kulturell wertvoll erweisen, so können sie dennoch nicht über ihren repressiven Charakter hinwegtäuschen. Kultur oktroyiert ihren Mitgliedern einen rigiden Verzicht von Triebbefriedigung auf, an welchem sie zu verzweifeln und zu zerbrechen drohen.
Offen bleibt nun die Frage, wie die Überwindung der Idiosynkrasie bewerkstelligt werden könnte, von welcher die Emanzipation der Gesellschaft vom Antisemitismus abhängt. Wie kann die selbstver-schuldete Unmündigkeit der Menschen überwunden werden und die Individuen in ihrer Existenz als Subjekte gestärkt werden?
Die Unmündigkeit scheint in unseren heutigen, sowohl familiären als auch den institutionellen, Erziehungsmethoden begründet zu liegen. Bereits in den Anfängen der menschlichen Sozialisation finden sich jene Bedingungen, welche die Fähigkeit zum kritischem Denken und selbständigen Entscheiden unterbinden und dadurch den Grundstein für die allgemeine Konformität legen, in welcher Anpassung prämiert und Widerspruch sanktioniert wird. Angesichts der Prämisse, daß Autoritätsunterwürfigkeit als Charaktereigenschaft, sowohl aus der elterlichen Erziehung, den sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, als auch der spezifischen ödipalen Konfliktsituationslösung resultiert, scheint der Schwerpunkt einer formativen Prophylaxe gegen Vorurteile, Faschismus und Antisemitismus, auf die familiäre und institutionelle, pädagogische-edukative Aufklärung gesetzt werden zu müssen. Notwendig wäre eine weitreichende Bildungsreform hin zu einer Erziehung zu Widerstand und Widerspruch und nicht zu Konformität und Gehorsam. Die Bedeutung von Bildung müßte, unabhängig von deren ökonomischer Verwertbarkeit, neu bewertet und diskutiert werden. Es müßte ein Bewußtsein geschaffen werden, daß (humanistische) Bildung der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und kognitiven Fähigkeiten dient und somit für alle erstrebenswert sei. Angesichts der Tatsache, daß aufgeklärte Menschen mit einem hohen Bildungsniveau (implizit eine höhere moralische Entwicklungsstufe) häufiger Ungehorsam sind als „Ungebildete“[32], brauchen wir ein differenziertes Schulwesen, „in dem die Breite der Angebote entsprechende Lernmotivation erzeugt, in der nicht Auslese nach falschen Begabungsbegriffen erfolgt, sondern eine Förderung unter Überwindung entsprechender sozialer Hindernisse durch kompensatorische Erziehung (...)“ ermöglicht[33]. Auf diese Art und Weise könnten die ersten Grundvoraussetzungen für den Schritt aus der Unmündigkeit gelegt werden. Denn „Freiheit bedeutet zuerst sie auszuhalten“.
7. Bibliographie
- Adorno, Th.W. (1950); Studien zum autoritären Charakter; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973.
- Adorno, Th.W.; Erziehung zur Mündigkeit, Vorträge und Gespräche mit H. Becker 1959-1969; ed. Gerd Kadelbach; Frankfurt/M. 1970.
- Adorno, Th.W.; Theorie der Halbbildung, In: Soziologische Schriften Bd.1; Gesammelte Schriften; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1972.
- Adorno, Th.W.; Soziologie und Empirische Forschung, In: Adorno, Th.W., et al.; Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie; Luchterhand, Neumied 1969.
- Bundeszentrale für politische Bildung; Argumente gegen den Haß. Über Vorurteile, Fremden-feindlichkeit und Rechtsextremismus. Bd. II: Textsammlung.
- Beck, Ulrich; Risikogesellschaft – auf dem Weg in eine andere Moderne; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1986.
- Freud, Sigmund; Gesammelte Werke Bd. XIII; Jenseits des Lustprinzips. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Das Ich und das Es, Frankfurt, 1999.
- Freud, Sigmund; Gesammelte Werke Bd. XIV. Werke aus den Jahren 1925-1931; Frankfurt, 1999.
- Fromm, Erich; Anatomie der menschlichen Destruktivität; Stuttgart, 1974.
- Fromm, Erich (1941); Die Furcht vor der Freiheit; dtv, München 1990.
- Fuchs-Heinritz, Werner (Hrsg.) et al.; Lexikon zur Soziologie; Westdeutscher Verlag, Opladen 1994.
- Horkheimer, Max (1972); Traditionelle und kritische Theorie; Fünf Aufsätze; Erweiterte Neuausgabe; Fischer Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/M. 1992.
- Horkheimer, Max u. Adorno, Th.W. (1944); Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente; Gesammelte Schriften, Bd.3; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973.
- Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.); Meyers großes Taschenlexikon; Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, Mannheim 1995.
- Milgram, Stanley; Das Milgram-Experiment zur Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autoritäten; Rowohlt, Reinbeck bei München 1982.
- Korte, Hermann; Einführung in die Geschichte der Soziologie; UTB/Leske & Budrich, Opladen 1995.
- Ritsert, J.; Gesellschaft – Einführung in den Grundbegriff der Soziologie; Frankfurt 1988.
[...]
[1] Horkheimer, Max (1944); Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente; Gesammelte Schriften, Bd. 3; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973.
[2] Adorno, Theodor W. (1950); Studien zum autoritären Charakter; Frankfurt a. M. 1973.
[3] In der ödipalen, der Latenz vorausgehenden infantilen, Entwicklungsphase sind nach psychoanalytischer Auffassung inzestuöse, aus der libidinösen Bindung an den jeweils gegengeschlechtlichen Elternteil herzu-leitende Triebregungen vorherrschend, deren (Un-) Befriedigung oft als Ursache später auftretender Neurosen, Perversionen oder der sexuellen Inversion betrachtet wird. Die ödipale Komponente entwickelt sich im Alter zwischen 3 und 6 Jahren, wobei die diadische (Mutter-Kind) von der triadischen (Vater-Mutter-Kind) Interaktion abgelöst wird.
[4] Freud, S.; Das Unbehagen in der Kultur; in: Gesammelte Werke Bd. XIV. Werke aus den Jahren 1925-1931.
[5] Fromm, Erich (1941); Die Furcht vor der Freiheit; München, 1990.
[6] Weitere Auswege um Ersatzbefriedigung zu erhalten besteht einerseits in der Flucht in die neurotische Krankheit, welcher meist schon in jungen Jahren vollzogen wird; in die Liebe oder in ästhetische Einstellungen andererseits. Hierbei ist neben den äußeren Verhältnissen stets die persönliche psychischen Konstitution des Individuums entscheidend bei der „Wahl“ des einzuschlagenden Weges.
[7] Ein weiterer Konflikt besteht nach Freud darin, daß die Kulturarbeit den Männer, welche hauptsächlich solche Arbeiten verrichten, eine zweckmäßige Verteilung der Libido zu Ungunsten der Frauen und des Sexuallebens aufzwingt. Das beständige Zusammensein mit Männern, seine Abhängigkeit von den Beziehungen zu ihnen entfremden ihn sogar seinen Aufgaben als Ehemann und Vater.
[8] Horkheimer, Max u. Adorno, Th.W. (1944); Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente; Gesammelte Schriften, Bd.3; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973; S. 151.
[9] Nach Descartes ist die Existenz der Wirklichkeit, einer externalen Außenwelt, nicht beweisbar: von der Empfindung, deren Bewußtseinsereignis - in Form von Sinnesdaten - unmittelbar evident ist, kann nicht auf etwas empfindungsunabhängiges geschlossen werden. Es gibt keine Beweismöglichkeit dafür (Position des „hypothetischen Realismus“). Man kann an allem zweifeln, außer am Zweifel selbst.
[10] Physisches Dingsein entspricht einem Komplex von aktuellen und möglichen Sinnesdaten (Berkeley).
[11] Das Gedächtnis ist die Voraussetzung von Bewußtsein; ohne es ist Erfahrung nicht möglich.
[12] Nach Freud kann die Charakterstruktur auf Grundlage der spezifischen Lösung der ödipalen Konfliktsituation erklärt werden. Der psychoanalytischen Auffassung zufolge sind in der ödipalen (der der Latenz vorausgehenden infantilen) Entwicklungsphase inzestuöse, aus der libidinösen Bindung an den jeweils gegen-geschlechtlichen Elternteil herzuleitenden, Triebregungen vorherrschend. Die (Un-) Befriedigung dieser Triebe bzw. die Abnabelung von den Eltern, im Rahmen der Adsoleszenzphase (Morartorium), werden oft als Ursachen später auftretender Neurosen, Perversionen oder der sexuellen Inversion betrachtet. Diese ödipale Komponente entwickelt sich im Alter zwischen 3-6 Jahren, wobei die anfänglich diadische (Mutter-Kind) von der triadischen (Vater-Mutter-Kind) Interaktion abgelöst wird.
[13] In dieser Haltung wird Kritik an dem Positivismus geübt. Der Positivismus ist eine philosophische Anschauung, deren Forschung auf das Positive, Tatsächliche, Wirkliche und Zweifellose beschränkt, sich allein auf Erfahrung beruft und jegliche Metaphysik als theoretisch unmöglich und praktisch nutzlos ablehnt. Auguste Comte (1798-1857) gilt als einer der ersten Vertreter dieser philosophischen Richtung. Er verwandte auch das erste Mal den Begriff der „Soziologie“ und hatte eine äußerst elitäre Auffassung von dieser Wissenschafts-disziplin.
[14] Nach Adorno impliziert die Halbbildung auf der kognitiven Seite die Eigenschaft der Subsumtion unter Oberbegriffe; die Realität wird durch Schemata und Vorurteile erfahren. Für die affektive Seite ist die fehlende Entwicklung von Phantasie und Kreativität, und damit verbunden das Abgeschnittensein vom eigenen Erleben charakteristisch. Der Glaube alles zu wissen; die oberflächliche Aneignung von - unter anderem durch die Medien verbreitetem - Wissen, unterscheidet die Halbbildung von der Unbildung. Signifikant für die Unbildung ist eine gewisse Naivität und Nichtwissen auf der einen Seite, zugleich aber die Offenheit für neue Erfahrung der Realität auf der anderen Seite. (Vergleiche: Adorno, Th. W.; Theorie der Halbbildung; In: Soziologische Schriften, Bd. 1; Frankfurt/M. 1972; S. 93-121). Das Kernstück von Adornos Kritik ist die mangelnde Bildung von Studenten!
[15] Horkheimer und Adorno scheinen auch nach 54 Jahren, bezüglich der wirtschaftlichen Verwertbarkeit von Wissen, nichts an Aktualität eingebüßt zu haben. Der Bezug zur momentanen Bildungs- und Globalisierungs-debatte, wird in dem Versuch selbst die letzten gesellschaftlichen Bereiche unter das Primat des Neo-Liberalismus zu subsumieren, besonders deutlich.
[16] Hier bezogen auf die menschliche Lebensgeschichte. Der Individuationsprozeß besitzt analog Gültigkeit für die Phylogenese (Fromm, Erich (1941); Die Furcht vor der Freiheit; dtv, München 1990; S.29), ökonomische, politische, familiäre, religiöse, emotionale Bindungen. Zur aktuellen Relevanz der Individualisierungs-problematik siehe auch die „Individualisierungsthese“ von Ulrich Beck (Individualisierung, Institutionalisierung und Standardisierung von Lebenslagen und Biographiemustern, Kap. V; in: Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne; Frankfurt/M. 1986; v.a. S. 206f.
[17] Fromm, E.; ibid.; S. 27.
[18] Fromm, E.; a.a.O.; S. 96ff..
[19] Zur Rolle der Reformation siehe Fromm, E.; a.a.O.; S. 42f. & 52ff..
Zur Kausalität von Protestantismus/Calvinscher Prädestinationslehre – Kapitalismus cf. Ritsert, J.; Gesellschaft – Einführung in den Grundbegriff der Soziologie; Frankfurt 1988; S. 237ff. und S. 262 – 265; desweiteren siehe Weber, M. (1905); Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus; München/Hamburg 1965.
[20] Später v.a. der Monopolkapitalismus. Die ursprüngliche Akkumulation von Kapital, um Rahmen der Industrialisierung (Übergang vom Feudalismus zum Frühkapitalismus), führte zur dichotomatischen Aufsplittung der Gesellschaft in Proletarier und Besitzende.
[21] Nach Freud verschwinden mit der Bindung an einen Führer auch die gegenseitigen libidinösen Bindungen der Massenindividuen, welche diese ursprünglich zusammenhalten. Aus diesen affektiven Bindungen können der „Mangel an Selbständigkeit und Initiative beim einzelnen, die Gleichartigkeit seiner Reaktion mit der aller anderen, sein Herabsinken zum Massenindividuum, (...) die Züge von Schwächung intellektueller Leistung, von Ungehemmtheit der Affektivität, die Unfähigkeit zur Mäßigung und zum Aufschub, die Neigung zur Überschreitung aller Schranken und der Gefühlsäußerung und zur vollen Abfuhr derselben in Handlungen“, als Regression der seelischen Tätigkeit auf eine frühere Stufe erklärt werden. Cf. Freud, S.; Massenpsychologie und Ich-Analyse; in: Gesammelte Werke Bd. XIII; Frankfurt, 1999.
[22] Neuere Studien widerlegen die These, daß vor allem jene Kinder eine autoritäre Persönlichkeit entwickeln, die sich bereitwillig der Disziplin im Elternhaus und in der Schule unterwarfen, und daß sich die rebellischen und widerspenstigen Kinder als antiautoritär erweisen würden. Vielmehr scheinen gerade die ungehobelten und „unkultivierten“ Kinder in den Kreis der potentiellen Faschisten zu fallen. Gestützt wird diese Annahme durch die Beobachtung von „Banden“. Die sich dort manifestierende Gewalt, welche im Laufe des Lebens nicht aufgegeben, aber verdrängt und rationalisiert wird, scheint auf das Schwinden der positiven, beschützenden Funktion der Familie zurückzuführen: nicht eine zu kräftige Familie, sondern ein Mangel an familiärer Bindung.
[23] Vgl. Adorno, Th.W. (1950); Studien zum autoritären Charakter; Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973.
[24] Die zugrunde liegenden Forschungsarbeiten waren: die Ethnozentrismus-Skala (E-), mit deren Hilfe Vorurteile /Aversionen gegen andere Ethnien, sowie die Favorisierung/Idealisierung der eigenen Gruppe gemessen werden konnten.
Mit der Antisemitismus-Skala (A-S-) konnten Werte über die potentielle Judenfeindlichkeit der Befragten ermittelt werden. Untersuchungen über den politisch-ökonomischen Konservatismus (PEC) lieferte Ergebnisse, die mit denen der E- und A-S-Skala korrelierte. Neben Studien der Charakterstruktur um Verhältnis zur Kriegsmoral und Ideologie, der Universität Kalifornien, verschiedener Untersuchungen des Institute of Social Research, wurde – einschließlich der empirischen und theoretischen Studien – die allgemeine Literatur über Faschismus uns Antisemitismus hinzugezogen.
[25] Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.), Meyers großes Taschenlexikon, Bd. 15; Bibliographisches Institut, F.A. Brockhaus AG; Mannheim 1995, S. 158.
Eine von dieser Interpretation abweichende Meinung vertritt Erich Fromm: Er mißt dem Narzißmus die Funktion einer Überkompensation des Mangels an Selbstliebe zu, da der Narzißt weder die anderen, noch sich selbst liebt. (vgl. Fromm; a.a.O.; S. 89).
[26] Adorno, Th. W.; Erziehung zur Mündigkeit, In: Erziehung zur Mündigkeit, Vorträge und Gesprächen mit H. Becker 1959 –1969; Hrsg. Gerd Kadelbach; Frankfurt/M. 1970; S. 133ff..
[27] Dem Aberglaube (v.a. der Astrologie) inhärent ist die latente Aufforderung zum Gehorsam, sowie die Förderung der allgemeinen Konformität – durch Einfügung in das gesellschaftliche Gefüge – aufgrund der naturgegebenen übermenschlichen Autorität (cf. Adorno, Th. W.; Aberglaube aus 2. Hand, In: Soziologische Schriften Bd.1, Gesammelte Schriften; Frankfurt a.M. 1972; S. 147 – 176, v.a. S. 158.
[28] Zum Phänomen des „Rebellen“ vgl. ebenfalls Fromm, E.; a.a.O.; S. 126f.
[29] Lindner, R. M.; Rebell without a cause, New York 1944; In: Adorno, Th. W. (1950); Studien zum autoritären Charakter, Frankfurt/M. 1973; S. 330.
[30] Zur weiteren Erläuterung der fortschreitenden Destruktivität in der Kultur siehe auch Fromms Arbeit über die individuellen und sozialen Ursachen der Unfähigkeit zu lieben und rationalem Verhalten, welche notwendig zu der Leidenschaft führt Leben entweder absolut zu kontrollieren oder zu vernichten, als Ausdruck von Nekrophilie. In seinem Werk „Anatomie der menschlichen Destruktivität“, verdeutlicht er dies an Studien über Stalin, Hitler und Himmler. Im Gegensatz zur gutartigen Aggression - welche sich phylogenetisch herausgebildet hat, defensiven Charakters besitzt und der Erhaltung der vitalen Interessen dient – zeichnet sich die Nekrophilie als bösartige Aggression durch einen besonderen Zerstörungsdrang, Gefühlskälte, Technokratie, Verlust der Spontaneität, stereotypem und narzißtischem Verhalten, sowie schizophrenen Tendenzen aus. Der kybernetische Mensch besitzt einen Marketing-Charakter, der seine Umwelt nur in der Kategorie konsumfähiger Waren-förmigkeit wahrnimmt. Er ist das Produkt der kapitalistischen Ordnung und will die Zusammenhänge nur verstehen, da er sie gewinnbringend nutzen will. Die Nekrophilie hat ihre Ursache in einer bösartig inzestuösen Bindung an die Mutter. Vgl. Fromm , Erich; Anatomie der menschlichen Destruktivität; Stuttgart, 1974.
[31] „Die 21-jährige Testperson stand den sexuellen Näherungsversuchen ihres damaligen Freundes unsicher und zurückhaltend gegenüber. Da beide offensichtlich eine unterschiedliche Auffassung von Sexualität hatten, beendete sie daraufhin die Liaison. Im Gegensatz offenbarte sich dem Interviewer ein Zusammenhang zwischen dem nicht geglückten Unterdrückungsversuch von Zuneigungsgefühlen für ihren Vater und ihrer sexuellen Veranlagung. >>Ich möchte jemanden heiraten, der so ist wie mein Vater<<.“ (Adorno; a.a.O.; S. 357).
[32] Zu Erkenntnissen bezüglich des Gehorsams vergleiche Milgram, Stanley; Das Migram-Experiment zur Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autoritäten; Rowohlt, Reinbeck bei München 1982.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Prologs?
Der Prolog behandelt das Scheitern der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus. Er thematisiert die Verfolgung und Vernichtung von Juden, Slawen, Sinti und Roma, Behinderten, Homosexuellen, religiösen Minderheiten, politisch Andersdenkenden und Intellektuellen. Außerdem wird die Anpassung der deutschen Arbeiterschaft an das nationalsozialistische Herrschaftssystem und die Werke der Frankfurter Schule im Exil erwähnt, welche sich mit Nazismus, Antisemitismus und Autoritätsunterwürfigkeit auseinandersetzten. Es geht auch um die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno und die Studien zum autoritären Charakter von Adorno.
Was sind die Hauptthemen des ersten Kapitels "Das Unbehagen in der Kultur"?
Dieses Kapitel behandelt Freuds psychoanalytische Kulturtheorie und skizziert: Die Ontogenese des Realitätsprinzips, Ersatzbefriedigung, Religion und Sublimierung, Kulturanforderungen, Liebe und Vergesellschaftung, Aggressionstrieb und Kultur, Genese von „Über-Ich“ und Gewissen, und Das Unbehagen unter dem „Kultur-Über-Ich“.
Was sind die zentralen Punkte des zweiten Kapitels "Grenzen der Aufklärung"?
Dieses Kapitel erörtert: Das Verhältnis der Juden zur bestehenden Ordnung, Antisemitismus als Ideologie eines „dynamischen Idealismus“, Die sozio-ökonomischen Ursachen des Antisemitismus, Die religiösen Motive des Antisemitismus, Die Ursachen der Idiosynkrasie als Konstituens des Antisemitismus, Die pathische Projektion und paranoische Reaktionsform, Die psychologische Enteignung der Triebökonomie der Subjekte und die „Ticketmentalität“ als Resultat des Wirtschaftsprozesses.
Was wird im dritten Kapitel "Der Charakter als Determinante ideologischer Präferenzen" behandelt?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit: Der Individuationsprozeß, Autorität und Familie, Kausalität von Ideologie und Charakter, Konstruktion der F-Skala/psychologische Variablen.
Welche Charakterstrukturen werden im vierten Kapitel "Typologie der Vorurteilsvollen und Vorurteilsfreien Charakterstrukturen" untersucht?
Das Kapitel stellt vor: Das „Oberflächenressentiment“ und der „starre Vorurteilsfreie“, Das „konventionelle Syndrom“, Das „autoritäre“ Syndrom, Der „Rebell“ und „Psychopath“ (Rowdy), Der „Spinner“, Der „manipulative“ Typus, Der „genuine Liberale“.
Was sind die psychologischen, wirtschaftlichen und ideologischen Aspekte des Nazismus im fünften Kapitel "Die Psychologie des Nazismus"?
Dieses Kapitel analysiert: Die psychologischen Bedingungen, Die wirtschaftlichen und politischen Ursachen, und Die Ideologie des Nazismus.
Was wird im Epilog zusammengefasst?
Der Epilog fasst die Hauptargumente zusammen und geht auf die Frage ein, wie die Überwindung der Idiosynkrasie bewerkstelligt werden könnte, von welcher die Emanzipation der Gesellschaft vom Antisemitismus abhängt und die Individuen in ihrer Existenz als Subjekte gestärkt werden können.
Was enthält die Bibliographie?
Die Bibliographie listet die verwendeten Werke und Autoren auf, darunter Adorno, Horkheimer, Freud, Fromm und andere.
- Citar trabajo
- Sebastian Muthig (Autor), 2000, Dialektik der Aufklärung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6022