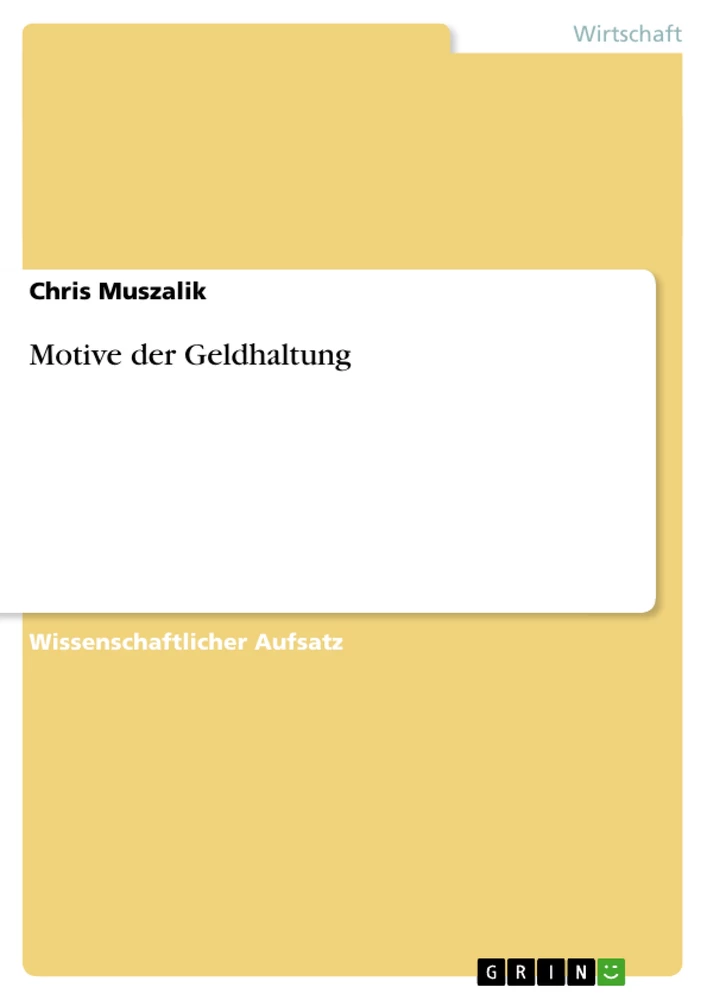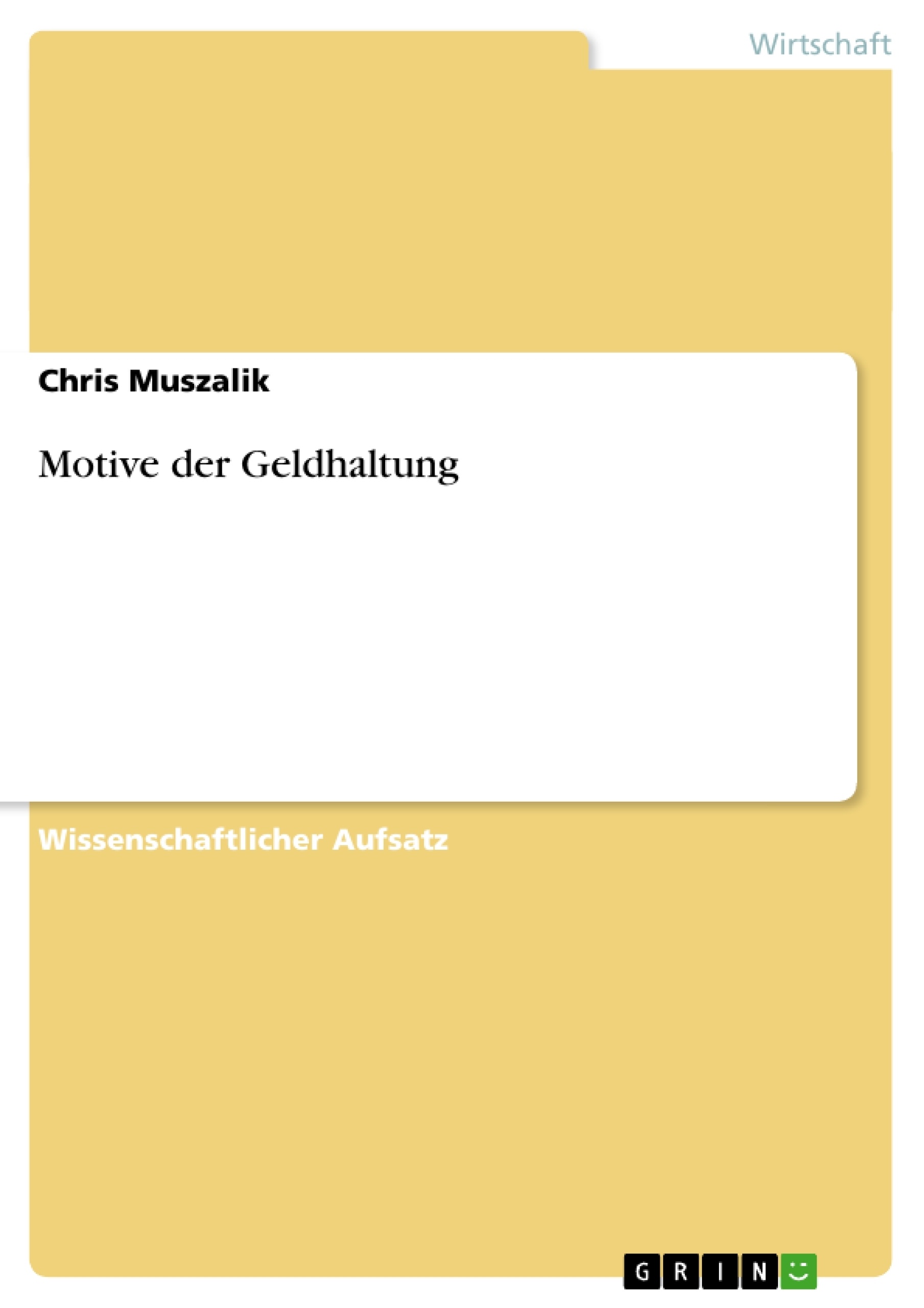1 Grundlagen
1.1 Geldfunktion
Im Laufe der Geschichte wurden verschiedene Güter als Geld verwendet (Muscheln, Salz, Gold, Bier u.v.m.). Diese Güter sollten mindesten vier Eigenschaften besitzen: Knappheit, Teilbarkeit, Gleichwertigkeit und Haltbarkeit. (Herdes H.-D; S.420) Als die Menschen sesshaft wurde begann der Übergang vom Naturaltausch zur Geldwirtschaft, mit der Entwicklung des Handelsverkehrs und der Arbeitsteilung entstand das Medium Geld und zwar in Form von Münzen, private und staatliche Banknoten sowie Giralgeld (D). Zahlungsmittel sind ausschließlich Münzen und Banknoten die von der Europäischen Zentralbank (EZB) emittiert werden. (Arentzen U; S.387) Geld hat drei ökonomische Funktionen zu erfüllen:
als Zahlungsmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrung. (Herdes H.-D; S.420) Als heutiges Geld kennen wir: Bargeld (BG) (Münzen und Banknoten), Buch- oder Giralgeld (D) (Sichteinlagen), Quasigeld; sind Vermögensgegenstände, die sich leicht in Bargeld transformieren lassen und die Tendenz geht zu „electronic money“ wie z.B. EC, VISA und MASTER-Card.
1.2 Geldmengen im Euro-Währungsgebiet
„Geld übt bestimmte Funktionen aus und Geld hat bestimmte Wirkungen. In diesem Sinn ist die Geldmenge (M) ein analytisches Konzept, ein Konzept, welches zur Erklärung der Wirkung des Geldes und als Zielgröße der Geldpolitik herangezogen wird.“ Diese Geldmenge (M) genau abzugrenzen ist, ist eine Frage der analytischen und geldpolitischen Zweckmäßigkeit, die bislang nicht gültig geklärt ist. (Baßeler U.; S.456) In der Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) werden drei Geldmengenkonzepte abgegrenzt (vgl. Abb.1; S.17), die nach dem Liquiditätsgrad unterschieden werden:
• eine eng gefasste Geldmenge M1 (= Bargeld BG + Giralgeld D)
• eine mittlere Geldmenge M2 (= M1 + Termineinlagen TE)
• eine weit gefasste Geldmenge M3 (= M2 + SE)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Geldfunktion
- 1.2 Geldmengen im Euro-Währungsgebiet
- 1.3 Europäische Zentralbank
- 1.4 Bruttoinlandsprodukt
- 2 Die Geldnachfrage
- 2.1 Geldnachfrage zu Transaktionszwecken
- 2.2 Geldnachfrage nach Vorsichtkasse
- 2.3 Geldnachfrage zu Spekulationszwecken
- 3 Veränderung der Geldnachfrage durch ...
- 3.1 ... Änderung des Zinssatzes
- 3.2 Änderung des Bruttoinlandsprodukts
- 3.3 ... Änderung des Preisniveaus
- 3.4 Die LM-Kurve
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erläutert die Geldnachfrage nach Transaktionskasse, Vorsichtkasse und Spekulationskasse im Euroraum (EUR15) und untersucht deren Veränderungen in Abhängigkeit vom Inlandsprodukt, Preisniveau und Zinssatz. Ziel ist das Verständnis geldwirtschaftlicher Zusammenhänge und die Verbesserung der Fähigkeit, auf marktwirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren.
- Geldfunktionen und -mengen im Euroraum
- Determinanten der Geldnachfrage
- Einfluss von Zinssatz, BIP und Preisniveau auf die Geldnachfrage
- Die Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB)
- Das Konzept der LM-Kurve
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der Geldnachfrage, indem es die Geldfunktionen (Zahlungsmittel, Recheneinheit, Wertaufbewahrung) und die verschiedenen Geldmengen im Euroraum (M1, M2, M3) beschreibt. Es wird auf die Bedeutung der Europäischen Zentralbank (EZB) und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) eingegangen, welche wichtige Einflussfaktoren auf die Geldnachfrage darstellen. Die unterschiedlichen Geldmengen werden anhand ihrer Liquidität definiert und die historischen Entwicklungen von Geld als Tauschmittel werden kurz erläutert, um den Kontext der modernen Geldwirtschaft zu verdeutlichen. Der Abschnitt über das BIP hebt dessen Rolle als Indikator für die wirtschaftliche Aktivität und somit den Einfluss auf die Geldnachfrage hervor.
2 Die Geldnachfrage: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den drei Motiven der Geldhaltung: Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv. Es werden detailliert die jeweiligen Gründe erläutert, warum Individuen und Unternehmen Geld für Transaktionen, für unvorhergesehene Ausgaben und zur Spekulation auf zukünftige Zinsänderungen halten. Die Kapitelteile bilden zusammen ein umfassendes Bild der unterschiedlichen Beweggründe für die Geldhaltung und zeigen wie diese sich auf die Gesamtgeldnachfrage auswirken. Die Ausführungen gehen über eine reine Definition hinaus und erläutern die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Motiven.
3 Veränderung der Geldnachfrage durch ...: Das Kapitel analysiert die Auswirkungen von Veränderungen des Zinssatzes, des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des Preisniveaus auf die Geldnachfrage. Es wird detailliert beschrieben, wie beispielsweise ein steigender Zinssatz die Geldnachfrage beeinflusst (verringert, da Anleger ihr Geld lieber anlegen anstatt es als Cash zu halten) und umgekehrt. Ähnlich wird der Einfluss des BIP (ansteigendes BIP führt zu höherer Geldnachfrage für Transaktionen) und des Preisniveaus (höheres Preisniveau erhöht die Geldnachfrage) erklärt. Die Kapitelteile bauen aufeinander auf und führen schliesslich zur Erklärung der LM-Kurve.
Schlüsselwörter
Geldnachfrage, Transaktionskasse, Vorsichtkasse, Spekulationskasse, Zinssatz, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Preisniveau, Europäische Zentralbank (EZB), Euroraum (EUR15), Geldmengen (M1, M2, M3), LM-Kurve, Geldpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geldnachfrage im Euroraum
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Geldnachfrage im Euroraum. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den drei Motiven der Geldhaltung (Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv) und deren Abhängigkeit von Zinssatz, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Preisniveau.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 behandelt die Grundlagen, einschließlich Geldfunktionen, Geldmengen im Euroraum, die Europäische Zentralbank (EZB) und das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Kapitel 2 befasst sich detailliert mit den drei Motiven der Geldnachfrage: Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv. Kapitel 3 analysiert schließlich den Einfluss von Zinssatz, BIP und Preisniveau auf die Geldnachfrage und führt zur Erklärung der LM-Kurve.
Welche Faktoren beeinflussen die Geldnachfrage?
Die Geldnachfrage wird maßgeblich von drei Faktoren beeinflusst: dem Zinssatz (höherer Zinssatz führt zu geringerer Geldnachfrage), dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) (höheres BIP führt zu höherer Geldnachfrage) und dem Preisniveau (höheres Preisniveau führt zu höherer Geldnachfrage). Zusätzlich spielen die drei Motive der Geldhaltung (Transaktions-, Vorsichts- und Spekulationsmotiv) eine entscheidende Rolle.
Was sind die drei Motive der Geldhaltung?
Die drei Motive der Geldhaltung sind: das Transaktionsmotiv (Geldhaltung für den täglichen Bedarf und Transaktionen), das Vorsichtsmotiv (Geldhaltung für unvorhergesehene Ausgaben) und das Spekulationsmotiv (Geldhaltung zur Spekulation auf zukünftige Zinsänderungen).
Welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank (EZB)?
Die Europäische Zentralbank (EZB) spielt eine wichtige Rolle im Kontext der Geldnachfrage, da ihre geldpolitischen Maßnahmen die Zinssätze und somit indirekt die Geldnachfrage beeinflussen. Das Dokument erläutert die Bedeutung der EZB im Zusammenhang mit den Geldmengen und der Stabilität des Euroraums.
Was ist die LM-Kurve?
Die LM-Kurve (Liquiditätspräferenz-Geldmengen-Kurve) stellt den Zusammenhang zwischen dem Zinssatz und der Geldmenge dar. Sie wird im dritten Kapitel des Dokuments im Kontext der Auswirkungen von Zinssatz, BIP und Preisniveau auf die Geldnachfrage erklärt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Geldnachfrage, Transaktionskasse, Vorsichtkasse, Spekulationskasse, Zinssatz, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Preisniveau, Europäische Zentralbank (EZB), Euroraum (EUR15), Geldmengen (M1, M2, M3), LM-Kurve, Geldpolitik.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Personen, die sich mit geldwirtschaftlichen Zusammenhängen im Euroraum auseinandersetzen möchten. Es dient dem Verständnis der Geldnachfrage und der Fähigkeit, auf marktwirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren.
- Quote paper
- Chris Muszalik (Author), 2004, Motive der Geldhaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60353