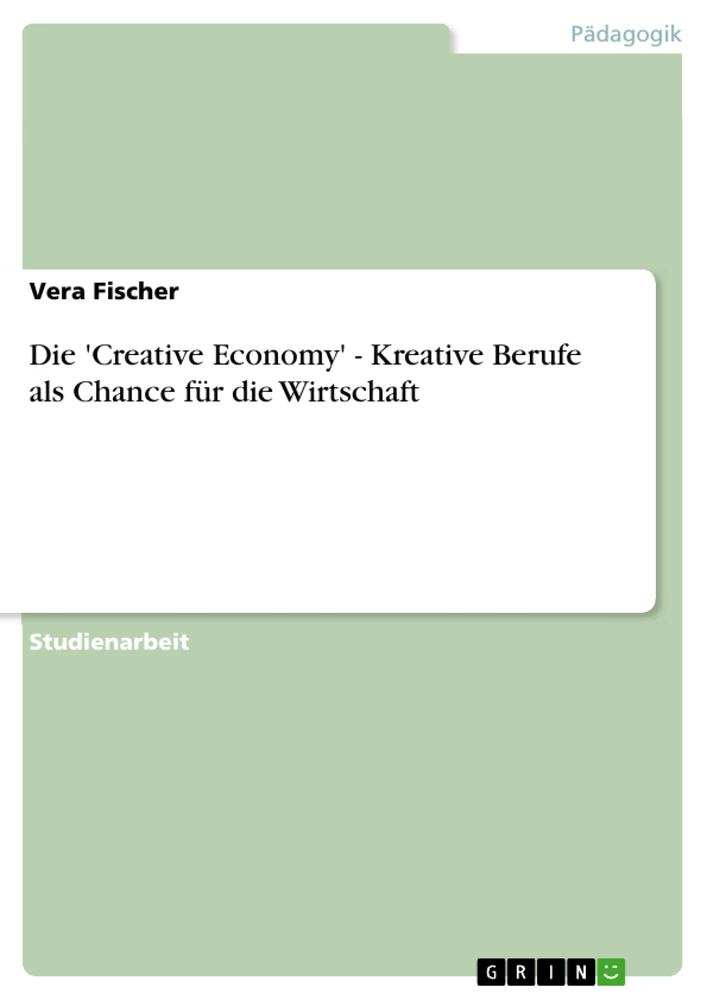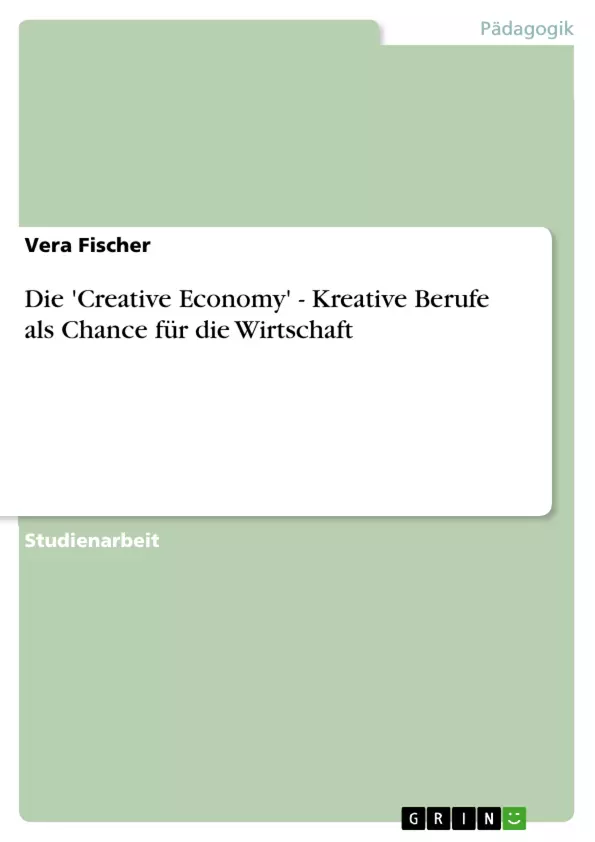Die „Creative Economy“
Ist das ein Wirtschaftssystem, das Privilegien für besonders kreative Köpfe einräumt? Oder ist damit vielleicht gemeint, dass wer in der Wirtschaft aktiv ist, Kreativitätstechniken anwenden soll, um die Produktivität beispielsweise eines Unternehmens zu steigern?
Diese Ideen sind wohl auch interessante Ansätze, sind aber in der vorliegenden Betrachtung nicht gemeint, wenn es um den Begriff der „Creative Economy“ geht.
Die „Creative Economy“ ist hier nicht zu verstehen als kreative Wirtschaft, sondern als Wirtschaft der Kreativen. Es geht darum, zu hinterfragen, welchen Status der so genannte Dritte Sektor, also der Kunst- und Kultursektor, im gesamtwirtschaftlichen Komplex innehat.
Zunächst richten wir den Blick auf eine Studie aus dem Jahre 1988, die unter der Leitung des Ifo-Institutes München der Frage nachgegangen ist, welche volkswirtschaftliche Bedeutung Kunst und Kultur haben. Hier werden Fragen beantwortet, wie zum Bsp.: Welche Berufe fallen überhaupt in den Kunst- und Kultursektor und welche Beschäftigungs- bzw. Einkommensverhältnisse liegen vor? Wird Kunst und Kultur einzig vom Staat gefördert? Und als zentrale Frage: Sollte der Staat seine Zuschüsse nicht eher erhöhen als die Förderungen für Kunst und Kultur zu drosseln? Diesen und weiteren Fragen stellt sich die Studie und liefert erstaunliche Ergebnisse.
Weiter wird die Arbeit der Spur nachgehen, woher der Begriff der „Creative Economy“ eigentlich kommt und wie sein Urheber ihn begründet. In diesem Zusammenhang werden zwei Texte des amerikanischen Forschers Richard Florida analysiert. Nach diesem Exkurs in die USA, geht es wieder zurück nach Europa und der Blick richtet sich auf Großbritannien. In einem ersten Schritt soll ein kurzer Text von Angela McRobbie vorgestellt werden, der das Konzept der so genannten „Talentbasierten Wirtschaft“ vorstellt und damit eine neue Dimension eröffnet von dem, was es heißt, eine „Creative Economy“ zu sein. Am Schluss der Darstellung steht ein konkretes Projekt aus der Praxis namens „Acting up“, das sich zum Ziel gesetzt hat arbeitslose Jugendliche aus Liverpool über den Weg der Kunst und des kreativen Schaffens auf den Berufseinstieg vorzubereiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kultur und Staat – Gegner oder Partner?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der „Creative Economy“ und untersucht die Rolle des Kultursektors im Wirtschaftsgefüge. Ziel ist es, den Status des so genannten „Dritten Sektors“ im gesamtwirtschaftlichen Komplex zu analysieren.
- Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur
- Die Entstehung des Begriffs „Creative Economy“ und seine Bedeutung
- Die „Talentbasierte Wirtschaft“ als neue Dimension der „Creative Economy“
- Praktische Projekte im Bereich der „Creative Economy“
- Das Verhältnis zwischen Kultur und Staat
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt den Begriff der „Creative Economy“ ein und grenzt ihn von anderen Interpretationen ab. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Status des Kultursektors in der Wirtschaft und kündigt die Analyse der Studie des Ifo-Instituts München sowie weiterer Texte zum Thema an.
Kultur und Staat – Gegner oder Partner?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Kunst und Kultur in Deutschland nur Mehrausgaben für den Staat darstellen oder ob sie verkannte Wirtschaftsfaktoren sind. Es stellt die Studie des Ifo-Instituts München aus dem Jahr 1988 vor, die die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur untersucht. Die Studie analysiert die Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse im Kultursektor, die staatlichen Ausgaben sowie die Rückflüsse durch Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge.
Schlüsselwörter
Creative Economy, Kultursektor, Kunst, Wirtschaft, Staat, Ifo-Institut, Talentbasierte Wirtschaft, Kulturpolitik, Kulturförderung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Creative Economy"?
In dieser Arbeit wird die "Creative Economy" als die "Wirtschaft der Kreativen" verstanden, also die Untersuchung des Status des Kunst- und Kultursektors im gesamtwirtschaftlichen Gefüge.
Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat Kunst und Kultur?
Laut einer Ifo-Studie ist der Sektor ein verkannter Wirtschaftsfaktor, der durch Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge erhebliche Rückflüsse an den Staat generiert.
Wer prägte den Begriff der Creative Economy?
Die Arbeit analysiert Texte des US-Forschers Richard Florida, der als einer der wesentlichen Urheber und Vordenker dieses Konzepts gilt.
Was ist eine "talentbasierte Wirtschaft"?
Dieses von Angela McRobbie vorgestellte Konzept beschreibt eine Dimension der Wirtschaft, in der individuelles Talent die primäre Ressource für Wertschöpfung darstellt.
Was ist das Projekt "Acting up"?
Es ist ein Praxisbeispiel aus Liverpool, das arbeitslose Jugendliche durch kreatives Schaffen und Kunst auf den Berufseinstieg vorbereitet.
- Arbeit zitieren
- Vera Fischer (Autor:in), 2006, Die 'Creative Economy' - Kreative Berufe als Chance für die Wirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60357