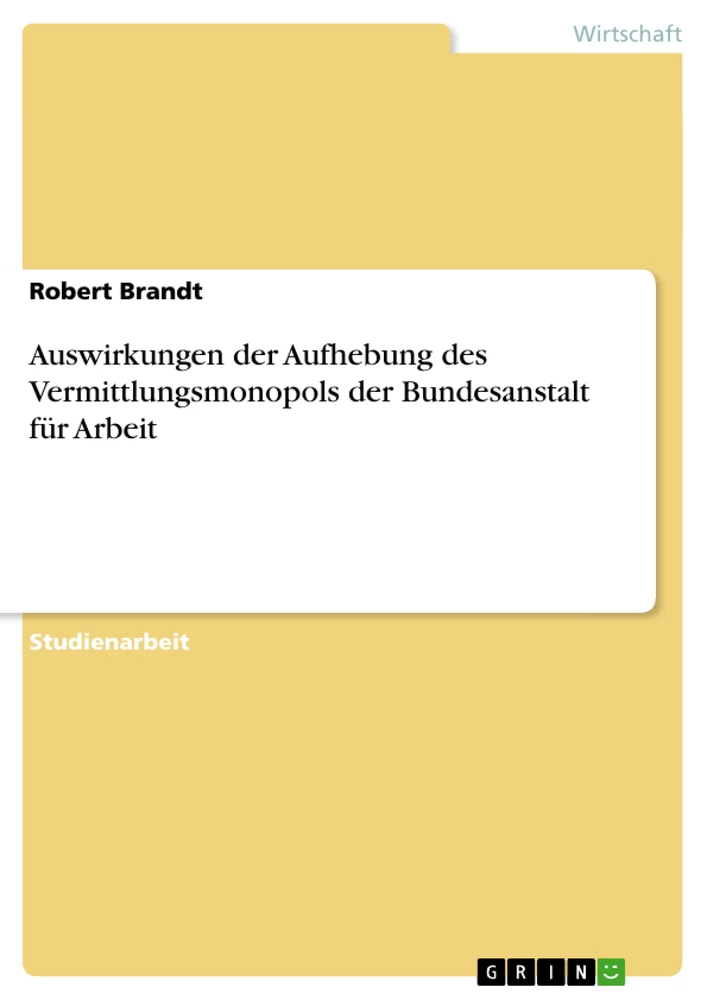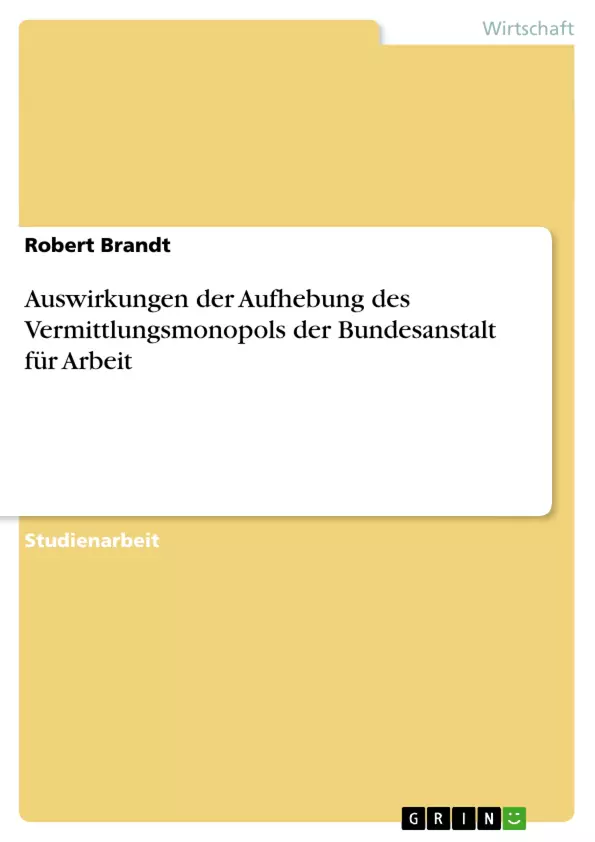In den vergangenen Jahren entwickelte sich in der Bundesrepublik Deutschland eine bedeutende Gruppe von Dauerarbeitslosen, welche sich von Konjunkturzyklus zu Konjunkturzyklus vergrößerte. Somit entstand ein Sockel von Arbeitslosen, der nicht mehr abgebaut werden konnte. Hierzu gehören oft die typischen Problemgruppen: gering Qualifizierte, Behinderte und alte Mitbürger. Ebenfalls eine Rolle spielt die friktionelle Arbeitslosigkeit. In Deutschland wechseln zwischen 6 und 7 Millionen Mitbürger ihren Arbeitsplatz pro Jahr. Diese finden in der Regel nicht gleich zum nächsten Monatsanfang einen neuen Job, sondern sind für eine gewisse Zeit erwerbslos. Alles spricht also für die Suche nach einer möglichst effektiven und sozialgerechten Vermittlung. Um diese zu garantieren galt bis 1994 das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit. Demnach wurde es Privatorganisationen untersagt, für Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz bzw. für Arbeitgeber einen Arbeitswilligen zu suchen. Ausnahmen gab es lediglich für Künstler und Führungskräfte. Im Jahre 1994 trat eine Veränderung auf. Das Vermittlungsmonopol wurde aufgehoben und der Arbeitsmarkt somit liberalisiert. Von Jahr zu Jahr steigerte sich die Anzahl der von privaten Unternehmen vermittelten Arbeitnehmer. So wurde 2000 knapp 27% mehr Arbeitswilligen eine Arbeitsstelle vermittelt als 1999. Um die Richtigkeit dieser Deregulierung zu diskutieren, muss man das Thema von zwei Seiten her betrachten. Zum einen spielt der sozialpolitische Schutzgedanke eine wichtige Rolle, und zum anderen die „Effizienz der Arbeitsvermittlung im Sinne arbeitsmarktpolitischer Zweckmäßigkeit“. Ich versuche nun in diesem Text zunächst einige Gründe zu nennen, die für das Vermittlungsmonopol sprechen und anschließend einige, die zur Abschaffung geführt haben, um dann daraus die Folgen abzuleiten. Die einzelnen Gründe diskutiere ich mit Hilfe von einigen bekannten ökonomischen Theorien aus der wissenschaftlichen Literatur, wie zum Beispiel der Effizienzlohn- oder die Insider-Outsider-Theorie und versuche dadurch zu zeigen, ob sie für ein Vermittlungsmonopol oder dagegen sprechen. Dann komme ich noch im speziellen auf die Folgen der Aufhebung um abschließend im Fazit kurz die Diskussion zusammenzufassen, die zeigt, dass die Aufhebung des Vermittlungsmonopols positive Auswirkungen für die Arbeitssuche hat, obwohl dies empirisch schwer zu belegen ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gründe für ein Vermittlungsmonopol bis zum Jahre 1994
- Die Verelendungstheorie
- Die Gefahr der Geschäftemacherei
- Die Gefahr des „Rosinenpickens“
- Die Intransparenz des Arbeitsmarktes
- Die Ressourcen des Staates
- Gründe für eine Abschaffung des Vermittlungsmonopols
- Die Widerlegung der Gründe für ein Vermittlungsmonopol
- Die Überforderung der staatlichen Behörden
- Das Grundrecht auf freie Berufswahl und Arbeitsplatzsuche
- Die Öffnung für den Markt der Europäischen Union
- Die Folgen der Aufhebung des Vermittlungsmonopols
- Eine Erfassung der Folgen in Zahlen
- Die Bedeutung für den gewerbsmäßigen Arbeitskräfteverleih
- Die inhaltlichen Veränderungen durch die Aufhebung des Vermittlungsmonpols
- Zusammenfassung/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen der Aufhebung des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit im Jahr 1994. Sie beleuchtet die Gründe für die Existenz des Monopols, die Argumente für dessen Abschaffung und die Folgen der Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Dabei wird insbesondere die Relevanz für den gewerbsmäßigen Arbeitskräfteverleih und die Auswirkungen auf die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen analysiert.
- Die Verelendungstheorie als Begründung für staatliche Arbeitsvermittlung
- Die Gefahr der Geschäftemacherei durch private Arbeitsvermittler
- Das Problem des „Rosinenpickens“ durch private Agenturen
- Die Effizienzsteigerung durch Wettbewerb im Arbeitsvermittlungsmarkt
- Die Auswirkungen der Liberalisierung auf die Situation von Langzeitarbeitslosen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeitsvermittlung in Deutschland ein und beleuchtet die Herausforderungen der Langzeitarbeitslosigkeit. Sie erläutert die historische Entwicklung des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit und zeigt die Notwendigkeit einer effektiven und sozialgerechten Vermittlung auf.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Gründe, die bis 1994 für ein Vermittlungsmonopol sprachen. Hierbei werden die Verelendungstheorie, die Gefahr der Geschäftemacherei und das Problem des „Rosinenpickens“ durch private Vermittler diskutiert.
Kapitel drei analysiert die Argumente für eine Abschaffung des Vermittlungsmonopols, wie die Widerlegung der ursprünglichen Gründe für das Monopol, die Überforderung der staatlichen Behörden und das Grundrecht auf freie Berufswahl und Arbeitsplatzsuche.
Kapitel vier widmet sich den Folgen der Aufhebung des Vermittlungsmonopols. Es beleuchtet die Auswirkungen auf den gewerbsmäßigen Arbeitskräfteverleih und die Veränderungen im Arbeitsmarkt.
Schlüsselwörter
Arbeitsvermittlung, Vermittlungsmonopol, Bundesanstalt für Arbeit, Liberalisierung, Arbeitsmarkt, Langzeitarbeitslosigkeit, Verelendungstheorie, Geschäftemacherei, Rosinenpicken, Effizienzlohn-Theorie, Insider-Outsider-Theorie, gewerbsmäßiger Arbeitskräfteverleih.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das Vermittlungsmonopol der Bundesanstalt für Arbeit aufgehoben?
Das Vermittlungsmonopol wurde im Jahr 1994 aufgehoben, was den Arbeitsmarkt für private Arbeitsvermittler öffnete.
Was war die „Verelendungstheorie“ im Kontext der Arbeitsvermittlung?
Diese Theorie diente als Begründung für das staatliche Monopol, um Arbeiter vor Ausbeutung und „Geschäftemacherei“ durch private Vermittler zu schützen.
Was bedeutet der Begriff „Rosinenpicken“ bei privaten Vermittlern?
Es beschreibt die Befürchtung, dass private Agenturen nur leicht vermittelbare Fachkräfte betreuen und Problemgruppen (wie Langzeitarbeitslose) dem Staat überlassen.
Welche ökonomischen Theorien werden in der Arbeit zur Analyse genutzt?
Die Arbeit nutzt unter anderem die Effizienzlohn-Theorie und die Insider-Outsider-Theorie, um die Vor- und Nachteile der Deregulierung zu diskutieren.
Wie wirkte sich die Aufhebung auf den Arbeitskräfteverleih aus?
Die Liberalisierung führte zu einem starken Wachstum des gewerbsmäßigen Arbeitskräfteverleihs (Zeitarbeit) und zu mehr Wettbewerb am Vermittlungsmarkt.
Ging die Arbeitslosigkeit durch die Aufhebung des Monopols zurück?
Die Arbeit kommt zum Fazit, dass die Aufhebung positive Auswirkungen auf die Stellensuche hat, obwohl dies statistisch schwer isoliert zu belegen ist.
- Citar trabajo
- Robert Brandt (Autor), 2002, Auswirkungen der Aufhebung des Vermittlungsmonopols der Bundesanstalt für Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60398