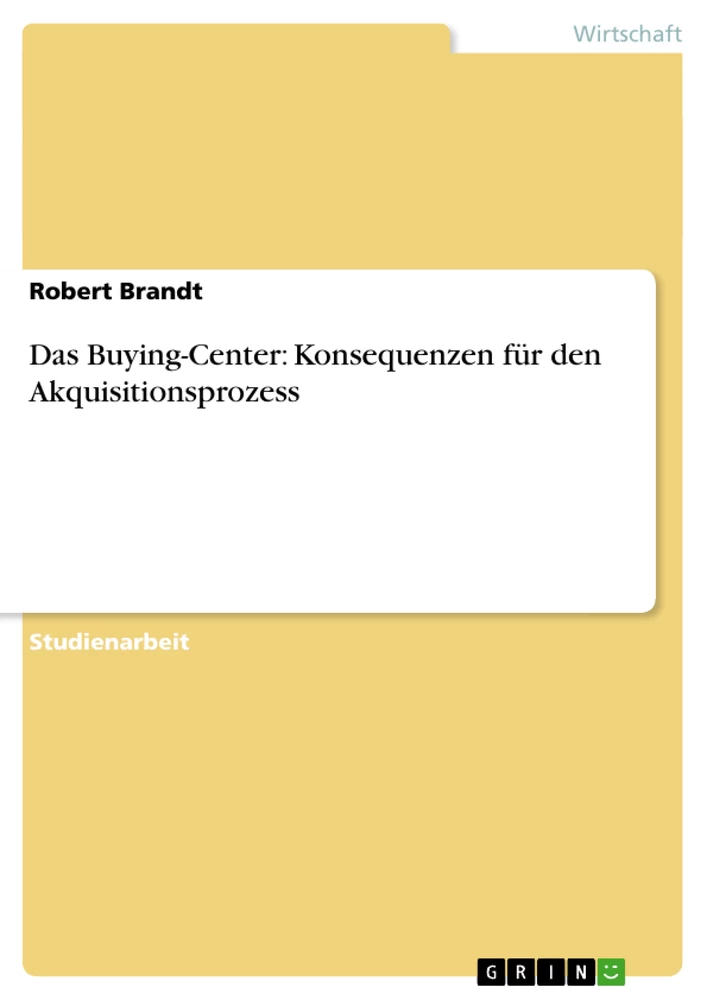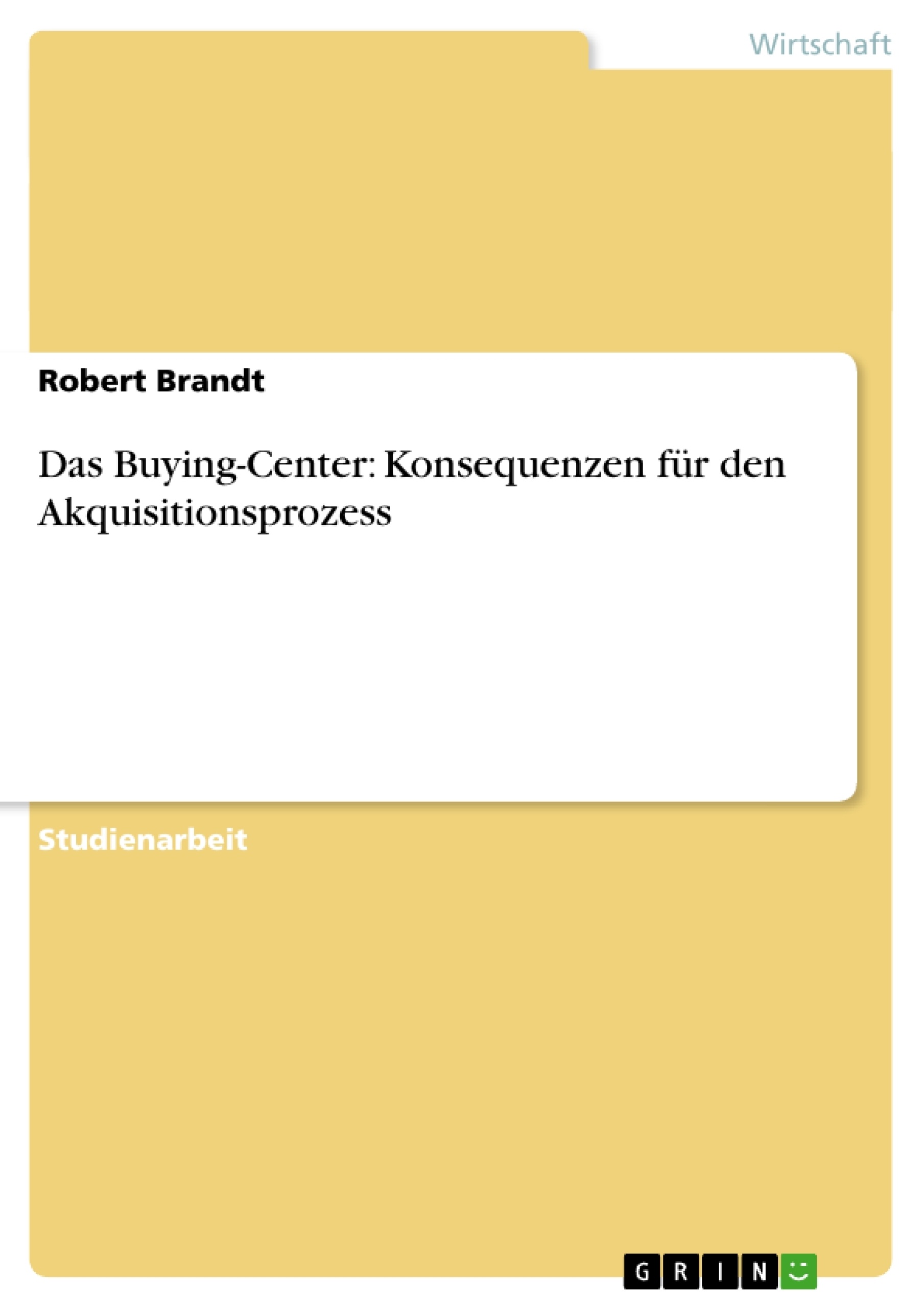Wenn man von Marketing redet, gilt es, einem Konsumenten ein bestimmtes Produkt so attraktiv wie möglich zu machen. Nun wurde aber in empirischen Studien und alltäglichen Beobachtungen die Feststellung gemacht, dass viele Entscheidungen, speziell im Buisness-to-Buisness-Bereich nicht nur von einer Person, sondern von einer Gruppe von Entscheidungsträgern getroffen werden, die mit unterschiedlichem Wissen und anderen Blickwinkeln an den Kaufprozess herantreten und ihn dementsprechend beeinflussen. So hat „Der Spiegel“ 1982 in einer Untersuchung festgestellt, dass ca. 90% der Kaufentscheidungen in industriellen Unternehmen von Arbeitsgruppen bestimmt werden (vgl. Köcher-Schulz 1997, S.26).
Diese Beobachtung wurde allerdings schon früher festgehalten. Laut Wesley J. Johnston und Thomas V. Bonoma stammt das erste Zitat über die Beteiligung von mehreren Managern in einem Kaufprozess aus dem Jahr 1956 von Richard M. Cyert. Der Begriff „Buying-Center“ dagegen wurde erst 1967 von Patrick J. Robinson geprägt (vgl. Johnston, Bonoma 1981, S. 144).
Um dieser Beobachtung Rechnung zu tragen, beschäftigte sich die Wissenschaft ausgiebig mit dem Thema und versuchte über das Verständnis des Aufbaus, der Verhaltensweisen und der Beziehungen in einem Buying-Center zu erklären, wie eine Kaufentscheidung zustande kommt. Dieses Wissen soll vertriebstechnisch genutzt werden, um den Kaufprozess zu beeinflussen. So schreibt Barbara Köcher-Schulz: „Ein Unternehmen, das die Zusammensetzung der Buying-Center seiner Kunden kennt, kann dieses Wissen zur Optimierung seiner Marketingarbeit nutzen.“ (Köcher-Schulz 1997, S. 35)
Dem Verständnis über das Buying-Center folgend kristallisierten sich meiner Recherche nach drei entscheidende Fragen heraus, die in der Literatur besonders behandelt wurden:
1. Wie bestimmt sich die Größe des Buying-Centers?
2. Wer spielt welche Rolle und übt welchen Einfluss im Buying-Center aus?
3. Wie sind die Beziehungsstrukturen im Buying-Center?
Ich versuche nun im Hauptteil meiner Arbeit mit Hilfe einiger Konzepte und Modelle diese Fragen zu beantworten, um einen theoretischen Überblick über das Thema zu präsentieren. Diesen Theorien stelle ich direkt ein praktisches Beispiel zur Seite, um dann jeweils deren Folgen für den Akquisitionsprozess zu beschreiben, soweit diese nicht schon in der theoretischen Behandlung besprochen wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Erklärungsansätze und deren Folgen für die Akquisition
- 2.1 Die Größe des Buying Centers
- 2.2 Die Untersuchung des Verhaltens von Mitgliedern im Buying Center
- 2.2.1 Das Rollenkonzept von Webster und Wind
- 2.2.2 Das Promotoren-/Opponenten-Modell von Witte
- 2.2.3 Die Informationstypen von Strothmann
- 2.3 Beziehungen im Buying Center
- 2.3.1 Kommunikationsstrukturen nach Johnston/Bonoma
- 2.3.2 Machtstrukturen nach French/Raven
- 2.3.3 Situationsspezifische Einflussfaktoren nach Büschken
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Buying-Center und dessen Konsequenzen für den Akquisitionsprozess. Ziel ist es, ein theoretisches Verständnis des Buying-Centers zu entwickeln und dessen Einfluss auf Kaufentscheidungen im Business-to-Business-Bereich zu beleuchten. Dies geschieht anhand der Analyse verschiedener Modelle und Konzepte.
- Größe und Zusammensetzung des Buying-Centers
- Rollen und Einflussmöglichkeiten der Mitglieder im Buying-Center
- Beziehungsstrukturen und Kommunikationsmuster innerhalb des Buying-Centers
- Auswirkungen des Buying-Centers auf den Akquisitionsprozess
- Praktische Anwendung der theoretischen Konzepte anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Buying-Centers ein und hebt die Bedeutung der Gruppenentscheidungen im Business-to-Business-Bereich hervor. Sie verweist auf empirische Studien, die den Einfluss von Gruppen auf Kaufentscheidungen belegen und benennt den Ursprung des Begriffs "Buying-Center". Die Einleitung formuliert drei zentrale Forschungsfragen, die im Hauptteil der Arbeit behandelt werden: die Größe des Buying-Centers, die Rollen und der Einfluss der Mitglieder sowie die Beziehungsstrukturen innerhalb des Buying-Centers. Diese Fragen bilden den Rahmen für die anschließende theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema.
2. Theoretische Erklärungsansätze und deren Folgen für die Akquisition: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene theoretische Konzepte und Modelle, um die drei Forschungsfragen zu beantworten. Es wird zunächst die Definition und Abgrenzung des Buying-Centers diskutiert, wobei die Unterscheidung zwischen funktions- und interessebasierter Zugehörigkeit hervorgehoben wird. Anschließend werden verschiedene Modelle vorgestellt, die das Verhalten der Buying-Center-Mitglieder (Rollenkonzept von Webster/Wind, Promotoren-/Opponenten-Modell von Witte, Informationstypen von Strothmann) und die Beziehungen zwischen ihnen (Kommunikationsstrukturen nach Johnston/Bonoma, Machtstrukturen nach French/Raven, situationsspezifische Einflussfaktoren nach Büschken) erklären. Jedes Modell wird detailliert erläutert und seine Relevanz für den Akquisitionsprozess wird herausgestellt. Das Kapitel betont die Komplexität des Buying-Centers und die Schwierigkeiten bei der Identifizierung aller beteiligten Personen.
Schlüsselwörter
Buying-Center, Akquisitionsprozess, Business-to-Business, Kaufentscheidung, Gruppenentscheidung, Rollenkonzept, Kommunikationsstrukturen, Machtstrukturen, Einflussfaktoren, Marketing, Vertrieb.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Buying Center und Akquisitionsprozess"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Buying Center und seinen Auswirkungen auf den Akquisitionsprozess im Business-to-Business-Bereich. Sie analysiert verschiedene theoretische Modelle und Konzepte, um ein tieferes Verständnis des Buying Centers zu entwickeln und dessen Einfluss auf Kaufentscheidungen zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Größe und Zusammensetzung des Buying Centers, die Rollen und den Einfluss der Mitglieder, die Beziehungsstrukturen und Kommunikationsmuster innerhalb des Buying Centers sowie die Auswirkungen des Buying Centers auf den gesamten Akquisitionsprozess. Es werden konkrete Modelle wie das Rollenkonzept von Webster/Wind, das Promotoren-/Opponenten-Modell von Witte, die Informationstypen von Strothmann, die Kommunikationsstrukturen nach Johnston/Bonoma, die Machtstrukturen nach French/Raven und die situationsspezifischen Einflussfaktoren nach Büschken analysiert.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit formuliert drei zentrale Forschungsfragen: 1. Wie groß ist das Buying Center? 2. Welche Rollen und Einflussmöglichkeiten haben die Mitglieder des Buying Centers? 3. Welche Beziehungsstrukturen existieren innerhalb des Buying Centers?
Welche Modelle werden vorgestellt und erklärt?
Die Arbeit präsentiert und erklärt detailliert folgende Modelle: Das Rollenkonzept von Webster und Wind, das Promotoren-/Opponenten-Modell von Witte, die Informationstypen von Strothmann, die Kommunikationsstrukturen nach Johnston/Bonoma, die Machtstrukturen nach French/Raven und die situationsspezifischen Einflussfaktoren nach Büschken. Die Relevanz jedes Modells für den Akquisitionsprozess wird hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit theoretischen Erklärungsansätzen und deren Folgen für die Akquisition, und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und formuliert die Forschungsfragen. Das Hauptkapitel präsentiert und analysiert die verschiedenen theoretischen Modelle. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Buying-Center, Akquisitionsprozess, Business-to-Business, Kaufentscheidung, Gruppenentscheidung, Rollenkonzept, Kommunikationsstrukturen, Machtstrukturen, Einflussfaktoren, Marketing, Vertrieb.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem Buying Center und dem Akquisitionsprozess im Business-to-Business-Bereich befassen, insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Marketing und Vertrieb.
- Quote paper
- Robert Brandt (Author), 2002, Das Buying-Center: Konsequenzen für den Akquisitionsprozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60400