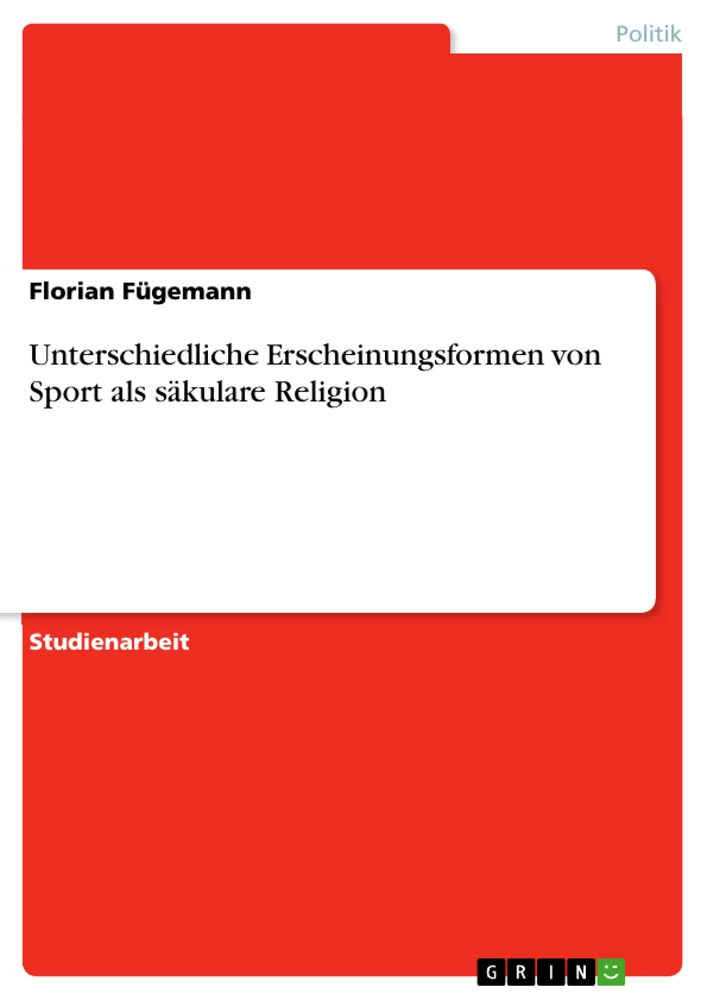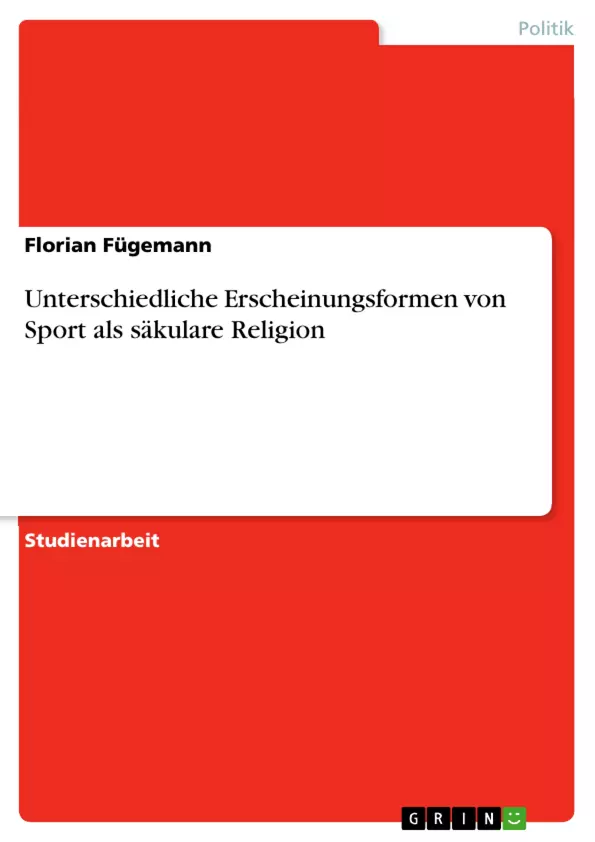Da sich diese Arbeit nicht vornehmlich mit dem aktiven Wettkampfgeschehen im Sinne der nicht passiven Definition von Sport als „persönliches Aktivsein in Bewegung“ (Niedermann zit. n. Jungmeier 1998, S. 42) auseinandersetzt, soll - wie bereits im Erkenntnisinteresse dargestellt - etwas genauer auf das oft als passiv definierte und konsumierende Publikum eingegangen werden. Zu Beginn meiner noch folgenden Ausführungen zum ausgewählten Fallbeispiel des ZuschauerInnensports im Fußball, soll daher methodisch voran gestellt werden, dass einleitend mit einer kurzen, historisch genetisch geführten Darstellung der Genese des Fußballsports, die Entwicklung zum Massenevent verdeutlicht werden soll. Erst dieser Einstieg ermöglicht eine Annäherung und ein diesbezügliches Vorverständnis, das wiederum notwendig erscheint, wenn im Zuge dessen, Merkmale bezüglich verschiedenster Ursachen, Motive und letztendlicher Intentions- und Funktionsbereiche des ZuschauerInnensports zu reflektieren sind. Weiters ist die Erörterung der obig angeführten These samt Beantwortung der Forschungsfragen in methodischer Hinsicht nicht nur auf eine makroanalytische Ebene fixiert, sondern soll gleichsam auch auf einer Mikroebene zum Ausdruck kommen. Das heißt weiter ausführend, dass die sozial komplex kontrastierten Bereiche des ZuschauerInnensports nicht nur von außen als Sozialsystem (Stichwort: Makroebene) untersucht werden dürfen, sondern dass es zum Verständnis dessen, auch vielmehr auf eine gezielte, auf das Individuum bezogene Untersuchungsebene ankommt (Stichwort: Mikroebene). Infolgedessen spielen Identifikations- und Identitätskonstruktionen von Fans eine wesentliche Rolle, da diese in Summe letzten Endes das eigentlich zu untersuchende Publikum ausmachen. Außerdem ist die methodische Herangehensweise vor allem aber auf eine Kombination aus akteurstheoretisch und empirisch-analytisch geführten Analysen angelegt. In diesem Kontext wurden gezielte Literaturrecherchen und Textanalysen im Bereich der Sportsoziologie undpsychologie durchgeführt, um herausstellen zu können, inwiefern die Sportpublika auf individueller und gemeinschaftlich-sozialer Ebene, folglich Mikro- und Makroebene, im Rahmen des Stadions als ein Raum von (Gruppen-) Dynamisierung und (Gruppen-) Identitätsbildung, beeinflussbar ist und ob eine diesbezüglich, wissenschaftlich geführte Interpretation im säkular-religiösen Kontext weiterführend standhält.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und zentrale Forschungsfragen
- Erklärung der Arbeits- und methodischen Herangehensweise
- Fußball im Wandel der Zeit: Eine historische Bestandsaufnahme zur Entwicklung des MassenzuschauerInnensports im Fußball
- Das Fußballereignis: Mehr als nur ein passiver Spielkonsum: Ursachen-, Motiv- und Funktionsmomente des ZuschauerInnensports
- Die Grundvoraussetzungen des Fan-Seins: Theoretische Vorüberlegungen zu Identifikation und Identität
- Fan ist nicht gleich Fan: Die Komplexität einer Subkultur anhand einer systematischen Darstellung der wichtigsten Fanklassifikationen
- Zusammenfassung und Fazit aus Darstellung der benannten Fanklassifikationen mit Bezugname auf Merkmale von individueller u. kollektiver Identifikation und Identität
- Direkte und unterschiedliche Ausdrucksformen von fußballbezogenem Fan-Sein im Stadion mit dem Versuch einer möglichen Interpretation eines säkularreligiösen Charakters
- Fußballbezogenes und -zentriertes Verhalten von Fans im Stadion
- ZuschauerInnensport im Fußballstadion: Quasi-Religionsbezug in kompensatorisch-säkularer Funktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Phänomen des Fußball-ZuschauerInnensports und untersucht, ob es sich dabei um einen passiven Konsum oder um eine aktive, identitätsgeprägte Form der Teilhabe handelt. Die Arbeit hinterfragt, inwieweit die medial präsenten Massenspektakel als Katalysator für das Fan-Sein fungieren und ob dem Fußballstadion als Versammlungsort ein quasi-religiöser Charakter innewohnt.
- Historische Entwicklung des Fußballsports als Massenspektakel
- Motive und Funktionsmomente des ZuschauerInnensports im Fußball
- Identifikations- und Identitätskonstruktionen von Fans im Kontext von Sportveranstaltungen
- Ausdrucksformen von Fan-Sein im Stadion: Verhalten, Rituale, Symbole
- Interpretation des Stadionbesuchs als säkulare Religionsausübung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse und die zentralen Forschungsfragen vor. Die Arbeit argumentiert, dass der Fußball-ZuschauerInnensport kein passiver Konsum, sondern ein aktives, identitätsgeprägtes Phänomen ist. Außerdem wird die Frage nach dem quasi-religiösen Charakter des Stadionbesuchs aufgeworfen.
- Kapitel 2: Dieser Abschnitt bietet eine historische Analyse der Entwicklung des Fußballsports als Massenspektakel. Es wird auf die Entstehung des organisierten Fußballs in Großbritannien und die Bedeutung der „Public Schools“ für die Professionalisierung des Sports eingegangen.
- Kapitel 3: Das Kapitel untersucht die Motive und Funktionsmomente des ZuschauerInnensports im Fußball. Es wird analysiert, warum Menschen Fußballspiele besuchen und welche Bedürfnisse durch den Konsum des Sports gestillt werden.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel erörtert die theoretischen Grundlagen von Identifikation und Identität im Kontext des Fan-Seins. Es wird auf die Bedeutung von Identitätsbildung und Gruppenzugehörigkeit im Sport eingegangen.
- Kapitel 5: Der Fokus liegt auf der Vielfalt der Fankulturen und -kategorien. Es wird eine systematische Darstellung der wichtigsten Fanklassifikationen präsentiert, um die Komplexität der Fan-Subkultur aufzuzeigen.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und beleuchtet die Merkmale von individueller und kollektiver Identifikation und Identität im Kontext von Fankulturen.
- Kapitel 7: Hier werden die direkten und unterschiedlichen Ausdrucksformen von Fan-Sein im Stadion untersucht. Es wird analysiert, wie Fans ihre Zugehörigkeit zur Fankultur durch Verhalten, Rituale und Symbole im Stadion ausdrücken. Außerdem wird der Versuch einer Interpretation des Stadionbesuchs als säkularer Religionsausübung unternommen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sport, Fußball, ZuschauerInnenverhalten, Fan-Kultur, Identifikation, Identität, Religion, Säkularisierung, Stadion, Massensport, Sozialisation, Gruppenverhalten und empirische Forschung. Die Arbeit beleuchtet den Fußball-ZuschauerInnensport als soziales Phänomen, das von Identitätsbildung, Gruppenzugehörigkeit und kulturellen Ausdrucksformen geprägt ist.
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern kann Sport als säkulare Religion betrachtet werden?
Sport, insbesondere Fußball, weist Merkmale wie Rituale, Symbole, kollektive Identität und eine kompensatorische Funktion auf, die traditionellen religiösen Praktiken ähneln.
Was ist der Unterschied zwischen ZuschauerInnensport und aktivem Sport?
ZuschauerInnensport wird oft als passiver Konsum definiert, wobei die Arbeit argumentiert, dass Fans durch Identifikation und emotionale Teilhabe eine aktive Rolle einnehmen.
Welche Rolle spielt das Stadion für die Fan-Identität?
Das Stadion fungiert als Raum der Gruppendynamisierung, in dem kollektive Identitäten gebildet und durch Rituale (Gesänge, Fahnen) gefestigt werden.
Wie hat sich Fußball zum Massenevent entwickelt?
Die Arbeit bietet einen historischen Rückblick von den Anfängen in britischen Public Schools bis hin zum modernen, medial inszenierten Massenspektakel.
Was sind die Motive für das Fan-Sein im Stadion?
Zentrale Motive sind das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Eskapismus vom Alltag, emotionale Entladung und die Konstruktion einer stabilen sozialen Identität.
- Citation du texte
- Mag. phil. Florian Fügemann (Auteur), 2005, Unterschiedliche Erscheinungsformen von Sport als säkulare Religion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60445