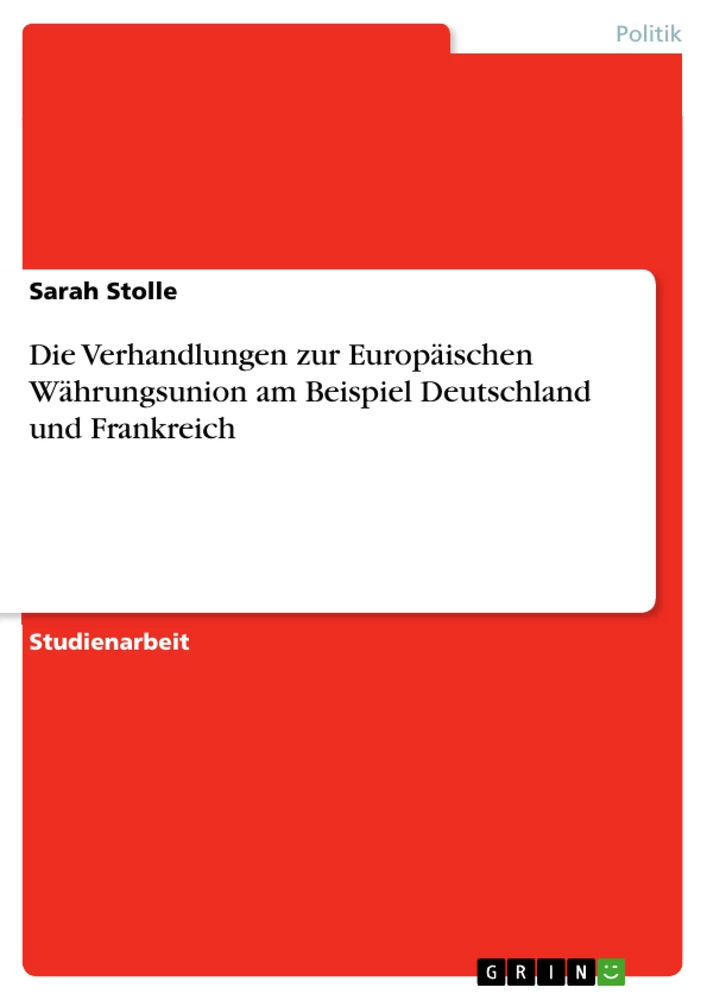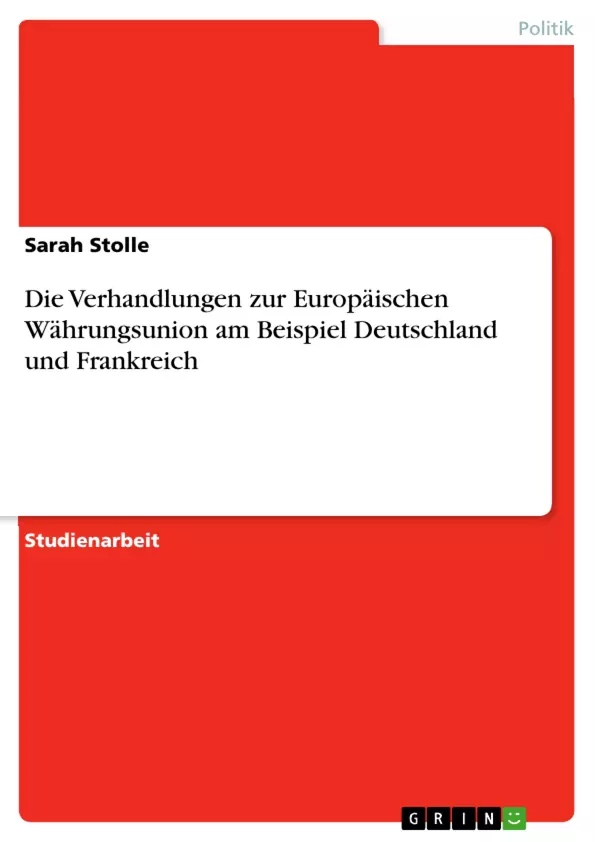[...] Unter dem Vorsitz des luxemburgischen Premierministers Pierre Werner wurde ein Stufenplan „Wernerplan“ entwickelt, der innerhalb von zehn Jahren zu einer Europäischen Währungsunion führen sollte. Doch aufgrund zu divergierender politischer Ansichten innerhalb Europas, der Ölkrise und des Zusammenbruchs des Bretton Woods Systems scheiterte das Vorhaben. Dennoch bildete der Wernerplan eine wichtige Basis für die heutige EWWU, vor allem was die stufenweise Verwirklichung betrifft. 1989 begannen, im Auftrag des Europäischen Rates, unter dem Vorsitz des damaligen französischen EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors erneut Beratungen über eine EWWU, die schließlich erfolgreich 1992 im Vertrag von Maastricht verankert wurden.
Die Maastrichter Beschlüsse sind das Ergebnis eines, aufgrund vieler unterschiedlicher Motivationen und Ziele der Europäischen Staaten, hartumkämpften und langandauernden Verhandlungsprozesses der Staats- und Regierungschefs der EG-Mitgliedstaaten gewesen. Die Staats- und Regierungschefs mussten den gesamten Prozess festlegen, halbe Schritte hätten bei diesem Vorhaben, bei dem die nationale Kompetenz der Geldpolitik auf die Gemeinschaft übertragen wird, das Projekt jederzeit kippen können. Vor allem die deutschen und französischen Verhandlungspositionen gingen oft weit auseinander. Bonn stellte eine autonome Zentralbank mit dem Ziel der Wahrung der Preisstabilität, die Vermeidung übermäßiger Haushaltsdefizite sowie einen Ablauf der EWU, der von der Erfüllung der Konvergenzkriterien abhängig war, in den Mittelpunkt. Hingegen drängte Paris auf einen genau festgelegten Terminplan, der eine frühe monetäre Institutionalisierung forderte. Ferner sollte die EZB von einer starken Wirtschaftsregierung politisch kontrolliert werden. In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden inwieweit Deutschland und Frankreich ihre Positionen durchsetzten konnten. Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die Gründe sowie Kosten und Nutzen einer gemeinsamen Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Anschließend werden die unterschiedlichen Motivationen Deutschlands und Frankreichs für die WWU aufgezeigt. Bestandteil des zweiten Teils dieser Arbeit werden die Verhandlungen zur EWU sowie deren Ergebnisse, im Rahmen der Regierungskonferenzen von 1990-1991, sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Wozu eine gemeinsame Europäische WWU?
- 2.1 Die ökonomische Situation in Europa Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre
- 2.2 Die Kosten und Nutzen einer europäischen Währungsunion
- 2.2.1 politische Notwendigkeit
- 2.2.2 ökonomischen Kosten und Nutzen
- 2.2.3 Die WWU- ein Zwilling?
- 3 Die Positionen Deutschlands und Frankreichs
- 3.1 Der Fall der Berliner Mauer und die Folgen für die EWU
- 3.2 Geopolitische Interessen und Ideologie
- 3.3 Ökonomische Interessen
- 3.4 Die deutsche Bundesbank und die Banque de France
- 3.5 Die nationalen Kompromisse
- 4 Die Regierungskonferenz über die Wirtschafts- und Währungsunion
- 4.1 Der Delors-Bericht
- 4.2 Organisation und Arbeitsweise der Regierungskonferenz
- 4.2.1 Zentrale Problembereiche
- 4.2.2 Die Ausgestaltung der zweiten Stufe
- 4.2.3 Die Ausgestaltung der dritten Stufe
- 4.2.4 Kohäsion und Finanztransfers
- 4.2.5 Die Europäische Zentralbank
- 4.2.6 Die Äußere Währungspolitik
- 5 Die Verhandlungsergebnisse
- 5.1 Der Vertrag über die Europäische Union
- 5.1.1 Haushaltsdisziplin und Konvergenz
- 5.1.2 Die Ausgestaltung der zweiten Stufe
- 5.1.3 Die Ausgestaltung der dritten Stufe
- 5.1.4 Kohäsion und Finanztransfers
- 5.1.5 Die Europäische Zentralbank
- 5.1.6 Die Äußere Währungspolitik
- 6 Fazit: Frankreich verliert das Spiel-Deutschland macht die Agenda
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Verhandlungen zur Europäischen Währungsunion am Beispiel Deutschlands und Frankreichs. Sie analysiert die ökonomischen und politischen Motive, die zur Etablierung einer gemeinsamen Währung führten, und untersucht die Positionen und Interessen der beiden Schlüsselstaaten im Verhandlungsprozess. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die unterschiedlichen Sichtweisen Deutschlands und Frankreichs hinsichtlich der Ausgestaltung der Europäischen Zentralbank und der Bedeutung von Haushaltsdisziplin.
- Die ökonomischen und politischen Bedingungen für die Gründung einer Europäischen Währungsunion
- Die unterschiedlichen Positionen und Interessen von Deutschland und Frankreich im Verhandlungsprozess
- Die Rolle der deutschen Bundesbank und der Banque de France bei der Gestaltung der Europäischen Zentralbank
- Die Bedeutung von Haushaltsdisziplin und Konvergenzkriterien im Rahmen der Währungsunion
- Der Einfluss des Verhandlungsergebnisses auf die zukünftige Gestaltung der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses und die Entstehung der Idee einer gemeinsamen Währungsunion. Kapitel 2 beleuchtet die ökonomische Situation in Europa Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre und analysiert die Kosten und Nutzen einer europäischen Währungsunion.
Kapitel 3 widmet sich den Positionen Deutschlands und Frankreichs in Bezug auf die Europäische Währungsunion. Es werden die geopolitischen Interessen und die ökonomischen Ziele der beiden Länder sowie die unterschiedlichen Vorstellungen zur Gestaltung der Europäischen Zentralbank betrachtet.
Kapitel 4 analysiert die Verhandlungen zur Wirtschafts- und Währungsunion, insbesondere die Organisation und Arbeitsweise der Regierungskonferenz sowie die zentralen Problembereiche und Verhandlungsergebnisse.
Kapitel 5 beleuchtet die Verhandlungsergebnisse, insbesondere den Vertrag über die Europäische Union, und zeigt die wichtigsten Punkte der Einigung, wie die Ausgestaltung der Europäischen Zentralbank und die Bedeutung von Haushaltsdisziplin, auf.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion, Wirtschafts- und Währungsunion, Deutschland, Frankreich, Europäische Zentralbank, Haushaltsdisziplin, Konvergenzkriterien, Verhandlungsprozess, geopolitische Interessen, ökonomische Interessen.
Häufig gestellte Fragen
Was war der „Wernerplan“?
Ein in den 1970er Jahren entwickelter Stufenplan zur Schaffung einer europäischen Währungsunion, der jedoch aufgrund politischer Differenzen und Krisen scheiterte.
Welche Position vertrat Deutschland bei den EWU-Verhandlungen?
Bonn forderte eine autonome Zentralbank nach Vorbild der Bundesbank, Preisstabilität, Haushaltsdisziplin und strikte Konvergenzkriterien.
Was forderte Frankreich im Gegensatz dazu?
Paris drängte auf einen festen Terminplan, eine frühe Institutionalisierung und eine politische Kontrolle der EZB durch eine starke Wirtschaftsregierung.
Welche Rolle spielte der Vertrag von Maastricht?
Der 1992 unterzeichnete Vertrag verankerte die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) rechtlich und legte den Weg zum Euro fest.
Wer setzte sich in den Verhandlungen weitgehend durch?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Deutschland die Agenda maßgeblich prägte, insbesondere hinsichtlich der Unabhängigkeit der EZB und der Stabilitätskriterien.
- Citation du texte
- Sarah Stolle (Auteur), 2005, Die Verhandlungen zur Europäischen Währungsunion am Beispiel Deutschland und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60546