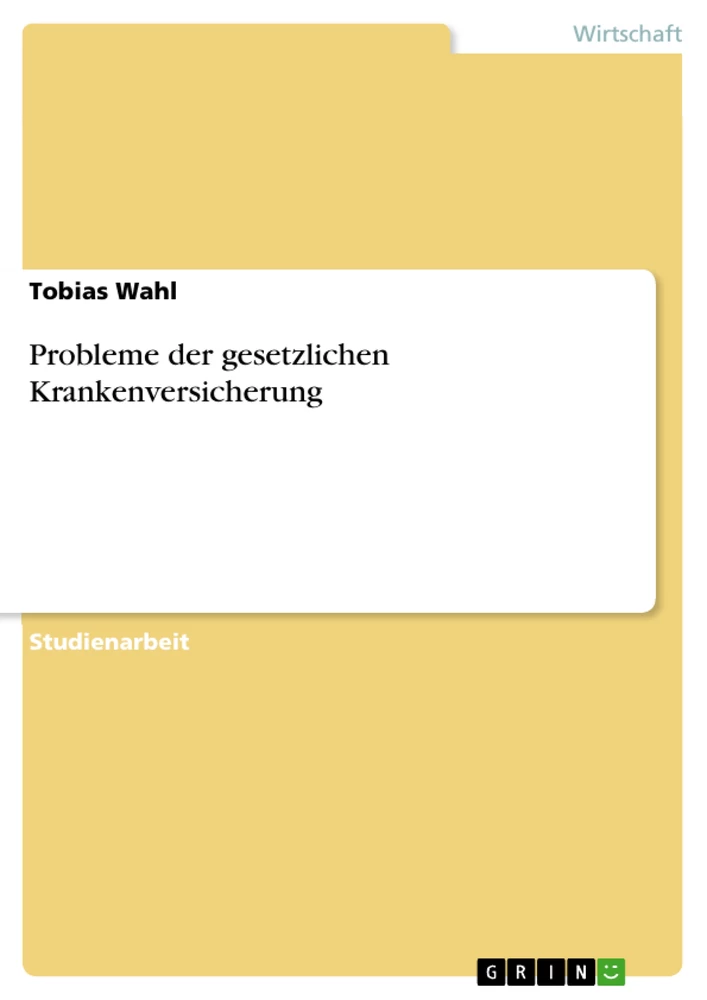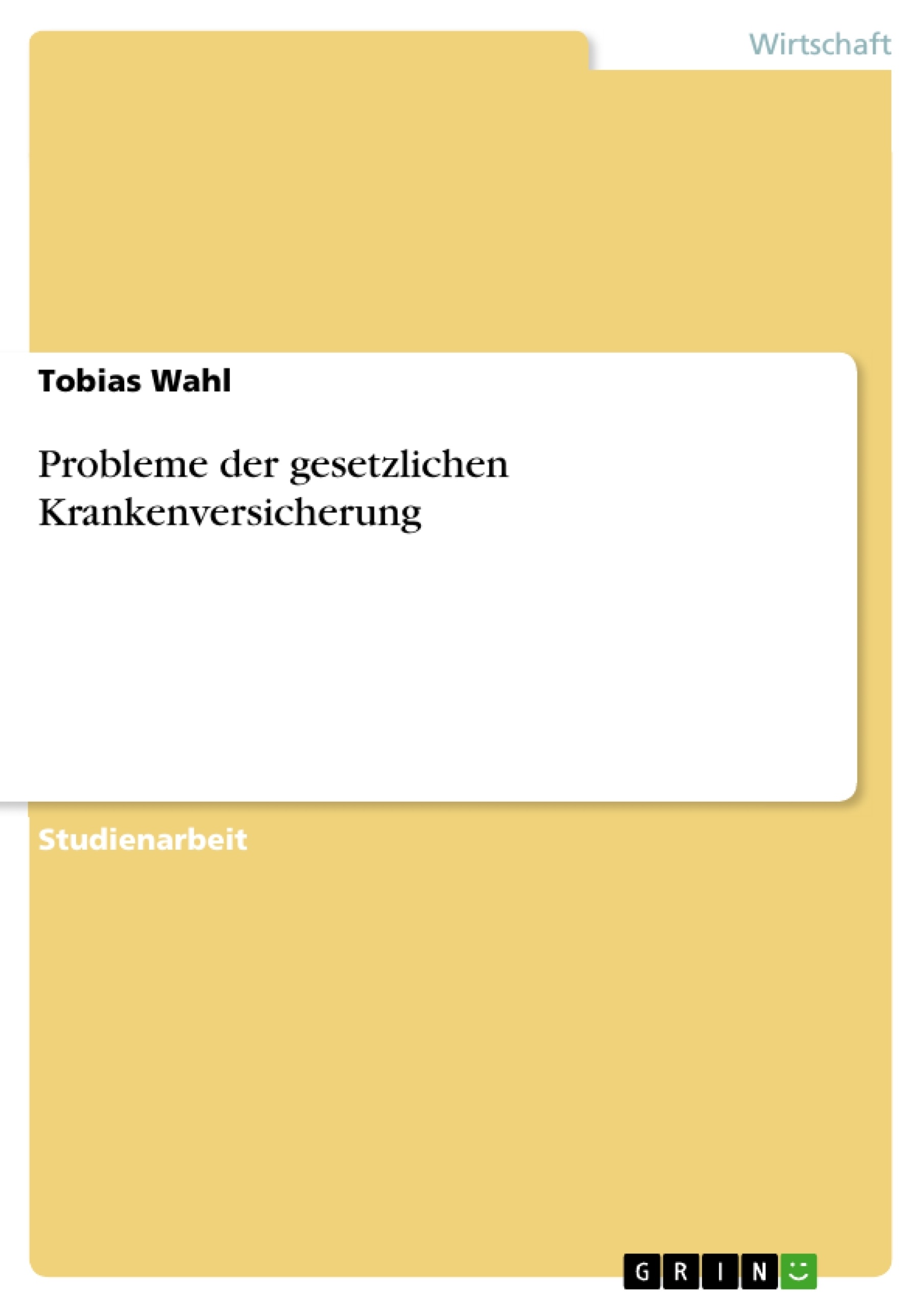Im Rahmen dieser Seminararbeit werden die Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), vor allem aus finanzwissenschaftlicher Sicht, betrachtet werden. Hierbei werden in zuerst die Entwicklung der Gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland, die aktuelle Situation, der Aufbau und die Leistungen einer GKV sowie die Rechtfertigung der Staatstätigkeit dargestellt. Im weiteren Verlauf werden ausführlich die Probleme der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgezeigt, mit den möglichen Reformvorschlägen bzw. Gestaltungsoptionen der Krankenversicherung fortgesetzt und mit einem Fazit abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen zur gesetzlichen Krankenversicherung
2.1. Das System der GKV in Deutschland
2.1.1. Entstehung des Systems in Deutschland
2.1.2. Aktuelle Situation in Deutschland
2.1.3. Aufbau und Leistungen der GKV
2.2. Rechtfertigung von Staatstätigkeit
3. Problembereiche der GKV
3.1. Principal-Agent-Problem
3.1.1. Moral Hazard
3.1.2. Adverse Selektion
3.2. Probleme auf Einnahmeseite
3.2.1. Demographische Probleme
3.2.2. Konjunkturelle Probleme
3.3. Probleme auf Ausgabenseite
3.3.1. Medizinisch-Technische Fortschritt
3.3.2. Demographischer Wandel
3.3.3. Problem der angebotsseitigen Nachfrageausweitung
3.2. Probleme der Beitragsbemessungsgrundlage
4. Reformvorschläge bzw. Gestaltungsoptionen
4.1. Aktuelle Reformvorschläge
4.2. Abwägung der Gestaltungsoptionen
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Marktanteile der gesetzlichen Krankenkassen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KM1, Stand 10/2005)
Abb. 2: Altersaufbau im Wandel (Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland 2003)
Abb. 3: Bruttoinlandsprodukt und Finanzierungsbasis der GKV (Quelle: Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 1994, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 2000, Bundesdruckerei 1999, Bundesministerium für Gesundheit 2001, Statistisches Bundesamt 2002, Arbeitskreis VGR 2002)
Abb. 4: Alterung in Deutschland von 1971 – 2050 (Quelle: ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in ieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Es wird teurer werden […] und der Staat wird weniger zuschießen“ (Bundeskanzlerin Angela Merkel), warnte Angela Merkel im März 2006 und kündigte an, die Bürger müssten sich darauf vorbereiten, dass in den kommenden Jahren weitere Kosten für die medizinische Versorgung auf sie zukommen werden. Diese Aussage basiert auf einem fünfstündigen Treffen der Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD und gibt einen Ausblick über die Auswirkungen der bevorstehenden Gesundheitsreformen für die einzelnen Bundesbürger in Deutschland. Grund hierfür ist, dass im Gesundheitssystem sieben bis zehn Milliarden Euro fehlen und die Koalitionäre die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt an die gesetzlichen Kassen streichen wollen.[1]
Im Rahmen dieser Seminararbeit sollen die Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), vor allem aus finanzwissenschaftlicher Sicht, betrachtet werden. Hierbei werden in Kapitel 2 zuerst die Entwicklung der GKV in Deutschland, die aktuelle Situation, der Aufbau und die Leistungen einer GKV sowie die Rechtfertigung der Staatstätigkeit dargestellt. In Kapitel 3 werden ausführlich die Probleme der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgezeigt und in Kapitel 4 mögliche Reformvorschläge bzw. Gestaltungsoptionen der Krankenversicherung diskutiert.
2. Grundlagen zur gesetzlichen Krankenversicherung
Das System der Krankenversicherung ist neben dem Prinzip der Fürsorge, worunter zum Beispiel das Verfahren der Sozialhilfe fällt, sowie dem Versorgungsprinzip, eines der zentralen Elemente im System der sozialen Sicherung. Die finanziellen Aufwendungen für das staatliche Sicherungssystem sind in den vergangenen Jahrzehnten aus diversen Gründen in den Industrienationen beträchtlich angestiegen, folglich kommt es in Deutschland zu einem Defizit von sieben bis zehn Milliarden Euro.[2]
Um die Risiken, krank oder pflegebedürftig zu werden, abzusichern, existieren im Rahmen der sozialen Sicherung die Systeme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der privaten Krankenversicherung (PKV) sowie der sozialen Pflegeversicherung (SPV).[3] Im Folgenden liegt der Fokus allerdings auf dem System der gesetzlichen Krankenversicherung.
2.1. Das System der GKV in Deutschland
In Deutschland gehören heute fast 90 Prozent der Bevölkerung einer der gesetzlichen Krankenversicherungen an. Die Mitglieder der GKV sind entweder pflichtversichert, oder, wenn ihr Jahreseinkommen die Versicherungspflichtgrenze überschreitet, fakultativ versichert. Allerdings ist in den vergangenen Jahren ein deutlicher Trend hin zur privaten Vollversicherung bzw. zur gesetzlichen Krankenversicherung mit privater Zusatzversicherung zu erkennen.[4] Diese Aussage belegen die Daten des BKK Bundesverbandes, welche besagen dass im Jahr 1980 11,4 Prozent der Bundesbürger entweder privat vollversichert oder privat zusatzversichert waren. Im Jahr 2004 waren es bereits 22,4 Prozent, die Leistungen der privaten Krankenversicherungen in Anspruch nahmen.[5]
2.1.1. Entstehung des Systems in Deutschland
Bereits im Jahre 1883 entwickelte Reichskanzler Bismarck im Sinne der finanziellen Absicherung der Bevölkerung für den Krankheitsfall mit der gesetzlichen Krankenversicherung ein umfangreiches staatliches Zwangssicherungssystem. Dieses System der sozialen Sicherung war Vorbild für die Sozialversicherungssysteme in vielen Industrienationen. Die Entschädigung für den Ausfall des Arbeitsentgeltes zur Deckung der Lebenshaltungskosten stand damals im Vordergrund. Nur zweitrangig wurde die Behandlung der Kranken finanziert.[6] Schon damals umfasste der Leistungskatalog Leistungen, wie zum Beispiel das Krankengeld, ärztliche Behandlung, Arznei- und Hilfsmittel, Krankenhausbehandlung, Sterbegeld und Wöchnerinnenunterstützung (Mutterschaftshilfe). Seinerzeit waren die Strukturen ähnlich wie heute, wobei die Arbeitgeber entgegen dem heutigen System nur 1/3 der Beiträge trugen und die Versicherungsnehmer 2/3.[7]
2.1.2. Aktuelle Situation in Deutschland
Heute unterteilen sich die gesetzlichen Krankenkassen in die allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Betriebskrankenkassen (BKK), Innungskrankenkassen (IKK), Ersatzkassen für Angestellte und Arbeiter (EAN), landwirtschaftlichen Krankenkassen (EAR) sowie Bundesknappschaften und Seekrankenkassen.[8]
Die Marktanteile der gesetzlichen Krankenkassen AOK, BKK und EAN machten 2005 knapp 80 Prozent des gesamten Marktvolumens aus, die anderen Krankenkassen hingegen spielten eine eher untergeordnete Rolle.[9] (siehe Abbildung 1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb. 1: Marktanteile der gesetzlichen Krankenkassen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KM1, Stand 10/2005)
Im Gegensatz zu den privaten Krankenversicherungen kann innerhalb der GKV jedes Mitglied ohne Rücksicht auf Berufs- oder Betriebszugehörigkeiten die Krankenkasse frei wählen. Diese gesetzlichen Krankenversicherungen dürfen keinem Versicherungsberechtigten verweigert werden.[10]
Die Versicherung in der GKV ist außer für Beamte, Selbständige oder Personen, deren Lohn- oder Arbeitseinkommen die Versicherungspflichtgrenze übersteigt, obligatorisch. Wenn die Versicherungspflichtgrenze von 3.937,50 Euro je Monat überschritten wird, haben die Versicherungsnehmer die Wahl, ob sie als freiwilliges Mitglied in derGKV bleiben oder sich bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichern.[11]
[...]
[1] vgl. Die Zeit 30.03.2006
[2] vgl. Dietmar Wellisch 2000, S. 227
[3] vgl. Breyer/Franz/Homburg/Schnabel/Wille 2004, S.79
[4] vgl. Baßeler/Heinrich/Utecht 2006, S.452
[5] vgl. BKK Bundesverband, Rechenschaftsbericht der PKV
[6] vgl. Bohnet 1999, S.300
[7] vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Sozialversicherung_in_Deutschland
[8] vgl. Lampert 2004, S.249
[9] vgl. http://www.bkk.de/bkk/powerslave,id,931,nodeid,931,p,0.htmld
[10] vgl. http://www.cecu.de/590+M5ee19dd9edc.html
[11] vgl. http://www.die-gesundheitsreform.de/glossar/versicherungspflichtgrenze.html
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)?
Zu den Hauptproblemen zählen finanzielle Defizite durch den demographischen Wandel, steigende Kosten durch medizinisch-technischen Fortschritt und ökonomische Probleme wie "Moral Hazard".
Was versteht man unter "Moral Hazard" im Gesundheitssystem?
Es beschreibt das Phänomen, dass Versicherte Leistungen unkritischer in Anspruch nehmen oder weniger auf ihre Gesundheit achten, weil die Kosten von der Versichertengemeinschaft getragen werden.
Wie beeinflusst der demographische Wandel die GKV?
Eine alternde Gesellschaft führt zu sinkenden Einnahmen (weniger Beitragszahler) bei gleichzeitig massiv steigenden Ausgaben für die medizinische Versorgung im Alter.
Was ist der Unterschied zwischen GKV und PKV?
Die GKV basiert auf dem Solidaritätsprinzip (Beiträge nach Einkommen), während die private Krankenversicherung (PKV) Beiträge nach individuellem Risiko und Alter berechnet.
Wer begründete das System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland?
Reichskanzler Otto von Bismarck führte die gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 1883 als Teil der Sozialgesetzgebung ein.
- Quote paper
- Tobias Wahl (Author), 2006, Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60551