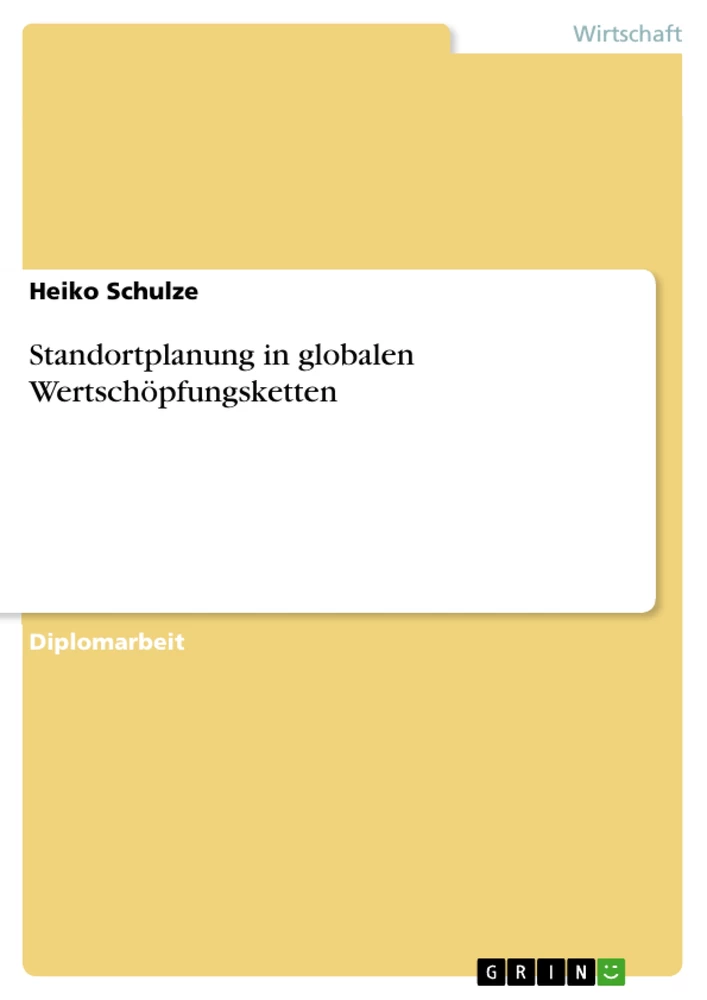Die Globalisierung der Weltwirtschaft erfordert von Unternehmen die Nutzung der Vorteile der internationalen Standorte um den Herausforderungen der internationalen Konkurrenz begegnen zu können und den differenzierten Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Daher ist die Problematik der Standortplanung eine Fragestellung, die immer größere Bedeutung erlangt.
Gerade auch die Automobilindustrie, als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutsch-ands, entdeckte in der ersten Hälfte der 1990er Jahre die Globalisierung. Dadurch stand sie vor der Entscheidung zukünftige Produktionsstandorte den geänderten Anforderungen abzupassen. Es hat sich auch gezeigt, dass verschiedene Länder weltweit unterschiedliche Vorteile für einzelne Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette haben. Das Unternehmen muss die maßgeblichen Investitionen auf den einzelnen Stufen betrachten, um dann zu bewerten, ob es sich lohnt, verschiedenen Aktivitäten an unterschiedlichen Orten nachzugehen. Die Verlegung von Standorten bzw. die Errichtung von neuen Standorten im Ausland ist ein strategischer Entscheidungsprozess und erfordert eine detaillierte Planung und eine Auseinandersetzung mit den zukünftigen Zielen des Unternehmens. Auch werden die zunehmenden Produktionsverlagerungen deutscher Unternehmen ins Aus-land mit der Verschlechterung inländischen Standortfaktoren in Verbindung gebracht. Für den Erfolg des Unternehmens ist es daher entscheidend sich ständig mit der Frage der richtigen Produktionsstandorte auseinanderzusetzen. Ziel dieser Diplomarbeit ist es die Standortplanung in ihren theoretischen Gründzügen und einer praktischen Fallstudie darzustellen. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit wird daher die Standortentscheidung als betriebliches Entscheidungsproblem der international tätigen Industrieunternehmung sein. Dabei wird die Automobilindustrie eine entscheidende Rolle spielen. Die deutsche Automobilindustrie ist für diese Untersuchung prädestiniert. Sie ist einerseits ein Paradebeispiel für eine globale Branche, was sich an zahlreichen Auslandsstand-orten der Unternehmen deutlich zeigt. Andererseits gilt sie als eine der Schlüsselbranchen der deutschen Volkswirtschaft. Mit der Automobilindustrie und speziell mit dem Beispiel Daimler Chrysler in Tuscaloosa soll die praktische Umsetzung der Standortplanung aufgezeigt werden. Dabei werden auch die globalen Einflüsse, die auf das Unternehmen als Teil einer Wertschöpfungskette bzw. eines Netzwerkes wirken, betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Methodik
- 1.4. Abgrenzung
- 2. Strategische Standortplanung
- 2.1. Definitionen
- 2.1.2. Standortfaktoren
- 2.1.3. Standortanforderungen
- 2.1.4. Standortbedingungen
- 2.1.5. Standortspaltung
- 2.1.6. Internationale Standortverlagerung
- 2.2. Standortstrategien
- 2.3. Motive für Standortverlagerungen
- 2.4. Problemfelder der Standortwahl
- 2.5. Ansätze nationaler und internationaler Standortlehren
- 2.5.1. Die traditionelle Theorie von Weber
- 2.5.2. Der Ansatz von Sabathil
- 2.5.3. Der Ansatz von Tesch
- 2.6. Traditionelle Standortbewertungsverfahren
- 2.6.1. Quantitative Verfahren
- 2.6.2. Qualitative Verfahren
- 2.6.3. Fazit
- 2.7. Neue Instrumente der Standortbewertung
- 3. Wertschöpfungsketten und Netzwerke im Blickpunkt der Standortplanung
- 3.1. Wertschöpfungsketten als moderne Ausprägung grenzenloser Unternehmen
- 3.2. Der Kunde als Wertschöpfungspartner
- 3.3. Die wachsende Bedeutung der Netzwerke
- 3.4. Netzwerke in der Automobilindustrie
- 3.5. Risiken und Gefahren der bestehenden Strukturen
- 3.6. Fazit
- 4. Einfluss der Globalisierung auf die Standortwahl
- 4.1. Zentrale Merkmale der Globalisierung
- 4.2. Ursachen der Globalisierung
- 4.3. Globalisierungsstrategien
- 4.4. Globalisierung und Standortwettbewerb
- 5. Die Automobilindustrie im Zeichen der Standortplanung
- 5.1. Die Automobilhersteller
- 5.1.1. Strategien der Automobilhersteller
- 5.1.2. Chancen und Risiken für die Automobilhersteller
- 5.2. Die Zuliefererindustrie
- 5.2.1. Strategien der Zuliefererindustrie
- 5.2.2. Chancen und Risiken für die Zuliefererindustrie
- 5.3. Zielrichtung der automobilen Globalisierung
- 5.3.1. Westeuropa als Produktionsstandort
- 5.3.2. Osteuropa als Produktionsstandort
- 5.3.3. Asien als Produktionsstandort
- 5.3.4. Nordamerika als Produktionsstandort
- 5.3.5. Südamerika als Produktionsstandort
- 6. Fallstudie
- 6.1. Grundsätzlicher Aufbau von Fallstudien
- 6.2. Das Unternehmen DaimlerChrysler AG
- 6.3. Standortplanung am Beispiel Tuscaloosa
- 6.3.1. Allgemeiner Überblick
- 6.3.2. Motive
- 6.3.3. Projektteams
- 6.3.4. Standortauswahl
- 6.3.5. Heutige und zukünftige Situation
- 6.3.6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Standortplanung in globalen Wertschöpfungsketten. Sie verbindet theoretische Grundlagen der Standortplanung mit einem praxisbezogenen Fallbeispiel aus der Automobilindustrie. Ziel ist es, die Komplexität der Standortentscheidungen in einem globalisierten Umfeld aufzuzeigen und Lösungsansätze zu präsentieren.
- Definition und Strategien der Standortplanung
- Wertschöpfungsketten und Netzwerke in der globalisierten Wirtschaft
- Der Einfluss der Globalisierung auf die Standortwahl
- Standortplanung in der Automobilindustrie (Hersteller und Zulieferer)
- Fallstudie: Standortplanung bei DaimlerChrysler AG in Tuscaloosa (USA)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Standortplanung in globalen Wertschöpfungsketten ein, beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und die angewandte Methodik. Es grenzt den Forschungsgegenstand ab und legt den Fokus auf die Herausforderungen der Standortwahl im Kontext der zunehmenden Globalisierung.
2. Strategische Standortplanung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe der strategischen Standortplanung, wie Standortfaktoren, -anforderungen und -bedingungen. Es erläutert verschiedene Standortstrategien, Motive für Standortverlagerungen und die damit verbundenen Problemfelder. Darüber hinaus werden klassische Ansätze der Standortlehre (Weber, Sabathil, Tesch) sowie traditionelle und neue Standortbewertungsverfahren vorgestellt und kritisch betrachtet. Der Fokus liegt auf der systematischen Analyse der Entscheidungsfindungsprozesse bei der Standortwahl.
3. Wertschöpfungsketten und Netzwerke im Blickpunkt der Standortplanung: Dieses Kapitel untersucht Wertschöpfungsketten und Netzwerke als moderne Organisationsformen in globalisierten Unternehmen. Es analysiert die Rolle des Kunden als Wertschöpfungspartner und die zunehmende Bedeutung von Netzwerken, insbesondere in der Automobilindustrie. Die damit verbundenen Risiken und Chancen werden beleuchtet, und es wird ein umfassendes Verständnis für die Interdependenzen innerhalb dieser Strukturen geschaffen.
4. Einfluss der Globalisierung auf die Standortwahl: Dieses Kapitel analysiert die zentralen Merkmale und Ursachen der Globalisierung und deren Auswirkungen auf die Standortwahl. Es untersucht verschiedene Globalisierungsstrategien und den damit verbundenen Standortwettbewerb. Der Fokus liegt auf den Chancen und Risiken, die sich aus der Globalisierung für Unternehmen ergeben, und wie diese im Rahmen der Standortplanung berücksichtigt werden müssen.
5. Die Automobilindustrie im Zeichen der Standortplanung: Dieses Kapitel betrachtet die Automobilindustrie, getrennt nach Herstellern und Zulieferern, im Hinblick auf ihre Standortplanung. Es analysiert die Strategien, Chancen und Risiken beider Gruppen und beleuchtet die regionale Verteilung der Produktionsstandorte. Die Kapitel gibt einen Überblick über die globale Ausrichtung der Automobilproduktion und die damit verbundenen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Standortplanung, globale Wertschöpfungsketten, Globalisierung, Automobilindustrie, Standortfaktoren, Standortstrategien, Standortverlagerung, Wertschöpfungsnetzwerke, Fallstudie, DaimlerChrysler AG, Tuscaloosa.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Standortplanung in globalen Wertschöpfungsketten
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die strategische Standortplanung in globalen Wertschöpfungsketten, insbesondere im Kontext der Automobilindustrie. Sie verbindet theoretische Grundlagen mit einer praxisbezogenen Fallstudie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Strategien der Standortplanung, Wertschöpfungsketten und Netzwerke in der globalisierten Wirtschaft, den Einfluss der Globalisierung auf die Standortwahl, die Standortplanung in der Automobilindustrie (Hersteller und Zulieferer) und eine Fallstudie zur Standortplanung bei DaimlerChrysler AG in Tuscaloosa (USA).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf klassische Ansätze der Standortlehre (z.B. Weber, Sabathil, Tesch), analysiert traditionelle und neue Standortbewertungsverfahren und betrachtet Wertschöpfungsketten und Netzwerke als moderne Organisationsformen.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine Literaturrecherche mit einer Fallstudie. Die Fallstudie analysiert die Standortentscheidung von DaimlerChrysler in Tuscaloosa, um die theoretischen Konzepte zu illustrieren und zu überprüfen.
Welche Aspekte der Globalisierung werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die zentralen Merkmale und Ursachen der Globalisierung, untersucht verschiedene Globalisierungsstrategien und den damit verbundenen Standortwettbewerb sowie die Chancen und Risiken, die sich aus der Globalisierung für Unternehmen ergeben.
Wie wird die Automobilindustrie behandelt?
Die Arbeit analysiert die Automobilindustrie getrennt nach Herstellern und Zulieferern, betrachtet deren Strategien, Chancen und Risiken und beleuchtet die regionale Verteilung der Produktionsstandorte weltweit.
Was ist der Fokus der Fallstudie?
Die Fallstudie konzentriert sich auf die Standortplanung von DaimlerChrysler AG in Tuscaloosa (USA). Sie untersucht die Motive, die Projektteams, die Standortauswahl und die heutige und zukünftige Situation des Werks.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Standortplanung, globale Wertschöpfungsketten, Globalisierung, Automobilindustrie, Standortfaktoren, Standortstrategien, Standortverlagerung, Wertschöpfungsnetzwerke, Fallstudie, DaimlerChrysler AG, Tuscaloosa.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu strategischer Standortplanung, Wertschöpfungsketten und Netzwerken, dem Einfluss der Globalisierung, der Automobilindustrie und eine abschliessende Fallstudie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Komplexität der Standortentscheidungen in einem globalisierten Umfeld aufzuzeigen und Lösungsansätze zu präsentieren. Sie soll ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen der Standortwahl in globalen Wertschöpfungsketten vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Heiko Schulze (Autor:in), 2005, Standortplanung in globalen Wertschöpfungsketten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60594