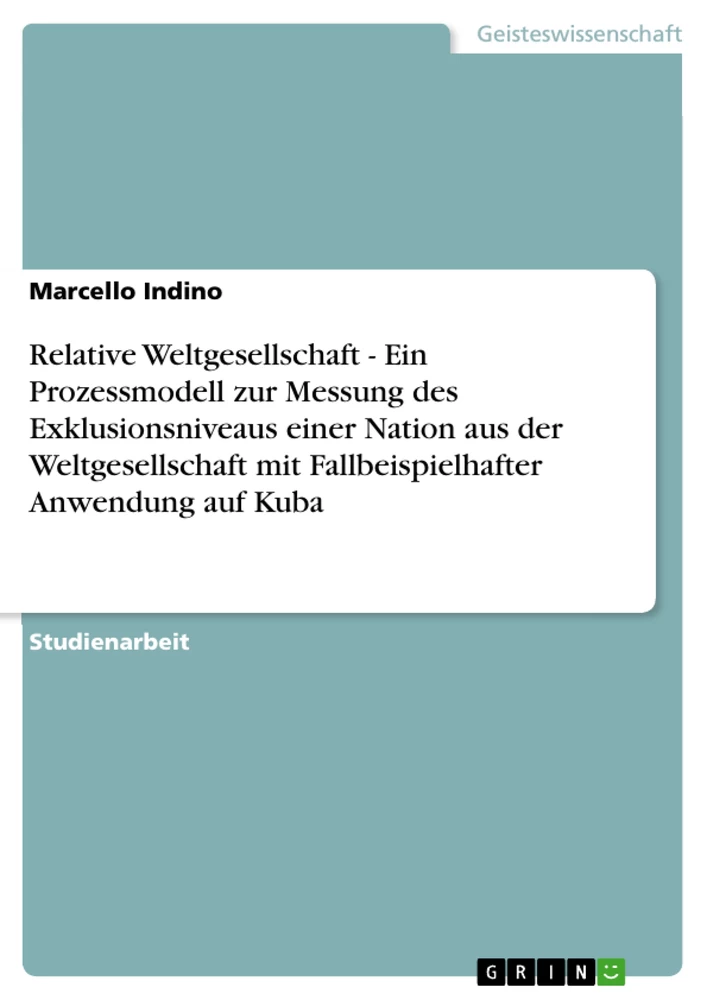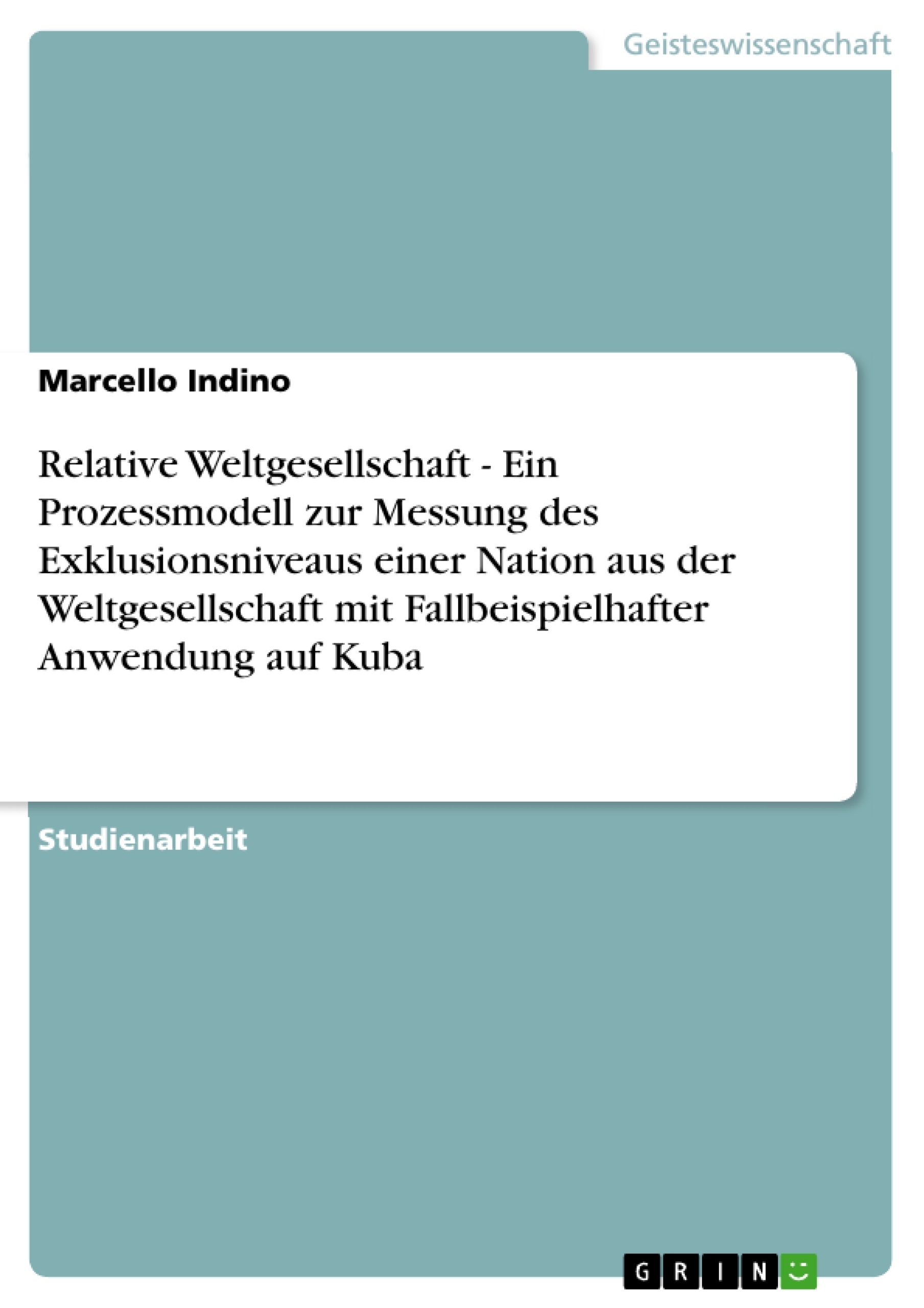1945 gründeten einundfünfzig Staaten die Vereinten Nationen und legten - nach dem gescheiterten, weil einflusslosen Völkerbund - den Grundstein zur Konstituierung der zu diesem Zeitpunkt noch schwachen Weltgesellschaft (Bornschier, 2002a, S. 19). Mit gewisser peinlicher Berührung stellen wir fest, dass die beiden Kleinstinselstaaten Demokratische Republik Osttimor und Schweizerische Eidgenossenschaft sich erst zu Beginn des dritten Jahrtausend überwinden konnten, den Vereinten Nationen beizutreten. Immerhin, denn bis heute besitzen neben dem Heiligen Stuhl noch vier weitere Staaten keine Vollmitgliedschaft. Auch die mehr als einundzwanzigtausend Einwohner der Cook Islands verhindern bis heute die politische Vollkonstituierung der Weltgesellschaft. Man könnte annehmen, dass solange sich nicht alle Staaten der Welt zu einer gemeinsamen Organisation (welcher Natur auch immer) zusammenschliessen, von Weltgesellschaft nicht die Rede sein darf. Über dieses strenge Kriterium kann nur hinweggesehen werden, wenn man die Weltgesellschaft nicht alsbestehendes,sondern alsentstehendesFaktum betrachtet. Bornschier (2002b, S. 685) sieht den Wert der Entwicklung als ein Ausdruck gemeinsamer Leitvorstellungen in der Weltgesellschaft. Bestehendes schliesst Entwicklung aber aus, Entstehendes ist hingegen ihr Äquivalent. Sobald die Weltgesellschaft sich final konstituiert hat, respektiert sie eine ihrer Leitvorstellungen nicht mehr und bestreitet somit endogen ihre eigene Existenz. Durch ewig (!) dauernde Beitrittsverhandlungen erlaubt beispielsweise der Vatikan die Respektierung der weltgesellschaftlichen Leitvorstellungen der Entwicklung. Thema dieser Arbeit soll aber die andere Seite der Medaille sein. Festgehalten wurde, dass der Beitritt der meisten Staaten der Welt zu den Vereinten Nationen den Grundstein zur Konstituierung der Weltgesellschaft legte. Die Nichtteilhabe gewisser Nationen - also der ausdrückliche Wille dieser Staaten nicht Vollmitglied der Vereinten Nationen, resp. der Weltgesellschaft sein zu wollen - legitimiert wiederum wie gesagt deren Existenz im Sinne der Entwicklungsleitvorstellung. Aber was ist mit dem Ausschluss eines Staates aus der Weltgesellschaft? Ist er ebenfalls ein diesbezüglicher Beitrag, weil er das ganze Konstrukt in Bewegung hält? Oder ist der Ausschluss per se gar nicht möglich, weil man von dem Moment an nur von partieller, relativer Weltgesellschaft sprechen müsste (und dadurch ein Paradox künstlich am Leben erhalten würde)? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Fragestellung und methodisches Vorgehen
- Exklusion - Eine kurze Begriffsgeschichte
- Frankreich: L'exclusion et la désaffiliation
- Vereinigten Staaten: The Underclass
- Exklusion - Die theoretische Begriffskonzeption
- Ferdinand Tönnies
- Georg Simmel
- Maximilian Weber
- Talcott Parsons
- Schematische Zusammenführung – Das Prozessmodell
- Die Vorphase - Rationalisierungsdimension
- Die Hauptphase - Prozessdimension
- Die Folgephase - Konsequenz- und Ordnungsdimension
- Fallbeispiel Fidel Castros kubanische Revolution
- Erster Revolutionärer Aufstand unter José Marti
- Wirtschaftliche Krise Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts
- Wirtschaftliche Abhängigkeit um die Jahrhundertwende
- Weltwirtschaftskrise zwischen den beiden Weltkriegen
- Zweiter Revolutionärer Aufstand unter Fidel Castro
- Zusammenfassende Analysen und Bewertungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie das Ausschlussniveau einer Nation aus der Weltgesellschaft messbar ist. Hierfür wird ein Prozessmodell entwickelt, das auf den soziologischen Theorien von Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Max Weber und Talcott Parsons basiert. Das Modell wird anhand des Fallbeispiels Kuba angewendet, um zu analysieren, ob und inwiefern Kuba aus der Weltgesellschaft ausgeschlossen ist.
- Entwicklung eines Prozessmodells zur Messung des Exklusionsniveaus einer Nation aus der Weltgesellschaft
- Analyse des Exklusionsbegriffs anhand verschiedener soziologischer Theorien
- Anwendung des Prozessmodells auf das Fallbeispiel Kuba
- Beurteilung der Tauglichkeit des Prozessmodells zur Untersuchung von Exklusion aus der Weltgesellschaft
- Diskussion der Implikationen für die Analyse von internationalen Beziehungen und die Gestaltung der Weltgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitende Fragestellung und methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage nach der Möglichkeit des Ausschlusses einer Nation aus der Weltgesellschaft. Es erläutert das methodische Vorgehen der Arbeit und präsentiert das Prozessmodell als analytisches Werkzeug.
- Kapitel 2: Exklusion - Eine kurze Begriffsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet den Exklusionsbegriff aus historischer Perspektive. Es zeigt, wie das Konzept der Exklusion in Frankreich und den Vereinigten Staaten entwickelt wurde und welche sozialen Phänomene damit in Verbindung gebracht wurden.
- Kapitel 3: Exklusion - Die theoretische Begriffskonzeption: Dieses Kapitel analysiert den Exklusionsbegriff aus soziologischer Perspektive. Es präsentiert die Ansichten von Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Max Weber und Talcott Parsons, um eine vielschichtige theoretische Grundlage für das Prozessmodell zu schaffen.
- Kapitel 4: Schematische Zusammenführung – Das Prozessmodell: Dieses Kapitel beschreibt das Prozessmodell, das zur Messung des Exklusionsniveaus einer Nation aus der Weltgesellschaft entwickelt wurde. Das Modell besteht aus drei Phasen: Vorphase, Hauptphase und Folgephase.
- Kapitel 5: Fallbeispiel Fidel Castros kubanische Revolution: Dieses Kapitel analysiert die Geschichte Kubas im Hinblick auf seine mögliche Exklusion aus der Weltgesellschaft. Es untersucht die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen Kubas und betrachtet deren Einfluss auf die Beziehung Kubas zur Weltgesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Exklusion, Weltgesellschaft, Prozessmodell, soziologische Theorien, Kuba, Fidel Castro, internationale Beziehungen, Menschenrechte und Entwicklung. Sie analysiert die Frage, wie das Ausschlussniveau einer Nation aus der Weltgesellschaft gemessen werden kann und wie die soziologischen Theorien von Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Max Weber und Talcott Parsons dabei helfen können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit zur Weltgesellschaft?
Die Arbeit untersucht, ob und wie der Ausschluss (Exklusion) einer Nation aus der Weltgesellschaft messbar ist.
Welches Fallbeispiel wird zur Analyse genutzt?
Das Prozessmodell wird fallbeispielhaft auf Kuba und die dortige Revolution unter Fidel Castro angewendet.
Welche soziologischen Theoretiker werden herangezogen?
Die Arbeit basiert auf Theorien von Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Max Weber und Talcott Parsons.
Wann konstituierte sich die moderne Weltgesellschaft?
Als wichtiger Meilenstein gilt die Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945.
Was bedeutet Exklusion im Kontext einer Nation?
Es beschreibt den Zustand, in dem ein Staat nicht an den globalen Leitvorstellungen (z.B. Entwicklung, Menschenrechte) teilnimmt oder aktiv aus internationalen Organisationen ausgeschlossen wird.
- Quote paper
- Marcello Indino (Author), 2006, Relative Weltgesellschaft - Ein Prozessmodell zur Messung des Exklusionsniveaus einer Nation aus der Weltgesellschaft mit Fallbeispielhafter Anwendung auf Kuba, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60636