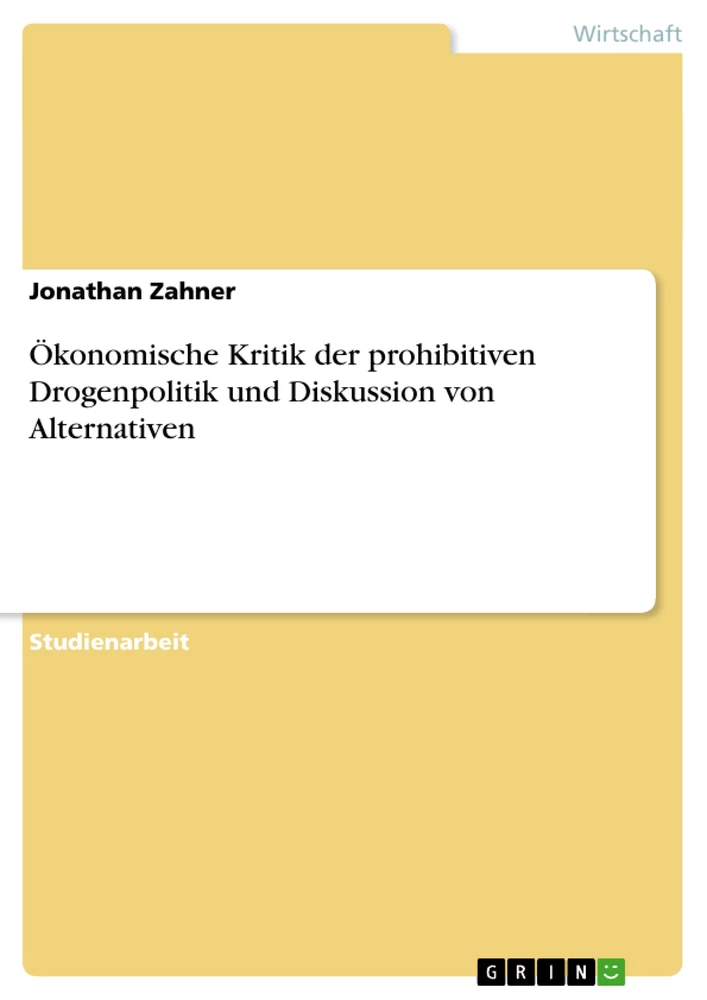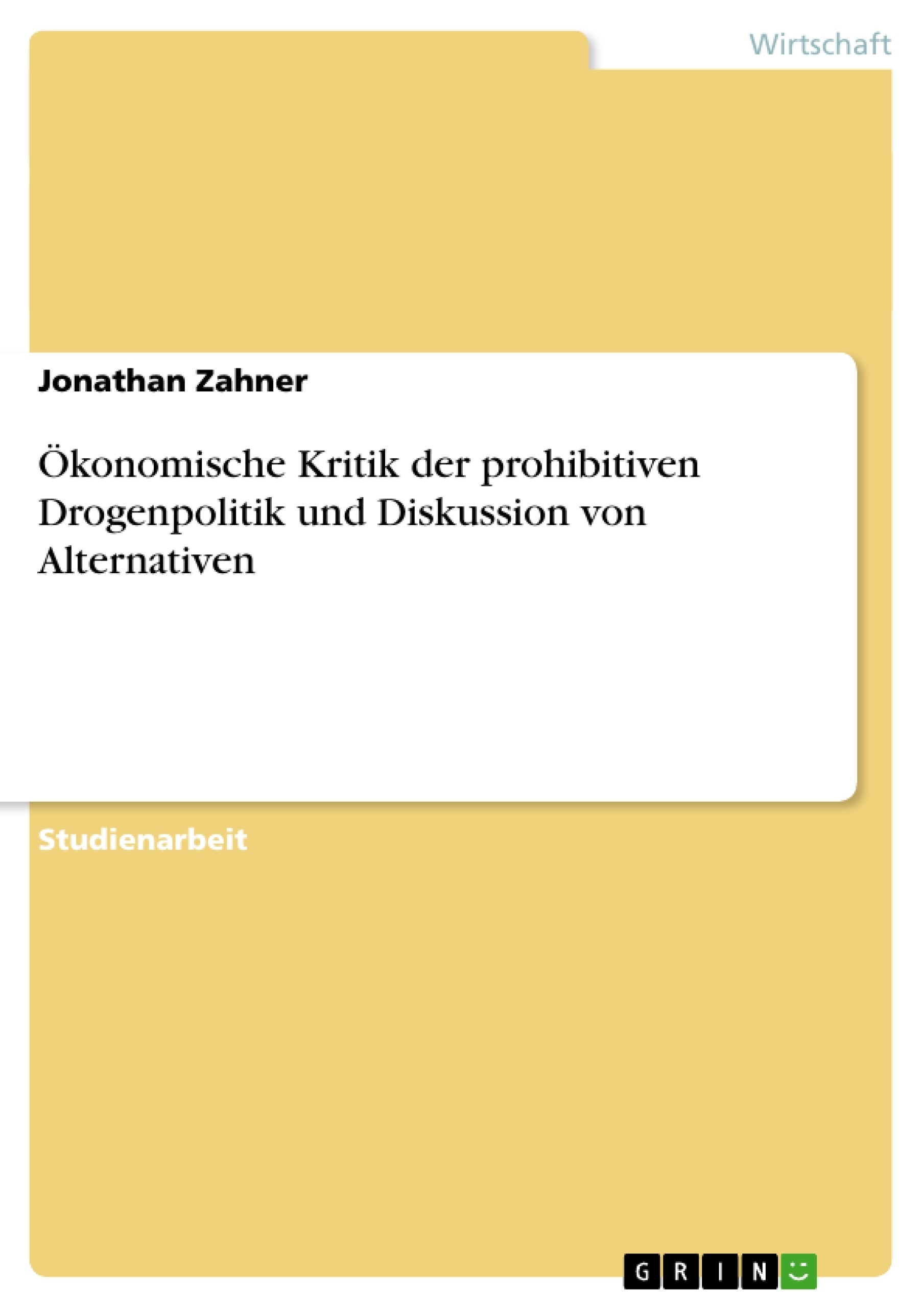Die der ökonomischen Theorie zugrundegelegte Modellierung der Individuen geht von einem schier unbegrenzten Maß an Rationalität aus. Entsprechende Akteure werden im Interesse ihrer Nutzenmaximierung stets sinnvolle Handlungsoptionen wählen. Im Rahmen einer ökonomischen Sozialvertragstheorie ist es dann Aufgabe des Staates die Handlungsfreiheit der Individuen dort zu beschräken, wo durch sie die Rechte anderer Individuen beeinträchtigt werden (könnten). Eine Rechtfertigung von nicht-konfliktären Handlungsbeschränkungen hingegen ist in diesem Kontext nicht möglich. Im politischen Geschehen werden solche gewöhnlich paternalistisch begründet, so beispielsweise die Helmpflicht für Motorradfahrer und auch die Drogenprohibition. Eine derartige Begründung ist problematisch, weil durch die Einschränkungen ausschließlich der jeweils Handelnde geschützt werden kann, da kein anderer in seinen Interessen durch die Handlung bedroht ist. Da die Individuen aber sowohl als ökonomische Akteure wie auch als Staatsbürger mündig und mit rationaler Entscheidungsfähigkeit versehen angenommen werden, scheinen nichtkonfliktäre Beschränkungen „bestenfalls überflüssig, schlechtestenfalls [...] einen mit Nutzeneinbussen verbundenen und daher nicht über Konsens legitimierten Eingriff in die Freiheit des einzelnen dar[zustellen].“ Fortgesetzter Drogenmissbrauch ist zunächst als massiv selbstschädigendes Verhalten mit der Annahme von Rationalität unvereinbar. Durch Abrücken vom „Rational-Choice“-Ansatz, dem Zugeständnis eines ‚multiple selfs’ lässt sich solches Verhalten als Problem der Machtverhältnisse zwischen langfristigem Planer und kurzfristig agierendem Macher beschreiben, oder aber als eine falsche Diskontierung des Nutzens: „Ein Suchtproblem resultiert daraus, dass die langfristigen negativen Konsequenzen des Drogenkonsums im Vergleich zum unmittelbaren Kick systematisch unterschätzt werden. In der jeweiligen Konsumentscheidung werden damit geringere Opportunitätskosten in Rechnung gestellt, als sich langfristig ergeben.“ Das Erkennen eines solchen Misstandes durch ein rationales Individuum muss zum Bestreben führen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten in geeigneter Weise zu beschränken. Solcher Selbstpaternalismus kann von einer durch Selbstdisziplin geleisteten Veränderung der Präferenzordnung bis zur Suspendierung der Entscheidungsbefugnis - die durch Dritte überwacht zu werden hat - reichen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführendes und Programm
- Entwicklung und Interessenlage der Drogenpolitik
- Historie der problematischen Politik
- Interessen der beteiligten Gruppen
- Resultierende Zielsetzungen
- Intention und Wirkung der Totalprohibition
- Das Prohibitionskonzept
- Konkrete Ausgestaltung
- Besonderheiten des Rauschgiftmarkts und Auswirkungen
- Fazit zur Prohibition
- Alternative Strategien
- Kontrollierte Teilliberalisierung
- Programm und Intention
- Mögliche Einwände
- Legalisierung
- Prohibitionsverschärfung
- Kontrollierte Teilliberalisierung
- Ausblick im Rückblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die ökonomische Kritik an der prohibitiven Drogenpolitik und diskutiert alternative Strategien. Sie hinterfragt die rationale Grundlage der Drogenprohibition und zeigt die Widersprüche zwischen der intendierten und der tatsächlichen Wirkung repressiver Maßnahmen auf.
- Ökonomische Kritik an der Drogenprohibition
- Analyse der Interessenlage der beteiligten Gruppen
- Bewertung der Wirksamkeit repressiver Maßnahmen
- Diskussion alternativer Strategien (Teilliberalisierung, Legalisierung)
- Ethische und gesellschaftliche Aspekte des Drogenkonsums
Zusammenfassung der Kapitel
Einführendes und Programm
Das einleitende Kapitel stellt die ökonomische Theorie der Individuenrationalität und die damit verbundene Problematik paternalistischer Handlungsbeschränkungen vor. Es thematisiert das Dilemma des Suchtverhaltens im Spannungsfeld zwischen Rationalität und Selbstpaternalismus.
Entwicklung und Interessenlage der Drogenpolitik
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Drogenpolitik und zeigt, wie verschiedene Mythen und Interessen die Gesetzgebung beeinflusst haben. Es analysiert die Interessen der beteiligten Gruppen (Staat, Pharmaindustrie, Konsumenten etc.) und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Drogenpolitik.
Intention und Wirkung der Totalprohibition
Dieses Kapitel analysiert die Intention und die tatsächliche Wirkung der Drogenprohibition am Beispiel des Heroinmarktes. Es zeigt, wie die Kriminalisierung des Drogenkonsums zu negativen Folgen für die Konsumenten, den Markt und die Gesellschaft führt.
Alternative Strategien
In diesem Kapitel werden alternative Strategien zur Drogenpolitik diskutiert, darunter kontrollierte Teilliberalisierung und Legalisierung. Die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Ansätze werden erörtert.
Schlüsselwörter
Drogenpolitik, Prohibition, Teilliberalisierung, Legalisierung, ökonomische Analyse, Interessenkonflikte, Sucht, Rationalität, Selbstpaternalismus, Heroin, Drogenmarkt, Kriminalität.
- Quote paper
- Jonathan Zahner (Author), 2005, Ökonomische Kritik der prohibitiven Drogenpolitik und Diskussion von Alternativen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60640