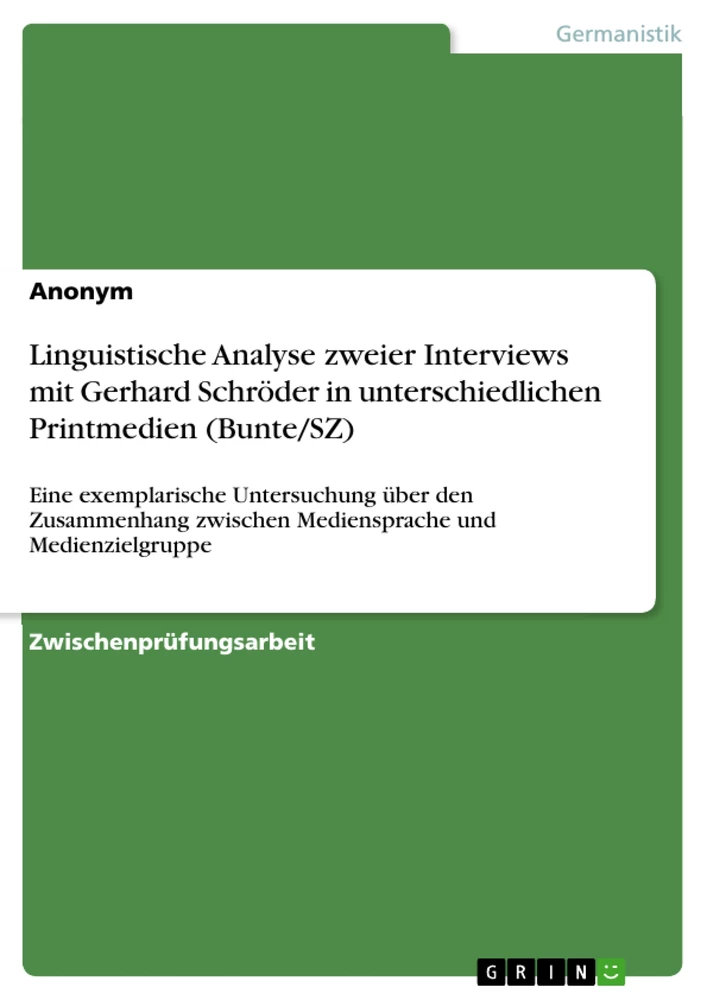In der vorliegenden Hausarbeit werden zwei Interviews mit dem deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder analysiert und miteinander verglichen.
Zum Einen handelt es sich um ein Interview Schröders mit der Zeitschrift Bunte aus dem Jahre 2003, zum Anderen um ein Interview mit ihm, welches 2005 mit der Süddeutschen Zeitung stattfand. Ziel dieser Arbeit ist es, linguistische Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Interviews herauszuarbeiten, um empirisch zu überprüfen, ob sich der Unterschied des Images der beiden Printmedien im Interview widerspiegelt und auch Schröder ein anderes Selbstbild entwerfen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in das Thema
- 2.1 Das Gespräch, der Dialog und das Interview
- 2.2 Merkmale eines Interviews
- 2.3 Die Süddeutsche Zeitung und ihre Leserschaft
- 2.4 Die BUNTE - „Deutschlands aufregendstes People-Magazin“ - und ihre Leserschaft
- 3 Hauptteil
- 3.1 Linguistische Gesprächsanalyse des SZ-Interviews
- 3.1.1 Linguistische Textanalyse des SZ-Interviews
- 3.2 Linguistische Gesprächsanalyse des BUNTE-Interviews
- 3.2.1 Linguistische Textanalyse des BUNTE-Interviews
- 4 Vergleich der Analyseergebnisse der beiden Interviews
- 5 Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht zwei Interviews mit Bundeskanzler Gerhard Schröder – eines aus der Zeitschrift BUNTE (2003) und eines aus der Süddeutschen Zeitung (2005) – um die Hypothese zu überprüfen, ob sich die unterschiedlichen Zielgruppen der Medien in sprachlichen Differenzen der Interviews niederschlagen. Die Arbeit untersucht die linguistischen Besonderheiten beider Interviews und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Mediensprache und Medienzielgruppe.
- Linguistische Analyse von Interviews als Kommunikationsform
- Vergleich der sprachlichen Merkmale in Interviews unterschiedlicher Medien
- Analyse des Einflusses der Zielgruppen auf die jeweilige Mediensprache
- Empirische Überprüfung der Hypothese zum Zusammenhang von Medienzielgruppe und -sprache
- Anwendung linguistischer Methoden zur Gesprächs- und Textanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung: den linguistischen Vergleich zweier Interviews mit Gerhard Schröder (BUNTE und Süddeutsche Zeitung) zur empirischen Überprüfung der Hypothese, dass sich unterschiedliche Zielgruppen in der jeweiligen Mediensprache widerspiegeln. Es wird die Struktur der Arbeit erläutert, die von der Definition des Gesprächs über die Charakterisierung der Medien und ihrer Leserschaft zu den linguistischen Analysen der Interviews und schließlich zum Vergleich und Kommentar führt.
2 Einführung in das Thema: Dieses Kapitel klärt die Begriffe Gespräch, Dialog und Interview und grenzt sie voneinander ab. Es betont die Bedeutung der klaren Definitionen zur Vermeidung von Missverständnissen. Der Begriff „Gespräch“ wird als umfassendste Kategorie definiert und durch die Merkmale dialogische Ausrichtung und thematische Kohärenz präzisiert. Der Dialog als spezielle Form des Gesprächs und das Interview als öffentlichkeitswirksames Frage-Antwort-Gespräch werden erläutert, wobei die Funktion des Interviews für die Informationsverbreitung und Meinungsbildung hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Linguistische Gesprächsanalyse, Mediensprache, Medienzielgruppe, Interviewanalyse, Gerhard Schröder, BUNTE, Süddeutsche Zeitung, Sprachvergleich, Textanalyse, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Linguistischen Analyse von Interviews mit Gerhard Schröder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert und vergleicht zwei Interviews mit Bundeskanzler Gerhard Schröder – eines aus der Zeitschrift BUNTE (2003) und eines aus der Süddeutschen Zeitung (2005). Der Fokus liegt auf dem Vergleich der sprachlichen Merkmale beider Interviews, um zu untersuchen, ob sich die unterschiedlichen Zielgruppen der Medien in der jeweiligen Sprache niederschlagen.
Welche Hypothese wird untersucht?
Die zentrale Hypothese der Arbeit ist, dass sich die unterschiedlichen Zielgruppen der Medien BUNTE und Süddeutsche Zeitung in den sprachlichen Besonderheiten der jeweiligen Interviews mit Gerhard Schröder widerspiegeln. Die Arbeit überprüft diese Hypothese empirisch.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet linguistische Methoden der Gesprächs- und Textanalyse. Es werden die sprachlichen Merkmale der Interviews detailliert untersucht und verglichen, um den Einfluss der Medienzielgruppen auf die Mediensprache aufzuzeigen.
Welche Aspekte werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst die linguistischen Besonderheiten beider Interviews, inklusive der Wortwahl, Satzbau und stilistischen Mittel. Es wird untersucht, wie die unterschiedlichen journalistischen Ansätze und Zielgruppen die sprachliche Gestaltung der Interviews beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Einführung in das Thema (inkl. Definitionen von Gespräch, Dialog und Interview sowie Beschreibung der Medien und ihrer Leserschaften), den Hauptteil mit der linguistischen Analyse beider Interviews, einen Vergleich der Analyseergebnisse und abschließende Kommentare.
Welche Medien werden verglichen?
Verglichen werden ein Interview mit Gerhard Schröder aus der Zeitschrift BUNTE (2003), die als People-Magazin eine breite, eher unterhaltungsorientierte Leserschaft anspricht, und ein Interview aus der Süddeutschen Zeitung (2005), einer überregionalen Qualitätszeitung mit einer eher politisch interessierten Leserschaft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Linguistische Gesprächsanalyse, Mediensprache, Medienzielgruppe, Interviewanalyse, Gerhard Schröder, BUNTE, Süddeutsche Zeitung, Sprachvergleich, Textanalyse, empirische Untersuchung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die empirische Überprüfung der Hypothese, dass sich die unterschiedlichen Zielgruppen der Medien in der sprachlichen Gestaltung der Interviews niederschlagen. Die Arbeit soll den Zusammenhang zwischen Mediensprache und Medienzielgruppe aufzeigen und die Anwendung linguistischer Methoden zur Analyse von Interviews demonstrieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einem klaren strukturellen Aufbau: Einleitung, theoretische Grundlagen, empirische Analyse (inkl. detaillierter linguistischer Analysen der einzelnen Interviews), Vergleich und Schlussfolgerungen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2005, Linguistische Analyse zweier Interviews mit Gerhard Schröder in unterschiedlichen Printmedien (Bunte/SZ), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60804