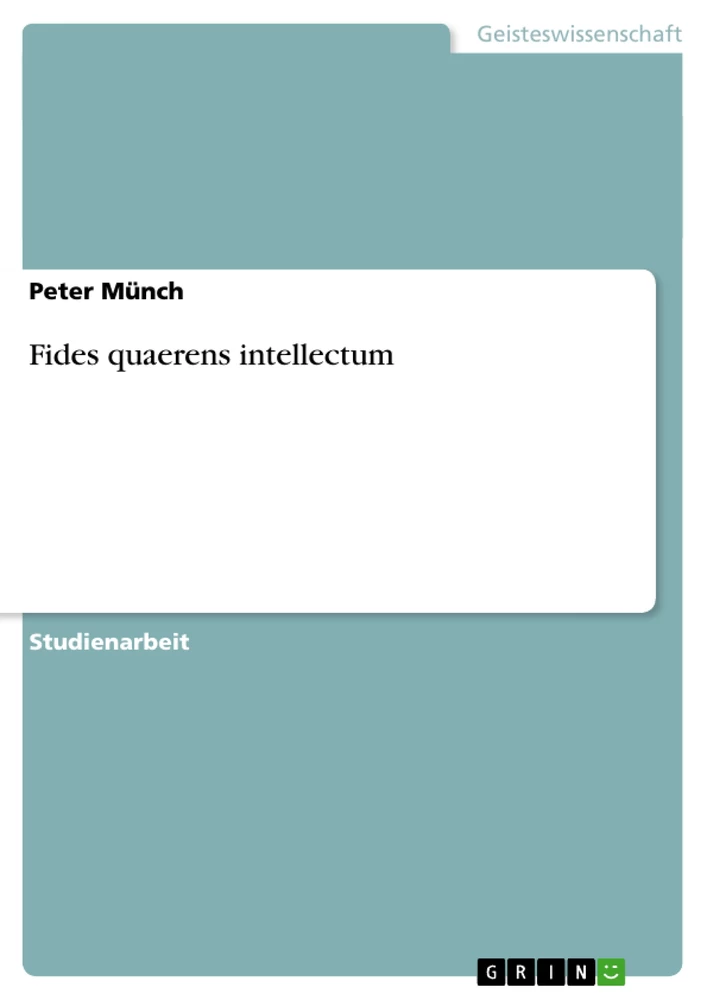Anselm von Canterburys berühmtesunum argumentumist seit dem Zeitpunkt seines Erscheinens heftig umstritten gewesen. Vor allem durch die Annahme, in ihm finde sich ein so genannter ontologischer Gottesbeweis, zog dieses Werk die Aufmerksamkeit großer Philosophen und Theologen wie Thomas von Aquin, Kant und Barth auf sich. Jedoch ist die Bewertung des Arguments seit einiger Zeit umstritten. Lesen die einen in ihm den Versuch eines Gottesbeweises, so meinen andere, von einem solchen fehle im Text jegliche Spur -Anselm habe hier vielmehr eine Denkregel aufstellen wollen, die einem sagt, wie Gott gedacht werden muss, wenn man Ihn richtig denken will. Die vorliegende Arbeit möchte zeigen, dass die zuletzt genannte Lesart des anselmschen Arguments als Denkregel die zutreffende ist. Dazu wird es nötig sein, sich zunächst dem Werk zuzuwenden, das dem Proslogion zeitlich und thematisch voranging, und das von Anselm selbst in einen engen Zusammenhang mit dem Proslogion gesetzt wurde: dem Monologion (Punkt 2). Danach betrachte ich die die Einführung des Arguments vorbereitenden und für dessen rechtes Verständnis konstitutiven Ausführungen Anselms in Vorrede und erstem Kapitel des Proslogions (3). Im vierten Punkt erfolgt schließlich die Untersuchung des Arguments und seiner Entfaltung in den Kapiteln 2 bis 4, wobei auch die Auseinandersetzung mit Gaunilo in die Überlegungen mit einbezogen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ontologischer Gottesbeweis bei Anselm von Canterbury?
- Das vorangegangene Werk: Monologion
- „Sola ratione“: Der Nachweis der Vernünftigkeit des christlichen Glaubens.
- Inhalt des Monologions.
- Der Kontext: Das Programm des Proslogions
- Die Vorrede: Fides quaerens intellectum
- Das erste Kapitel: Die Suche nach Glaubenseinsicht
- Das unum argumentum und die sich daran anschließende Argumentation
- Die Einführung des Arguments: Credimus te esse
- Die Formulierung: „aliquid quo nihil maius cogitari possit”
- Der erste Schritt der Argumentation: esse in intellectu
- Der zweite Schritt der Argumentation: esse et in intellectu et in re
- Der dritte Schritt der Argumentation: non possit cogitari non esse
- Der Denkfehler des Toren
- Vom rechten Verständnis: Gottesbeweis oder Widerlegung des Toren?
- Schluss: Anselms Theologie als der Versuch der Unwissenheit das Wesen des Unbegreiflichen zu erklären
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text setzt sich mit Anselm von Canterburys berühmtem "unum argumentum" auseinander, das häufig als ontologischer Gottesbeweis interpretiert wird. Die Arbeit strebt danach, eine alternative Lesart des Arguments als Denkregel zu präsentieren, die zeigt, wie Gott gedacht werden muss, um ihn richtig zu verstehen.
- Das Proslogion und seine Beziehung zum Monologion
- Die Rolle der Vernunft in Anselms Theologie
- Die Argumentationsstruktur des "unum argumentum"
- Der Unterschied zwischen dem Denken Gottes und dem Denken des Menschen
- Anselms Versuch, das Wesen des Unbegreiflichen zu erklären
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das "unum argumentum" von Anselm vor und erläutert die bestehende Debatte um seine Interpretation.
Kapitel 2 beleuchtet das "Monologion" als Vorläufer des "Proslogion" und untersucht die Rolle der Vernunft in Anselms Denken. Es zeigt, dass Anselm im "Monologion" die Vernunft als Grundlage des christlichen Glaubens sieht und dass die Gotteserkenntnis durch die Vernunft und nicht durch Autoritäten erfolgen muss.
Kapitel 3 analysiert die Vorrede und das erste Kapitel des "Proslogion", in denen Anselm sein Programm darlegt. Er betont die Suche nach Glaubenseinsicht und den Wunsch, den christlichen Glauben durch die Vernunft zu begreifen.
Kapitel 4 fokussiert sich auf die Analyse des "unum argumentum" und seine Argumentationsstruktur. Anselms Behauptung, dass Gott "aliquid quo nihil maius cogitari possit" sei, und die daraus folgenden Schritte der Argumentation werden untersucht.
Schlüsselwörter
Der Text behandelt die folgenden Schlüsselwörter und Themen: Anselm von Canterbury, ontologischer Gottesbeweis, "unum argumentum", "Monologion", "Proslogion", Vernunft, Glaube, Gotteserkenntnis, Denkregel, "aliquid quo nihil maius cogitari possit".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „unum argumentum“ von Anselm von Canterbury?
Es ist Anselms berühmtes Argument aus dem Proslogion, das oft als ontologischer Gottesbeweis bezeichnet wird, hier aber als Denkregel interpretiert wird.
Was bedeutet die Formel „aliquid quo nihil maius cogitari possit“?
Übersetzt bedeutet es: „Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“. Dies ist Anselms Definition für Gott im Rahmen seines Arguments.
Ist das Argument ein Gottesbeweis oder eine Denkregel?
Die Arbeit argumentiert, dass es sich primär um eine Denkregel handelt, die festlegt, wie Gott gedacht werden muss, wenn man ihn richtig verstehen will.
Was ist der Unterschied zwischen „esse in intellectu“ und „esse in re“?
„Esse in intellectu“ bedeutet, dass etwas im Verstand existiert, während „esse in re“ die reale Existenz in der Wirklichkeit bezeichnet.
Welche Rolle spielt die Vernunft in Anselms Theologie?
Anselm verfolgt das Programm „Fides quaerens intellectum“ (Glaube, der nach Einsicht sucht), wobei die Vernunft dazu dient, die Gehalte des Glaubens rational nachzuvollziehen.
- Arbeit zitieren
- Peter Münch (Autor:in), 2006, Fides quaerens intellectum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60848