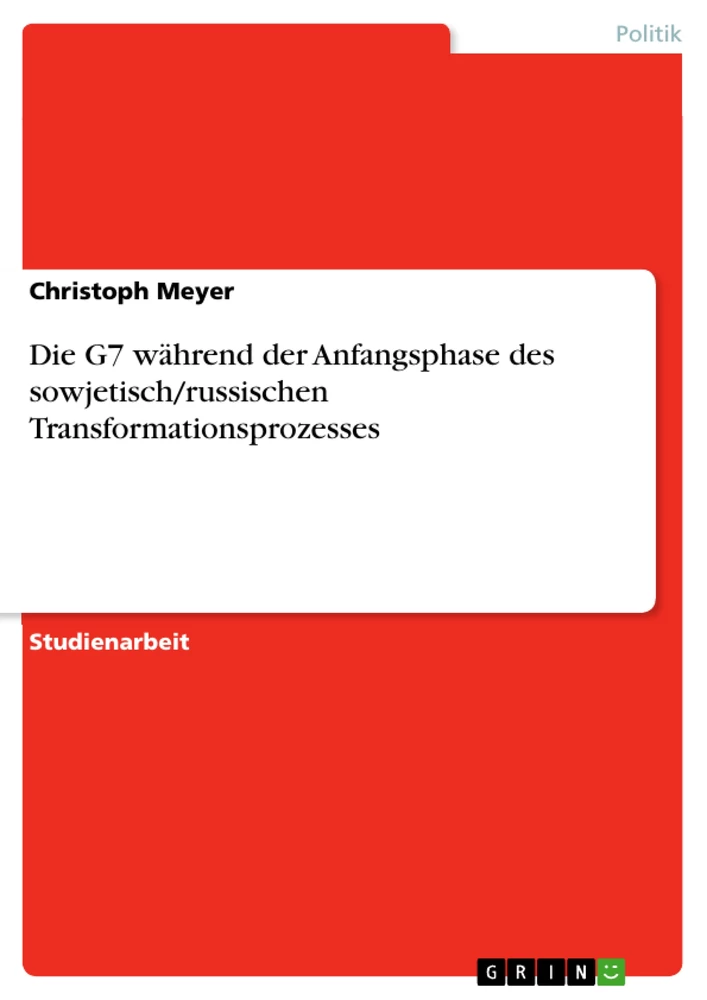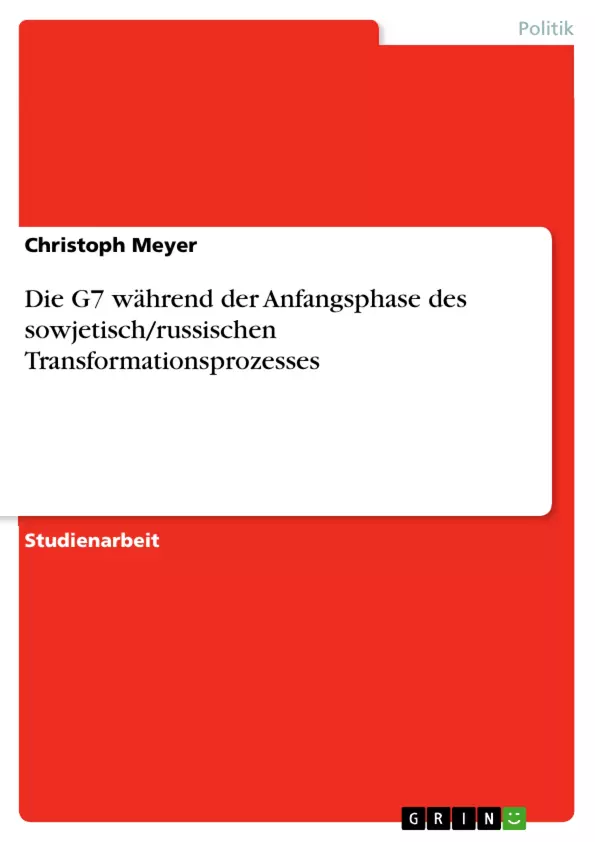Während des Ost-West-Konflikts prägte die militärische und ideologische Bipolarität zwischen den USA und der Sowjetunion die Machtverteilung im internationalen System. Die Welt war in zwei Lager gespaltet, die um diese beiden Supermächte herum organisiert waren. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und des Zerfalls der Sowjetunion hat sich die Machtverteilung im internationalen System grundlegend verändert. Aus der weltpolitischen Konkurrenz zwischen den beiden Supermächten und ihren jeweiligen Allianzen sind die USA siegreich hervorgegangen; im Bereich der Militär- und Sicherheitspolitik nehmen die USA seit diesem Zeitpunkt eine Hegemonialposition ein. Was das Machtgefüge im Weltwirtschaftssystem angeht, so wurde dieses schon während des Kalten Krieges vornehmlich von den führenden westlichen Industriestaaten USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada dominiert, die seit 1975 bzw. 1976 (Kanada stieß erst ein Jahr später dazu) die „Group of Seven“ (G7) bilden. Die G7 ent-stand ursprünglich aus der Notwendigkeit, die Wirtschaftspolitiken der wichtigsten Volkswirtschaften auf multilateraler Ebene abzustimmen, um auf den weltweiten Abschwung, ausgelöst durch den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems und die erste Ölkrise, zu reagieren. Während die Weltwirtschaftsgipfel zunächst vorwiegend im Zeichen der währungspolitischen Zusammenarbeit standen, nahm im Laufe der Zeit die internationale Zusammenarbeit in der Umwelt-, Sicherheits- und Außenpolitik immer mehr Raum ein. Diese Arbeit möchte analysieren, ob und wie die USA in der G7 nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hinsichtlich des sowjetisch/russischen Transformationsprozesses gegen oder gemeinsam mit den anderen Mitgliedern ihre Interessen und Strategien innerhalb der Gipfeltreffen in ihrem Sinne verfolgen konnten. Es soll der Frage nachgegangen werden, ob im G7-Netzwerk in diesem Zeitraum eine „gruppenhegemoniale Stabilität“ in Form einer „Concert Equality“ beziehungsweise eine „hegemoniale Stabilität“ durch die USA als „benign hegemon“ existierte oder ob sich die USA nach dem realistischen Denkmuster verhielten. Die Analyse konzentriert sich dabei auf den Zeitraum von 1989 bis 1994, in dem die Interessen der USA hinsichtlich des sowjetisch/russischen Transformationsprozesses einen strategischen Wandel erfuhren und erste Fortschritte im Erweiterungsprozess von der G7 zur G8 sichtbar wurden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. „Realismus“ vs. „Hegemoniale Stabilität“ vs. „Gruppenhegemoniale Stabilität“
- 1. Die Theorie des Realismus
- 1.1. Zum Vergleich: Die Theorie des neoliberalen Institutionalismus
- 2. Kritik am klassischen Realismus: Die Theorie der hegemonialen Stabilität
- 3. Weiterentwicklung der Theorie hegemonialer Stabilität: Der Ansatz der gruppen-hegemonialen Stabilität
- II. Die G7 zwischen 1989 und 1994 – Analyse eines Prozesses
- 1. Die Gipfeltreffen von Paris 1989 und Houston 1990
- 1.1. Theoretische Einordnung
- 2. Das Gipfeltreffen von London 1991
- 2.1. Theoretische Einordnung
- 3. Die Gipfeltreffen von München 1992 und Tokio 1993
- 3.1. Theoretische Einordnung
- 4. Das Gipfeltreffen von Neapel 1994
- 4.1. Theoretische Einordnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern die USA in der G7 nach dem Ende des Ost-West-Konflikts hinsichtlich des sowjetisch/russischen Transformationsprozesses ihre Interessen und Strategien innerhalb der Gipfeltreffen durchsetzen konnten. Dabei stehen die Fragen im Mittelpunkt, ob im G7-Netzwerk eine „gruppenhegemoniale Stabilität“ oder eine „hegemoniale Stabilität“ durch die USA als „benign hegemon“ existierte oder ob sich die USA nach dem realistischen Denkmuster verhielten.
- Der Einfluss der USA auf die G7 im Hinblick auf den sowjetisch/russischen Transformationsprozess
- Die Rolle der G7 im Kontext der neuen Machtverhältnisse nach dem Ende des Kalten Krieges
- Der Vergleich der theoretischen Ansätze des Realismus, der hegemonialen Stabilität und der gruppenhegemonialen Stabilität
- Die Entwicklung des G7-Netzwerks in den Jahren 1989 bis 1994
- Die Auswirkungen der G7-Gipfeltreffen auf den Transformationsprozess in der Sowjetunion/Russland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Analyse. Es werden die Konzepte des Realismus, der hegemonialen Stabilität und der gruppenhegemonialen Stabilität vorgestellt und in ihren wichtigsten Merkmalen erläutert. Im zweiten Kapitel werden die G7-Gipfeltreffen von 1989 bis 1994 analysiert. Dabei wird auf die wichtigsten Themen und Entscheidungen der Gipfeltreffen eingegangen und deren Auswirkungen auf den sowjetisch/russischen Transformationsprozess untersucht. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst und auf weitere Forschungsmöglichkeiten hinweist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, der Machtverteilung im internationalen System, der Hegemonie der USA, der Transformationsprozesse in der Sowjetunion/Russland und den G7-Gipfeltreffen. Die Arbeit analysiert den Einfluss der USA auf die G7 und deren Bedeutung für die Gestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung im Kontext des sowjetisch/russischen Transformationsprozesses. Dabei werden theoretische Ansätze wie Realismus, hegemoniale Stabilität und gruppenhegemoniale Stabilität herangezogen, um die Kräfteverhältnisse in der G7 zu analysieren und das Durchsetzungsvermögen der G7-Akteure in der Sowjetunion/Russland-Frage zu untersuchen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten die USA in der G7 zwischen 1989 und 1994?
Die Arbeit untersucht, ob die USA als „hegemonialer Stabilisator“ agierten oder ihre Interessen im G7-Netzwerk rein realistisch durchsetzten.
Was ist „gruppenhegemoniale Stabilität“?
Ein Ansatz, bei dem eine Gruppe führender Staaten (wie die G7) gemeinsam für Stabilität im Weltwirtschaftssystem sorgt, anstatt eines einzelnen Staates.
Wie beeinflusste die G7 den russischen Transformationsprozess?
Die G7-Gipfel dienten als Plattform zur Abstimmung von Hilfen und Strategien zur Unterstützung des Wandels in der Sowjetunion bzw. Russland.
Warum wurde die G7 zur G8 erweitert?
Der Erweiterungsprozess begann in der untersuchten Phase, um Russland stärker in die internationale Staatengemeinschaft zu integrieren.
Welcher G7-Gipfel markiert einen Wendepunkt in der Russland-Frage?
Die Arbeit analysiert Gipfel von Paris (1989) bis Neapel (1994), wobei Neapel den Übergang zur G8 verdeutlicht.
- Quote paper
- Christoph Meyer (Author), 2004, Die G7 während der Anfangsphase des sowjetisch/russischen Transformationsprozesses , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61006