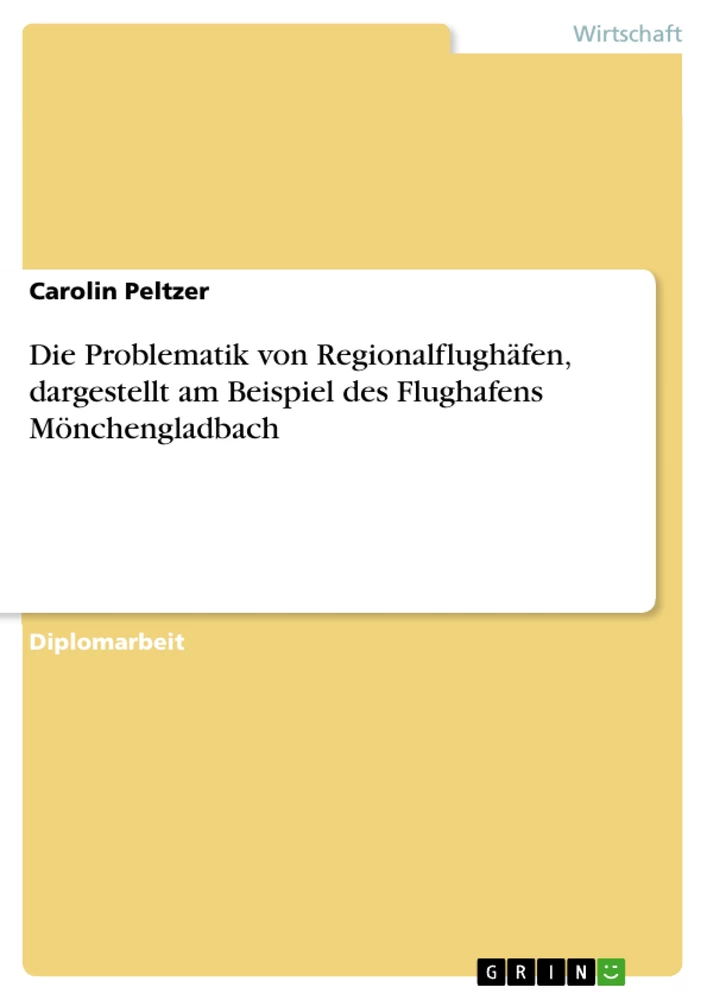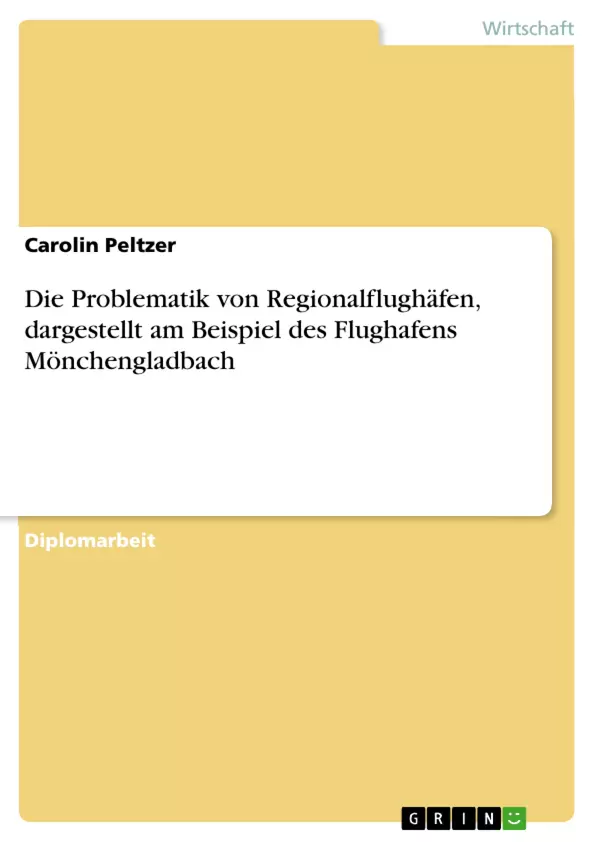Im November 2005 veröffentlichte die Deutsche Bank eine Studie mit dem Thema „Ausbau von Regionalflughäfen: Fehlallokation von Ressourcen“. Darin wurden verschiedene Probleme im Bereich der Regionalflughäfen herausgestellt. Es wird in der Studie angenommen, dass ein Flughafen erst ab frühestens 500.000 Pax den Break-Even Point erreicht, sprich kostendeckend wirtschaftet. Laut der „dbResearch“ gelingt es allerdings wenigen der 41 deutschen Regionalflughäfen und Verkehrslandeplätze, diese Passagierzahlen abzufertigen. Somit seien Regionalflughäfen in hohem Maße bei Ausbaumaßnahmen, aber auch im laufenden Betrieb stark von Subventionen abhängig. Bei nah zueinander liegenden Flughäfen entstände so einerseits ein regelrechter Subventionswettlauf und andererseits eine starke Kannibalisierungswirkung. Viele der Regionalflughäfen setzen zudem auf einen einzigen Low-Cost-Carrier, wie beispielsweise der Flughafen Weeze auf Ryanair, was zu einer problematischen Abhängigkeit führen kann. Ein weiteres Problem, auf das die Studie eingeht, ist das Kapazitätsproblem von Flughäfen. „Strategische Allianzen“ und der Trend zu großem Fluggerät führen dazu, dass sich besonders der interkontinentale Flugverkehr auf die größten Flughäfen konzentriert, was wiederum zu Kapazitätsengpässen an eben diesen führt. Gleichzeitig entstehen durch immer mehr kleinere Flughäfen Überkapazitäten. Allerdings gelingt es nicht, die Engpässe an den Drehkreuzflughäfen durch vorhandene Kapazitäten von Regionalflughäfen zu entlasten. Weiterhin wird in der Studie angesprochen, dass eine Flughafenpolitik auf Bundesebene dringend erstrebenswert wäre, da laut Meinung der Deutschen Bank die „Kleinstaaterei“ zu unrentablen Bauprojekten, begründet durch Prestigestreben von Regionalpolitikern, führe, und es dadurch zu Verzögerungen bei wichtigeren Ausbauprojekten von Großflughäfen käme. Die Lösung für die entstandenen Effizienzprobleme sieht die Deutsche Bank letztlich in der Privatisierung von Flughäfen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärungen
- 2.1 Flughafenarten
- 2.1.1 Flughafen
- 2.1.2 Landeplatz
- 2.1.3 Segelfluggelände
- 2.1.4 Regionalflughafen
- 2.2 Bezeichnung von Flughäfen
- 2.2.1 IATA Codes
- 2.2.2 ICAO Codes
- 2.3 Aufbau eines Flughafens
- 3 MGL-Der Flughafen
- 3.1 Entstehung und Entwicklung
- 3.2 Zukünftige Entwicklung
- 4 MGL-Interessensgruppen
- 4.1 Befürworter
- 4.2 Gegner
- 5 MGL-Problematik und Analyse
- 5.1 Flughäfen sollten privatisiert werden. Auch MGL?
- 5.2 Wird eine bundeseinheitliche Flughafenpolitik benötigt?
- 5.3 Fehlt MGL die kritische Größe zum Erfolg?
- 5.4 Verschlingt der Ausbau von MGL Subventionen?
- 5.5 Ist der Ausbau von MGL verkehrspolitisch erforderlich?
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Problematik von Regionalflughäfen am Beispiel des Flughafens Mönchengladbach. Die Arbeit analysiert die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Flughafens und hinterfragt die Notwendigkeit des geplanten Ausbaus im Kontext einer bundesweiten Flughafenpolitik. Die Studie der Deutschen Bank zum Ausbau von Regionalflughäfen dient als Ausgangspunkt der Untersuchung.
- Wirtschaftliche Tragfähigkeit von Regionalflughäfen
- Notwendigkeit des Ausbaus des Flughafens Mönchengladbach
- Einfluss einer bundesweiten Flughafenpolitik
- Analyse von Interessensgruppen (Befürworter und Gegner)
- Bewertung der Subventionsabhängigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Problematik von Regionalflughäfen ein und bezieht sich auf eine Studie der Deutschen Bank, die den Ausbau von Regionalflughäfen als Fehlallokation von Ressourcen kritisiert. Die Studie hebt die Subventionsabhängigkeit vieler Regionalflughäfen hervor, den Subventionswettlauf zwischen nah gelegenen Flughäfen und die problematische Abhängigkeit von einzelnen Low-Cost-Carriern. Die Einleitung benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die kritische Größe, die Subventionsabhängigkeit, die Finanzierung und die verkehrspolitische Relevanz des Ausbaus des Flughafens Mönchengladbach konzentrieren. Die Bedeutung einer bundesweiten Flughafenpolitik wird ebenfalls angesprochen.
2 Begriffsklärungen: Dieses Kapitel klärt wichtige Fachbegriffe im Kontext von Flugplätzen. Es differenziert zwischen verschiedenen Flughafenarten (Flughafen, Landeplatz, Segelfluggelände, Regionalflughafen) und beschreibt die verschiedenen Bezeichnungen von Flughäfen (IATA und ICAO Codes). Zusätzlich wird der Aufbau eines typischen Flughafens erläutert. Diese präzise Begriffsbestimmung legt die Grundlage für ein fachlich korrektes Verständnis der weiteren Analyse.
3 MGL-Der Flughafen: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung des Flughafens Mönchengladbach (MGL). Es behandelt die historische Entwicklung und beleuchtet die zukünftige Entwicklungsplanung, inklusive der geplanten Startbahnverlängerung. Die Darstellung der Geschichte und der zukünftigen Pläne des Flughafens stellt den Kontext für die spätere Analyse der Problematik dar.
4 MGL-Interessensgruppen: In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Interessensgruppen im Zusammenhang mit dem Flughafen Mönchengladbach vorgestellt und ihre jeweiligen Positionen beleuchtet. Es werden sowohl die Befürworter als auch die Gegner des Flughafenausbaus und der damit verbundenen Entwicklungen präsentiert. Die Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven ist wichtig für ein umfassendes Verständnis der komplexen Situation.
5 MGL-Problematik und Analyse: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und analysiert die Problematik des Flughafens Mönchengladbach im Kontext der in der Einleitung aufgeworfenen Fragen. Es untersucht kritisch, ob der Flughafen die kritische Größe zum Erfolg erreicht, ob der Ausbau Subventionen verschlingt, wie er finanziert werden soll und ob er verkehrspolitisch erforderlich ist. Die Privatisierung von Flughäfen und die Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Flughafenpolitik werden ebenfalls diskutiert. Der Analyseteil bewertet die wirtschaftlichen Folgen der geplanten Startbahnverlängerung.
Schlüsselwörter
Regionalflughäfen, Flughafen Mönchengladbach (MGL), wirtschaftliche Tragfähigkeit, Flughafenpolitik, Subventionen, Ausbau, Startbahnverlängerung, Interessensgruppen, Kapazitätsproblem, Low-Cost-Carrier, Deutsche Bank Studie.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Flughafen Mönchengladbach
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Problematik von Regionalflughäfen am Beispiel des Flughafens Mönchengladbach (MGL). Sie analysiert dessen wirtschaftliche Tragfähigkeit und hinterfragt die Notwendigkeit des geplanten Ausbaus im Kontext der bundesweiten Flughafenpolitik. Die Studie der Deutschen Bank zum Ausbau von Regionalflughäfen dient als Ausgangspunkt.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Regionalflughäfen, die Notwendigkeit des Ausbaus von MGL, den Einfluss einer bundesweiten Flughafenpolitik, die Analyse von Interessensgruppen (Befürworter und Gegner), die Bewertung der Subventionsabhängigkeit und die kritische Größe des Flughafens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsklärungen (inkl. Flughafenarten und -bezeichnungen), MGL – Der Flughafen (Entstehung und zukünftige Entwicklung), MGL – Interessensgruppen (Befürworter und Gegner), MGL – Problematik und Analyse (inkl. kritische Größe, Subventionen, Finanzierung und verkehrspolitische Relevanz), und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der Problematik von Regionalflughäfen ein und bezieht sich auf eine Studie der Deutschen Bank, die den Ausbau von Regionalflughäfen kritisch bewertet. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die kritische Größe, die Subventionsabhängigkeit, die Finanzierung und die verkehrspolitische Relevanz des Ausbaus von MGL konzentrieren. Die Bedeutung einer bundesweiten Flughafenpolitik wird ebenfalls angesprochen.
Was wird im Kapitel "Begriffsklärungen" geklärt?
Dieses Kapitel klärt wichtige Fachbegriffe wie Flughafen, Landeplatz, Segelfluggelände, Regionalflughafen, IATA- und ICAO-Codes und erläutert den Aufbau eines typischen Flughafens.
Was beinhaltet das Kapitel über den Flughafen Mönchengladbach (MGL)?
Das Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung von MGL, behandelt die historische Entwicklung und beleuchtet die zukünftige Entwicklungsplanung, inklusive der geplanten Startbahnverlängerung.
Wie werden Interessensgruppen im Zusammenhang mit MGL behandelt?
Das Kapitel zu den Interessensgruppen stellt die verschiedenen Positionen von Befürwortern und Gegnern des Flughafenausbaus dar.
Was ist der Kern der Analyse in Kapitel 5?
Kapitel 5 analysiert die Problematik von MGL, indem es die kritische Größe, die Subventionsabhängigkeit, die Finanzierung und die verkehrspolitische Erforderlichkeit des Ausbaus kritisch untersucht. Die Privatisierung von Flughäfen und die Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Flughafenpolitik werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Regionalflughäfen, Flughafen Mönchengladbach (MGL), wirtschaftliche Tragfähigkeit, Flughafenpolitik, Subventionen, Ausbau, Startbahnverlängerung, Interessensgruppen, Kapazitätsproblem, Low-Cost-Carrier, Deutsche Bank Studie.
- Arbeit zitieren
- Carolin Peltzer (Autor:in), 2006, Die Problematik von Regionalflughäfen, dargestellt am Beispiel des Flughafens Mönchengladbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61084