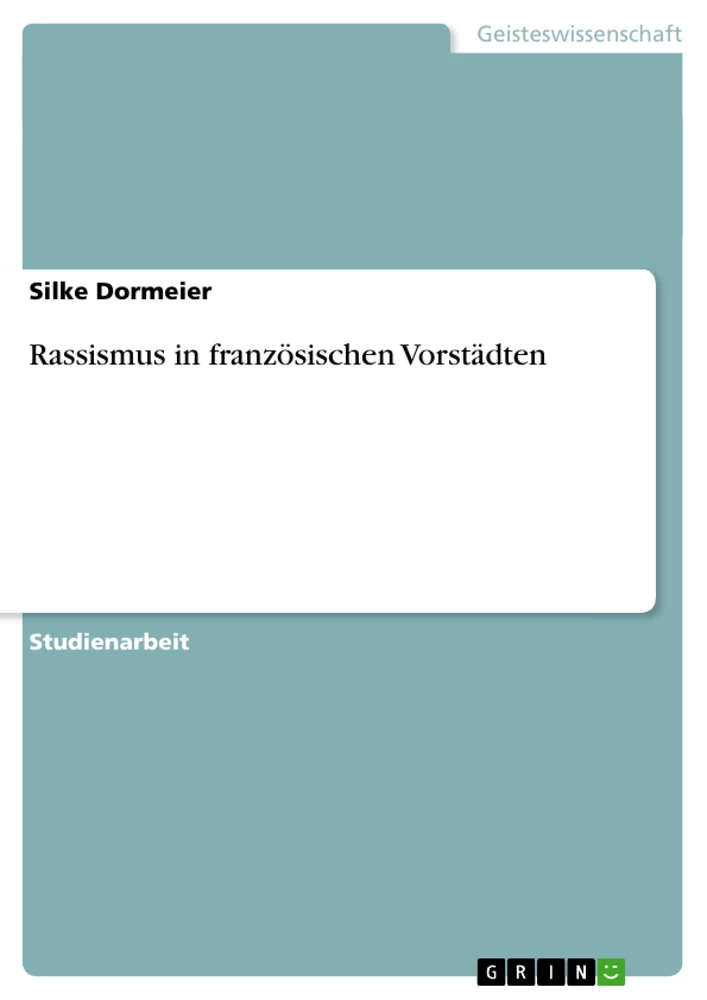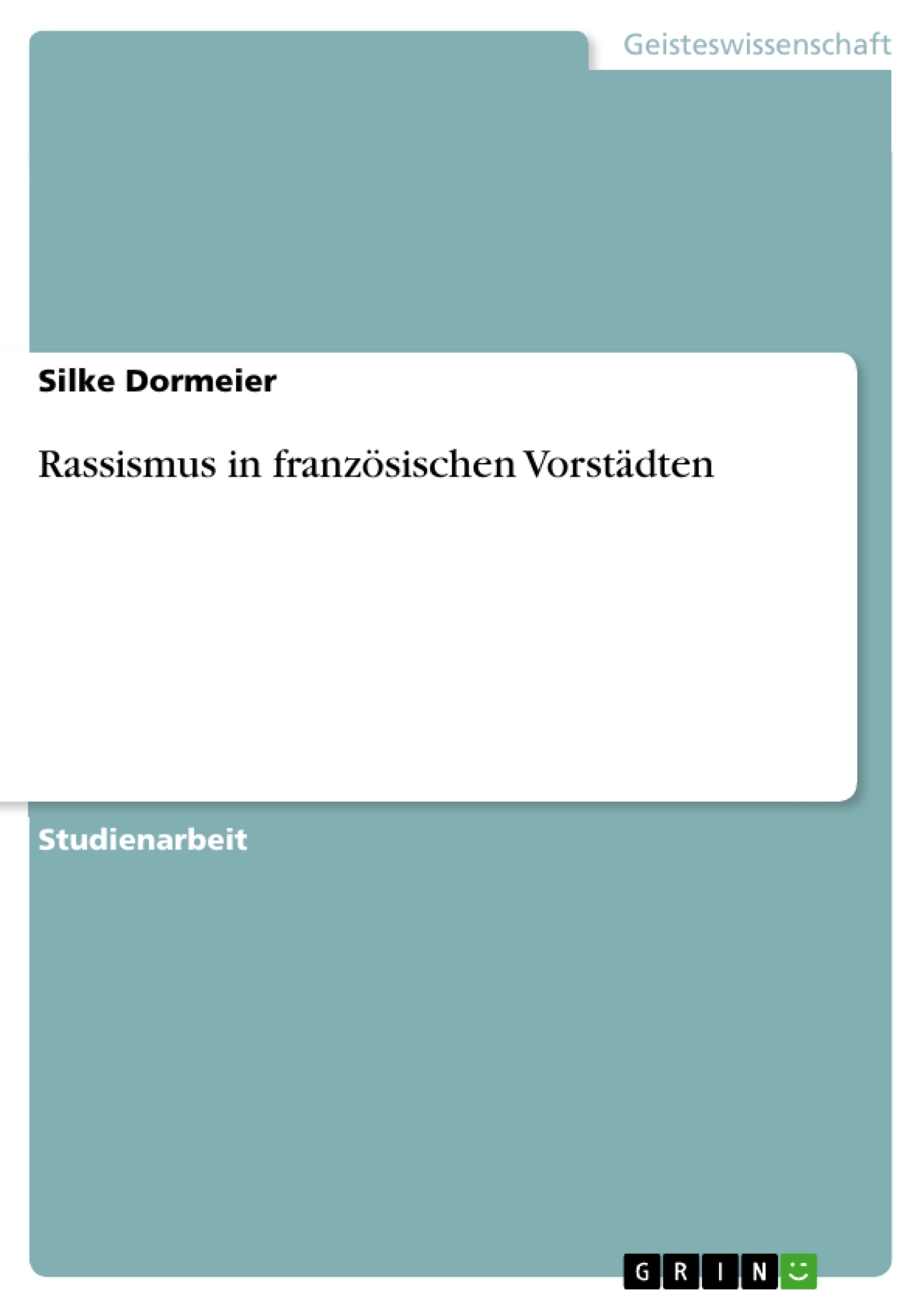Die Struktur der französischen Gesellschaft kann als zweigeteilt bezeichnet werden. Ein Problem, das in den letzten Jahren immer deutlicher wurde, ist die soziale Ausgrenzung. Dadurch bedingt haben sich in vielen französischen Großstädten Randgruppenmilieus herausgebildet. Bezeichnend für diese Milieus ist u.a. der weit unter dem Landesdurchschnitt liegende Lebensstandard. Das eigentliche Stadtleben reduziert sich auf elementare Formen. Die wenigen positiven Ereignisse können den fortlaufenden Verfall nicht aufhalten.
Die Lebensweise der in die Randbezirke "abgeschobenen" Personen ist mit dem Leben in nordamerikanischen Ghettos vergleichbar. Unruhen, Gewalt und Rassismus bestimmen das Tagesgeschehen.
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entstehung der sozialen Probleme, die von den außerhalb der Gesellschaft stehenden Personen bewältigt werden müssen. Der Schwerpunkt liegt dabei im Bereich Rassismus, welcher mit Hilfe des Ansatzes Didier Lapeyronnies bearbeitet wird.
Die gegenwärtige Situation in Frankreich wird unter den Aspekten der sozialen Abgrenzung, den Vektoren für gesellschaftliche Beziehungen und den Erscheinungsformen von Rassismus und Diskriminierung beschrieben. Zudem werden Maßnahmen aufgezeigt, die der Ausgrenzung entgegenwirken sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsdefinition
- 1.1 Rassismus
- 1.2 Rassismus nach Lapeyronnie
- 2. Gegenwärtige Situation in französischen Vorstädten
- 2.1 Vektoren für Beziehungen gesellschaftlicher Gruppen
- 2.1.1 Konsummuster
- 2.1.2 Sprache
- 2.2 Soziale Abgrenzung
- 2.2.1 Räumliche Trennung
- 2.2.2 Negative „Rassen“-Identifikation
- 2.3 Rassismus und Diskriminierung
- 2.3.1 Assimilation als Ursache von Rassismus
- 2.3.2 Äußerungsformen des Rassismus
- 2.1 Vektoren für Beziehungen gesellschaftlicher Gruppen
- 3. Maßnahmen gegen die Ausgrenzung
- 3.1 Eingliederungsmindesteinkommen (RMI)
- 3.2 Soziale Stadtentwicklung
- 3.3 Demokratisches Programm
- 4. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den sozialen Problemen in französischen Vorstädten und beleuchtet insbesondere den Aspekt des Rassismus. Sie zielt darauf ab, die Entstehung dieser Probleme zu erklären und den Rassismus im Kontext der französischen Gesellschaft zu analysieren, wobei der Ansatz von Didier Lapeyronnie als theoretischer Rahmen dient. Die Arbeit untersucht die gegenwärtige Situation in Frankreich, indem sie die soziale Abgrenzung, die Vektoren für gesellschaftliche Beziehungen und die Erscheinungsformen von Rassismus und Diskriminierung beleuchtet. Außerdem werden Maßnahmen aufgezeigt, die der Ausgrenzung entgegenwirken sollen.
- Soziale Ausgrenzung in französischen Vorstädten
- Rassismus als Erfahrungsmodus in der französischen Gesellschaft
- Vektoren für gesellschaftliche Beziehungen und ihre Rolle bei der Ausgrenzung
- Erscheinungsformen von Rassismus und Diskriminierung in französischen Vorstädten
- Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausgrenzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der sozialen Ausgrenzung in französischen Vorstädten ein und beschreibt die Problematik, die sich durch den weit unter dem Landesdurchschnitt liegenden Lebensstandard in diesen Gebieten ergibt. Die Arbeit stellt den Schwerpunkt auf den Rassismus, der mit Hilfe des Ansatzes von Didier Lapeyronnie analysiert wird.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Rassismus" und geht auf die Definition von Giddens ein, der Rassismus als die Zuschreibung von Überlegenheit oder Minderwertigkeit an Bevölkerungsgruppen aufgrund von vererbten Körpermerkmalen definiert. Im Anschluss wird der Rassismusbegriff von Lapeyronnie vorgestellt, der ihn als eine Folge des Zerfalls gesellschaftlicher Strukturen versteht.
Das zweite Kapitel beschreibt die gegenwärtige Situation in französischen Vorstädten. Es untersucht die Vektoren für Beziehungen gesellschaftlicher Gruppen, wie Konsummuster und Sprache, und beleuchtet die soziale Abgrenzung, die sich durch räumliche Trennung und negative "Rassen"-Identifikation äußert. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Rassismus und Diskriminierung und analysiert die Assimilation als Ursache für Rassismus sowie verschiedene Äußerungsformen von Rassismus.
Das dritte Kapitel stellt Maßnahmen vor, die der Ausgrenzung entgegenwirken sollen. Es werden das Eingliederungsmindesteinkommen (RMI), die soziale Stadtentwicklung und das demokratische Programm als Beispiele für diese Maßnahmen erläutert.
Das vierte Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen soziale Ausgrenzung, Rassismus, Diskriminierung, französische Vorstädte, gesellschaftliche Beziehungen, Vektoren für gesellschaftliche Beziehungen, Assimilation, Eingliederung, soziale Stadtentwicklung und demokratisches Programm. Der Ansatz von Didier Lapeyronnie dient als theoretischer Rahmen für die Analyse des Rassismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie äußert sich soziale Ausgrenzung in französischen Vorstädten?
Sie zeigt sich durch räumliche Trennung (Ghettobildung), einen niedrigen Lebensstandard und eine negative Identifikation der Bewohner.
Was besagt der Rassismus-Ansatz von Didier Lapeyronnie?
Lapeyronnie versteht Rassismus als eine Folge des Zerfalls gesellschaftlicher Strukturen und als einen „Erfahrungsmodus“ ausgegrenzter Gruppen.
Welche Rolle spielen Sprache und Konsum bei der Abgrenzung?
Sprache (z.B. Slang) und spezifische Konsummuster dienen als Vektoren für die Identitätsbildung innerhalb der Vorstädte, verstärken aber oft die Distanz zur Mehrheitsgesellschaft.
Was ist das Eingliederungsmindesteinkommen (RMI)?
Das RMI ist eine staatliche Maßnahme in Frankreich, die darauf abzielt, die wirtschaftliche Not zu lindern und die soziale Eingliederung zu fördern.
Warum wird Assimilation als Ursache von Rassismus diskutiert?
Die Arbeit untersucht, ob der Druck zur Anpassung an die französische Leitkultur Paradoxien erzeugt, die Diskriminierung und Rassismus eher befeuern.
- Citation du texte
- Dr. Silke Dormeier (Auteur), 2001, Rassismus in französischen Vorstädten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6113