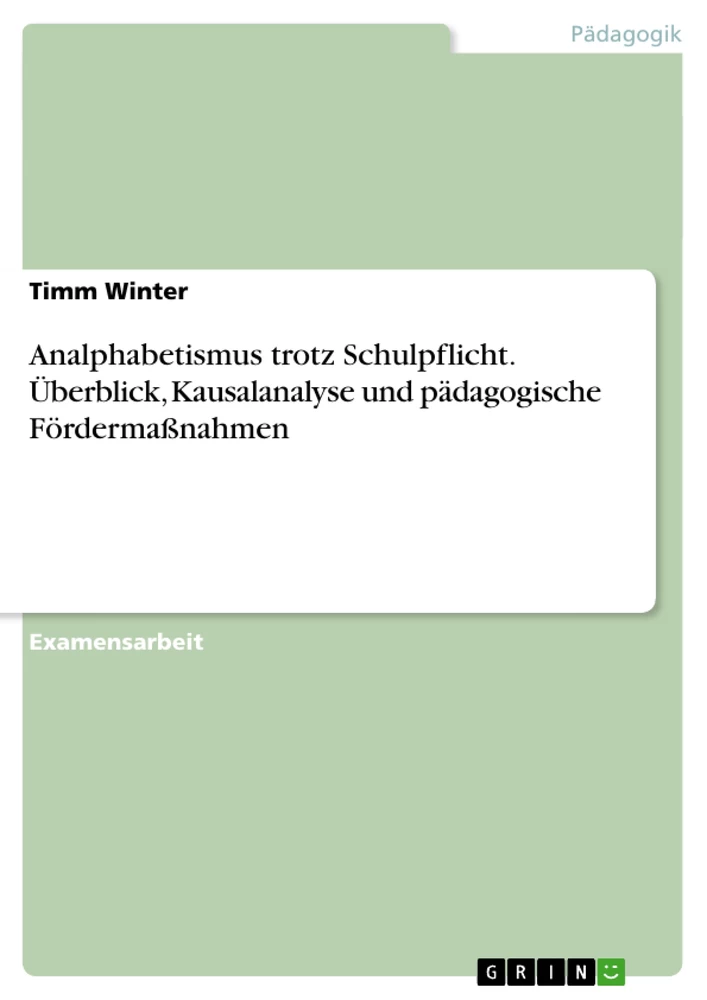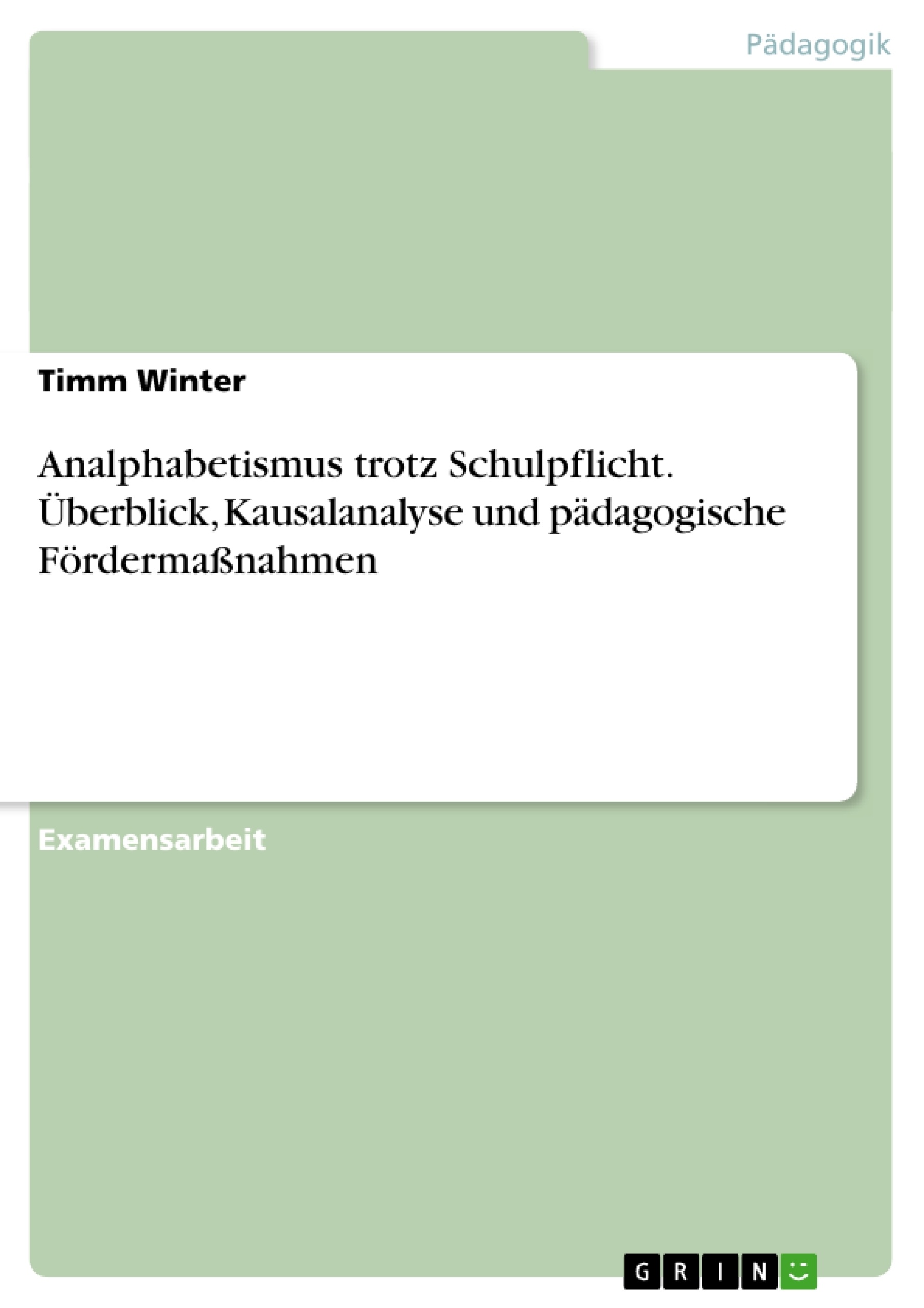[...] Denn wer nicht lesen und schreiben kann, verfügt nicht über die „einfachsten“ Grundfertigkeiten und wird oftmals als Dummkopf abgewertet. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass der Großteil funktionaler Analphabeten entweder einen Hauptschul- oder einen Sonderschulabschluss haben. Dass solche Annahmen höchst eindimensional sind, soll in dieser Arbeit näher ausgeführt werden. Die Biographieanalysen funktionaler Analphabeten zeigen, dass Schulpflicht und Analphabetismus in Deutschland keinen Widerspruch darstellen. Hierzulande hat man es mit einem Ursachengefüge zu tun, das neben individuellen Faktoren schulische, familiäre und soziale Faktoren einschließt, die sich ihrerseits wiederum wechselseitig bedingen. Die Ursachen für die Entstehung von Analphabetismus sind überwiegend multikausal und nicht auf einen Umstand zurückzuführen. Fördermaßnahmen für Erwachsene gibt es seit ca. 25 Jahren; Analphabetismus wurde als bundesrepublikanische Wirklichkeit erkannt und angegangen. Zu Beginn hatte man keine Erfahrung im Schriftspracherwerb erwachsener Analphabeten, weshalb auf Methoden des Anfangsunterrichts zurückgegriffen werden musste. Diese Methoden wurden jedoch bald an die Lebenswelt der erwachsenen Lerner angepasst. Neben der Erwachsenenbildung, die an den VHS-Kursen stattfindet, hat sich bisher noch kein nachhaltiges schulbegleitendes Konzept zur Prävention von Analphabetismus durchgesetzt. Vielmehr sind die gesamten Förderkonzeptionen so angelegt, dass sie erst greifen, wenn es bereits zu spät ist. Den hier aufgeworfenen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. In Kapitel zwei werden die in der Literatur vorgefundenen Begriffsdefinitionen erläutert und gegeneinander abgegrenzt. Kapitel drei befasst sich mit der Entdeckung von Analphabetismus in Deutschland und dessen quantitativen Ausmaß. Dazu werden die PISA- und die IALS-Studie erläutert, die quantifizierte Aussagen über die Lesekompetenz der Deutschen treffen und diese in einen internationalen Kontext stellen. Kapitel vier unternimmt eine Ursachenanalyse des Phänomens Analphabetismus; dabei werden die Sozialisationsinstanzen Familie und Schule betrachtet, um darzustellen, welche Probleme den Analphabetismus begünstigen können. Kapitel fünf stellt mögliche Alltagstrategien funktionaler Analphabeten dar und zeigt auf, wie es möglich ist, dass Analphabeten weitestgehend unentdeckt leben können. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Struktur
- Begriffsbestimmung
- Primärer/totaler Analphabetismus
- Sekundärer oder funktionaler Analphabetismus?
- Funktionaler Analphabetismus
- Kompetenzgruppeneinteilung
- Legasthenie in Abgrenzung zum funktionalen Analphabetismus
- Entdeckung des Analphabetismus in Deutschland
- Analphabetismus als historisch wandelbare Größe
- Quantitative Dimension von Analphabetismus
- IALS und PISA-Studie zur Ermittlung der Lese- und Schreibkenntnisse
- IALS-Studie
- PISA-Studie
- Bewertung der Studien
- Kausalanalyse
- Familiensituation
- „Lesesozialisation in der Familie“
- Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Analphabetismus
- Schulsituation
- Schulimmanente Faktoren
- Individuelle Faktoren
- Familiensituation
- Alltagsstrategien von Analphabeten
- Kompensation schriftsprachlicher Defizite
- Prävention und Fördermaßnahmen
- Alphabetisierung in VHS-Kursen
- Methodische Ansätze an den Volkshochschulen
- Praxis in den Alphabetisierungskursen
- Family Literacy
- E-Learning, www.ich-will-schreiben-lernen.de
- Umsetzung
- Aufbau
- Pilotprojekt „Elementare Schriftkultur“
- Durchführung des Projektes
- Alphabetisierung in VHS-Kursen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Analphabetismus in Deutschland. Sie analysiert die Ursachen für Analphabetismus und beleuchtet die Entwicklung und Umsetzung verschiedener Fördermaßnahmen. Dabei liegt der Fokus auf der Frage, wie die Entstehung von Analphabetismus trotz der in Deutschland bestehenden Schulpflicht erklärt werden kann.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen des Analphabetismus
- Analyse der Ursachen von Analphabetismus, insbesondere im Hinblick auf familiäre, schulische und individuelle Faktoren
- Bewertung verschiedener Fördermaßnahmen und Alphabetisierungsprogramme
- Herausforderungen und Perspektiven der Bekämpfung von Analphabetismus in Deutschland
- Bedeutung der Lesesozialisation in der Familie und der Rolle des Bildungssystems bei der Prävention von Analphabetismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Analphabetismus in Deutschland vor und beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen Schulpflicht und dem Auftreten von Analphabetismus. Kapitel 2 definiert und differenziert die verschiedenen Formen des Analphabetismus, wie z.B. primären, sekundären und funktionalen Analphabetismus. Kapitel 3 befasst sich mit der Entdeckung des Analphabetismus in Deutschland und untersucht die historische Entwicklung sowie die quantitative Dimension des Problems. Anhand der IALS- und PISA-Studie werden Lese- und Schreibkenntnisse in Deutschland erfasst und bewertet. Kapitel 4 analysiert die Ursachen von Analphabetismus, indem es familiäre, schulische und individuelle Faktoren untersucht. Kapitel 5 widmet sich den Alltagsstrategien von Analphabeten und beleuchtet die Kompensation schriftsprachlicher Defizite. Kapitel 6 stellt verschiedene Präventions- und Fördermaßnahmen vor, wie z.B. Alphabetisierung in VHS-Kursen, Family Literacy und E-Learning-Programme. Schließlich werden die Ergebnisse in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen gegeben.
Schlüsselwörter
Analphabetismus, Schulpflicht, Lese- und Schreibfähigkeit, Bildung, Familiensituation, Schulsituation, individuelle Faktoren, Fördermaßnahmen, Alphabetisierung, Prävention, Volkshochschulen, Family Literacy, E-Learning, IALS-Studie, PISA-Studie.
- Quote paper
- Timm Winter (Author), 2006, Analphabetismus trotz Schulpflicht. Überblick, Kausalanalyse und pädagogische Fördermaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61190