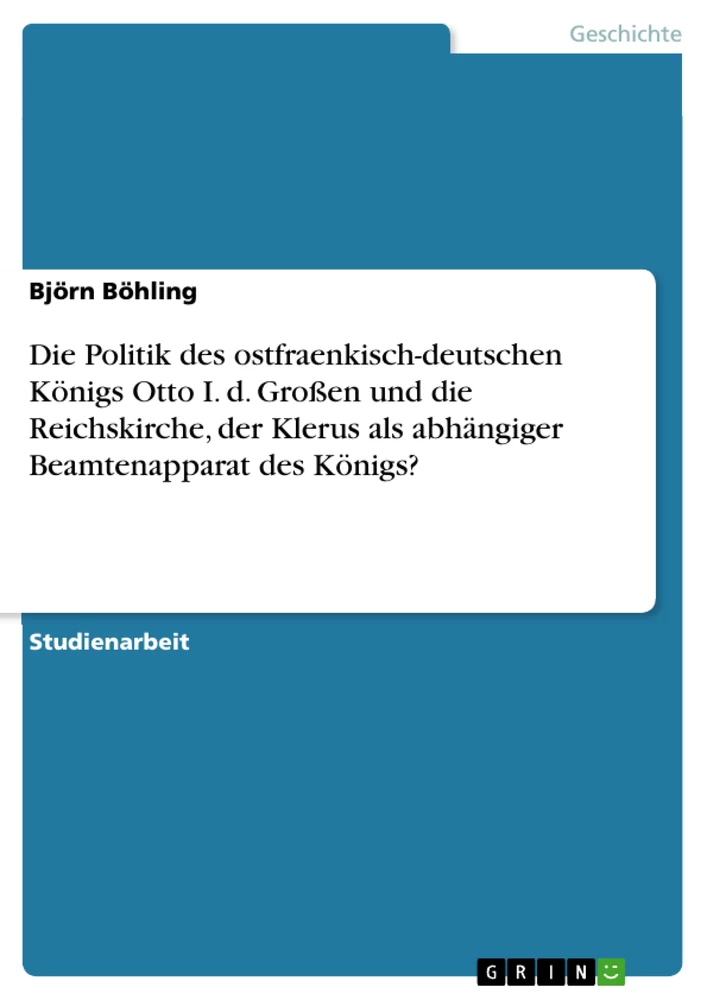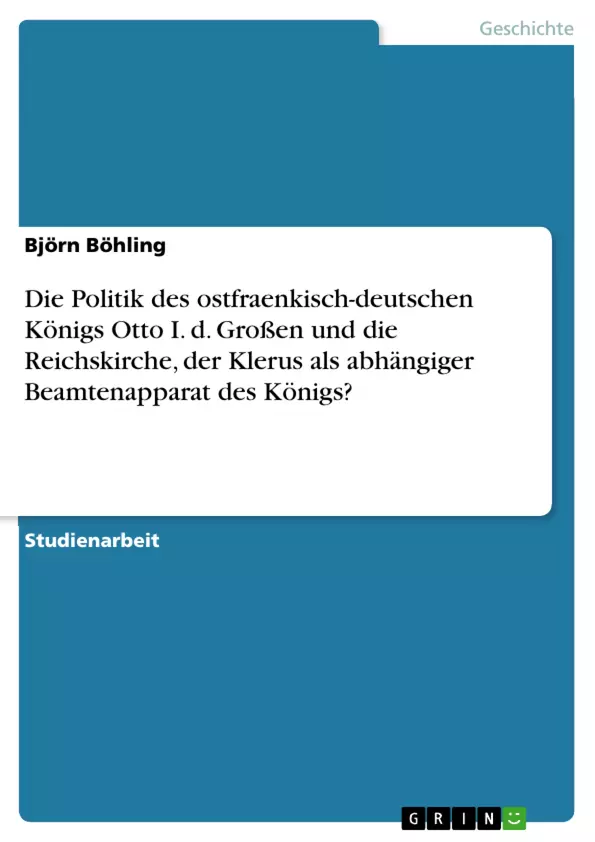Diese schriftliche Hausarbeit befasst sich mit der ottonischen Herrschft im ostfränkisch-deutschen Reich des 10. Jahrhunderts n.Chr. Im Mittelpunkt steht der deutsche König Otto I. d. Große und seine Politik mit der Reichskirche. Untersucht werden Intentionen und Bedingungen dieser Politik. Leitfragen sind, welches Verhältnis zwischen König und Kirche bestand, wie er mit ihr oder auch gegen sie handelte. War die Reichskirche einfach der verlän-
gerte Arm der Königsgewalt, gab es keine Eigenständigkeit, und was wollte der Monarch überhaupt erreichen?
Die Behandlung dieser Fragen bezieht sich fast ausschließlich auf die Regierungszeit Ottos I. als König des Reiches von 936 bis 973. Obwohl sich die ottonisch-salische Reichskirche auch noch unter den folgenden Monarchen entwickelte, soll der Blick auf dem Beginn dieser Entwicklung unter Otto I. liegen, der zwar nicht als Erfinder angesehen werden kann, der sie
aber als erster systematisch für sich nutzte. Aus dem Grund wird auch auf die Kaiserzeit Ottos I. nicht eingegangen. Ebenfalls kann in diesem Rahmen nur die deutsche Reichskirche Beachtung finden und bis auf wenige Abschnitte entfällt ein Vergleich mit den europäischen Nachbarkirchen aus thematischen Gründen.
Timothy Reuter und Rudolf Schieffer leiten mit ihren Aufsätzen die für diese Hausarbeit wichtige Kontroverse ein, die sich anhand der oben angeführten Leitfragen ergibt und die hier nachgezeichnet werden soll. Kurz gesagt, geht es hierbei um die Frage, ob die Gegengewichtsthese, nach der Otto die Kirche als Machtmittel gegen den weltlichen Adel installiert hat, zutrifft oder nicht.
Als Einführung in das Thema wird in den ersten Kapiteln ein historischer Ablauf gegeben, der den Übergang vom Karolinger Reich zum ostfränkisch-deutschen Reich darstellt und schon auf die dabei entstehenden Schwierigkeiten hinweist. Im Folgenden steht Otto I. im Mittelpunkt, seine Politik dem weltlichen Adel und auch der Reichskirche gegenüber. Die Kapitel 3.3. und 4 leiten die Diskussion der Kontroverse um die Leitfragen ein und stellen sie
dar. Diese Abschnitte bilden den Kern dieser Hausarbeit, deren Ergebnisse dann in Kapitel 5 abschließend beurteilt werden. Zur Unterstützung der Darstellung und Orientierung befinden sich im Anhang historische Karten sowie unter 7. eine Zeitleiste über die behandelte Epoche.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte
- Das Ende des Reiches der Karolinger und die Gründung neuer Königreiche im 9. Jh.
- Die Bildung von Stammesherzogtümern
- Die Herrschaft Ottos I. und die Reichsverfassung
- Die Familienpolitik und der Liudolfaufstand
- Bedeutung und Begriff der Reichskirche
- Der Ausbau der Reichskirche
- Die Ausstattung mit Reichsgütern und Hoheitsrechten durch Otto I. und das Servitium regis von Bistümern und Abteien (I)
- Bischöfe, Bischofswahlen und die Hofkapelle (I)
- Expansion und Christianisierung im Osten
- Zusammenfassung und Ausblick
- Kontroverse um die Gegengewichtsthese
- Die Ausstattung mit Reichsgütern und Hoheitsrechten durch Otto I. und das Servitium regis von Bistümern und Abteien (II)
- Bischöfe, Bischofswahlen und die Hofkapelle (II)
- Abschließende Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der ottonischen Herrschaft im ostfränkisch-deutschen Reich des 10. Jahrhunderts n. Chr. Sie untersucht die Politik des deutschen Königs Otto I. d. Großen in Bezug auf die Reichskirche, wobei die Intentionen und Bedingungen dieser Politik im Mittelpunkt stehen. Es werden Fragen nach dem Verhältnis zwischen König und Kirche, Ottos Handeln gegenüber der Kirche und seinen Zielen behandelt.
- Das Verhältnis zwischen König Otto I. und der Reichskirche
- Ottos Politik gegenüber der Reichskirche
- Die Rolle der Reichskirche als Instrument der Königsgewalt
- Die Intentionen Ottos I. in Bezug auf die Reichskirche
- Die Entwicklung der ottonisch-salischen Reichskirche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer historischen Einordnung des Übergangs vom Karolinger Reich zum ostfränkisch-deutschen Reich und beleuchtet dabei die Herausforderungen dieser Zeit. Anschließend wird die Herrschaft Ottos I. fokussiert, insbesondere seine Politik gegenüber dem weltlichen Adel und der Reichskirche. Die Kapitel 3.3 und 4 befassen sich mit der Kontroverse um die Gegengewichtsthese, die besagt, dass Otto die Kirche als Machtmittel gegen den weltlichen Adel einsetzte. Diese Abschnitte bilden den Kern der Arbeit, deren Ergebnisse in Kapitel 5 abschließend beurteilt werden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen der Arbeit sind: ottonische Herrschaft, Reichskirche, König Otto I. d. Große, Gegengewichtsthese, Bischöfe, Bischofswahlen, Servitium regis, Reichsgüter, Hoheitsrechte, Expansion, Christianisierung, Historische Entwicklung, Mittelalter, Karolinger, Fränkisches Reich, Stammesherzogtümer, Machtstrukturen, fränkische Verwaltung, politische und geistliche Macht.
- Arbeit zitieren
- Björn Böhling (Autor:in), 2001, Die Politik des ostfraenkisch-deutschen Königs Otto I. d. Großen und die Reichskirche, der Klerus als abhängiger Beamtenapparat des Königs?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61201