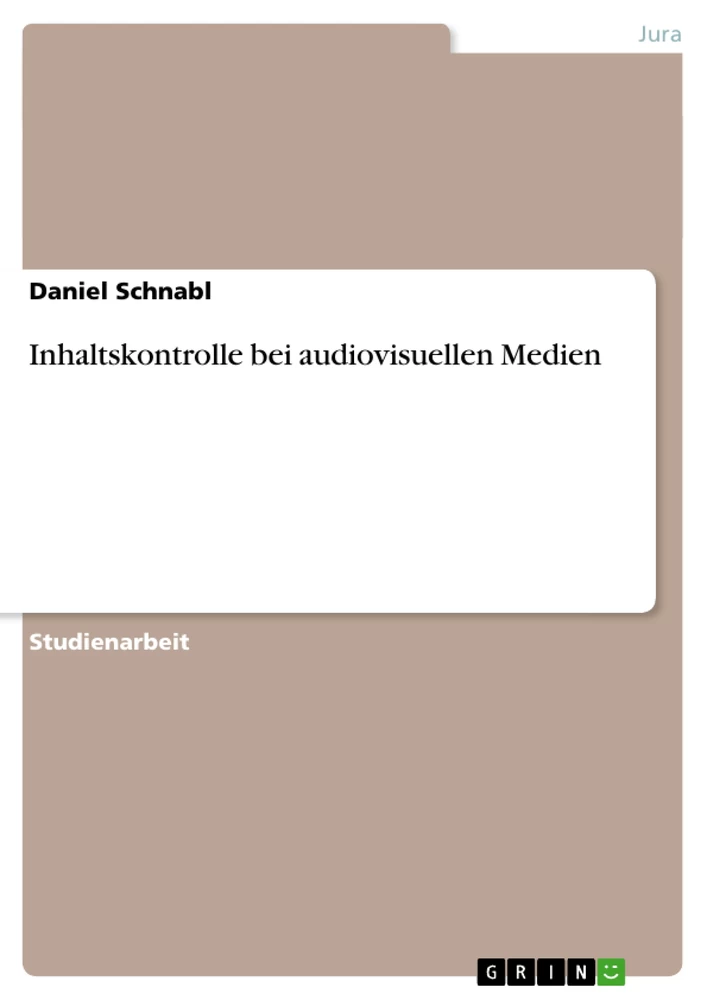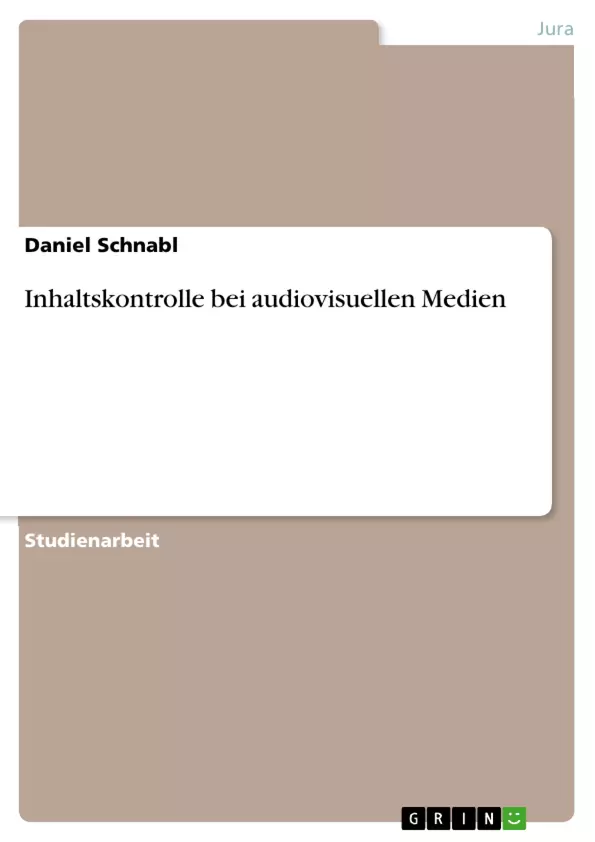Gewalttaten unter Beteiligung Jugendlicher führen regelmäßig zu einer gesellschaftlichen Vorverurteilung. Die Hauptursache solcher Taten wird in der übermäßigen Gewaltdarstellung in den Medien gesucht. In der Öffentlichkeit ist die Ansicht weit verbreitet, dass die vermeintliche Zunahme der Gewaltkriminalität eine Folge der sich häufenden Gewaltdarstellungen in den Massenmedien sei.1
Bei Gewalttaten, wie der eines Jugendlichen am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt, lässt jedoch auch die Forderung der Medien und der Politik nach einer schärferen Kontrolle von Medieninhalten nicht lange auf sich warten. So forderte Bundesinnenminister Schily nach dem ,,Amoklauf von Erfurt", Gewaltszenen in Medien und Computerspielen generell zu verbieten.
Derartige populistische Reaktionen legen zum einen die Frage nah, inwieweit tatsächlich ein Zusammenhang zwischen medialer und tatsächlicher Gewalt besteht. Dies ist jedoch eine Frage der Medienwirkungsforschung, welche hier nicht zu erörtern ist. Gesagt sei nur soviel, dass die diesbezüglichen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Frage noch nicht abschließend geklärt ist.2 Zum anderen verleiht die vom Innenminister angeregte Diskussion der Frage, inwieweit Inhaltskontrolle nach der aktuellen Rechtslage möglich ist und tatsächlich durchgeführt wird, eine wesentliche und aktuelle Bedeutung.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- A) Einführung
- I) Begriffsbestimmung – audiovisuelle Medien
- II) Begriffsbestimmung Inhaltskontrolle
- B) Verfassungsrechtliche Grundlagen der Inhaltskontrolle
- I) Allgemeine verfassungsrechtliche Grundsätze
- II) Freiheitsgarantien des Art. 5 GG
- 1) Grundfreiheiten des Art. 5 Abs. 1 GG
- 2) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Eingriffen in Art. 5 Abs. 1 S. 1, 2 durch Art. 5 Abs. 2 GG
- a) Die Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG
- b) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
- c) Zensur als absolute Eingriffsschranke – Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG
- 3) Die Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG
- 4) Schranken der Kunstfreiheit
- C) Inhaltskontrolle durch gesetzliche Regelungen
- I) Gesetzliche Regelungen aus dem StGB
- 1) Tatbestand der Volksverhetzung - § 130 Abs. 2 StGB
- a) Tatobjekt - Schriften (§ 11 Abs. 3 StGB)
- b) Erfasste Inhalte
- c) Tathandlungen
- d) Tatbestandseinschränkungen
- e) Schutzzweck
- 2) Tatbestand der Gewaltdarstellung - § 131 StGB
- 1a) Tatobjekt
- b) Kontrollierte Inhalte
- c) Tathandlungen
- d) Tatbestandseinschränkungen
- e) Rechtsfolgen und Strafverfolgung
- f) Schutzzweck
- 3) Tatbestand der Verbreitung pornographischer Schriften - § 184
- a) Tatobjekt - Schriften (§ 11 Abs. 3)
- b) Kontrollierte Inhalte und Schutzzweck
- c) Tathandlungen
- e) Tatbestandseinschränkungen
- f) Rechtsfolgen und Strafverfolgung
- 4) Verfassungswidrige Inhalte
- a) Tatbestand des § 86 Abs. 1 i.V.m. § 86 Abs. 2
- b) Tatbestand des § 86 a
- c) Tatbestand des § 130 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2, 3
- 5) Aufwieglerische Inhalte
- a) Aufstacheln zum Angriffskrieg - § 80 a
- b) Öffentliche Aufforderung zu Straftaten - § 111
- c) Anleitung zu Straftaten - § 130 a
- d) Belohnung und Billigung von Straftaten - § 140
- 6) Beleidigende Inhalte
- a) Tatbestände der Verunglimpfung - §§ 90, 90 a, 90 b
- b) Tatbestand des § 103
- c) Tatbestand des § 166
- 7) Zwischenergebnis
- 1) Tatbestand der Volksverhetzung - § 130 Abs. 2 StGB
- II) Gesetzliche Vorschriften des Wettbewerbsrechts
- 1) Generalklausel des § 1 UWG
- 2) Kleine Generalklausel des § 3 UWG
- 3) Zwischenergebnis
- III) Gesetzliche Vorschriften des Urheberrechts
- 1)Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung - § 97 UrhG
- 2) Anspruch auf Vernichtung und Beseitigung - § 98 UrhG
- 3) Straftatbestände des UrhG
- 24) Zwischenergebnis
- IV) Gesetzliche Vorschriften des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GjS)
- 1) Anwendungsbereich und Systematik des GjS
- 2) Die Indizierung nach dem GjS
- 3) Verbreitungsverbote und Beschränkungen der §§ 3 – 5 GjS
- 4) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS)
- 5) Zwischenergebnis
- V) Gesetzliche Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz – JÖSchG)
- 1) § 6 JÖSchG – Öffentliche Filmveranstaltungen
- 2) § 7 JÖSchG - Öffentlich zugängliche bespielte Bildträger
- 3) § 12 JÖSchG – Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände
- 4) Verfassungsrechtliche Bedenken im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG
- 5) Zwischenergebnis
- VI) Inhaltskontrolle im Rahmen des Rundfunkstaatsvertrages
- 1) § 3 RStV - unzulässige Sendungen, Jugendschutz
- 2) § 7 RStV Werbeinhalte
- 3) §§ 2a, 41 RStV - Programmgrundsätze
- 4) Durchsetzung der Inhaltskontrolle - §§ 49 und 49a RStV
- 5) Zwischenergebnis
- VII) Inhaltskontrolle im Rahmen landesrechtlicher Gesetze
- VIII) Inhaltskontrolle durch den Mediendienste-Staatsvertrag
- 1) Begriff des Mediendienstes und Abgrenzungsfragen
- 2) § 8 MDStV – Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz
- 3) § 9 MDStV - Werbung
- IX) Inhaltskontrolle durch das Teledienstgesetz (TDG)
- I) Gesetzliche Regelungen aus dem StGB
- D) Inhaltskontrolle durch freiwillige Kontrolleinrichtungen
- I) Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
- 1) Geschichte der FSK
- 2) Rechtsnatur und Zusammensetzung der FSK
- 3) Grundsätze der FSK
- 4) Verfahren und Prüfpraxis
- 3II) Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (FSF)
- 1) Geschichte
- 2) Rechtsnatur und Zusammensetzung
- 3) Prüfgrundsätze der FSF
- 4) Verfahren und Prüfpraxis
- III) Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM)
- IV) Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
- I) Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
- E) Zusammenfassende Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Inhaltskontrolle bei audiovisuellen Medien. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und Möglichkeiten der Inhaltskontrolle in Deutschland, wobei der Fokus auf den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie den relevanten gesetzlichen Regelungen liegt. Neben der Analyse der staatlichen Regulierung werden auch freiwillige Selbstkontrollmechanismen, wie die FSK oder die USK, in den Blick genommen.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen der Inhaltskontrolle
- Gesetzliche Regelungen zur Inhaltskontrolle
- Freiwillige Selbstkontrolle im Medienbereich
- Zusammenspiel von staatlicher Regulierung und Selbstkontrolle
- Aktuelle Herausforderungen der Inhaltskontrolle im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Begriff der Inhaltskontrolle und eine Definition von audiovisuellen Medien. Anschließend werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Inhaltskontrolle erläutert, wobei die Freiheitsgarantien des Grundgesetzes sowie die Schranken des Art. 5 Abs. 2 GG im Vordergrund stehen.
Kapitel C widmet sich den gesetzlichen Regelungen zur Inhaltskontrolle in Deutschland. Hierbei werden die relevanten Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB), des Wettbewerbsrechts, des Urheberrechts, des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GjS), des Jugendschutzgesetzes (JÖSchG) sowie des Rundfunkstaatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages analysiert.
Kapitel D befasst sich mit der Rolle freiwilliger Kontrolleinrichtungen, wie der FSK, der FSF und der USK. Die Arbeit untersucht die Geschichte, die Rechtsnatur und die Prüfpraxis dieser Institutionen.
Schlüsselwörter
Inhaltskontrolle, audiovisuelle Medien, Medienrecht, Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Urheberrecht, Jugendschutz, Freiwillige Selbstkontrolle, FSK, USK, Mediendienste-Staatsvertrag, Rundfunkstaatsvertrag, Digitalisierung, Regulierung, Selbstregulierung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Inhaltskontrolle?
Die Inhaltskontrolle basiert auf den Schranken der Meinungs- und Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 2 GG, wie dem Jugendschutz und dem Recht der persönlichen Ehre.
Was ist der Unterschied zwischen staatlicher Kontrolle und freiwilliger Selbstkontrolle?
Staatliche Kontrolle erfolgt durch Gesetze (z.B. StGB, Jugendschutzgesetz), während Einrichtungen wie die FSK (Film) oder USK (Spiele) eine freiwillige Prüfung durch die Wirtschaft darstellen.
Ist Zensur in Deutschland erlaubt?
Gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG findet eine Zensur (Vorzensur) nicht statt. Die Inhaltskontrolle erfolgt daher meist nachgelagert oder durch freiwillige Prüfungen.
Welche Rolle spielt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)?
Sie ist für die Indizierung von Medieninhalten zuständig, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu gefährden.
Welche Gesetze regeln die Inhalte in Rundfunk und Internet?
Hier greifen vor allem der Rundfunkstaatsvertrag (RStV), der Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) und das Teledienstgesetz (TDG).
- Quote paper
- Daniel Schnabl (Author), 2002, Inhaltskontrolle bei audiovisuellen Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6122