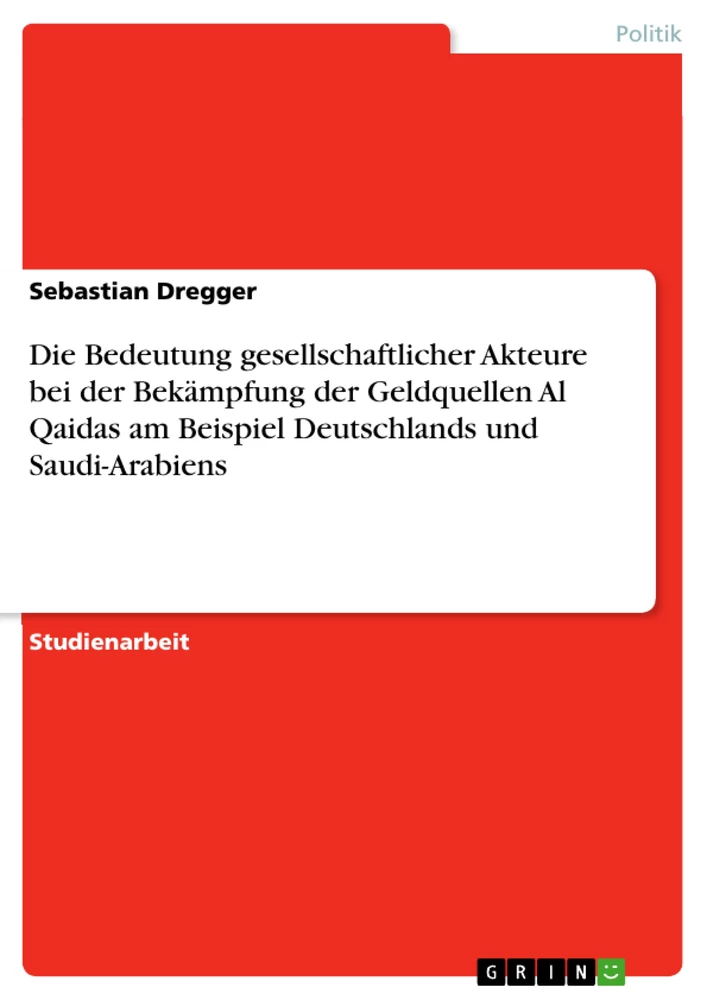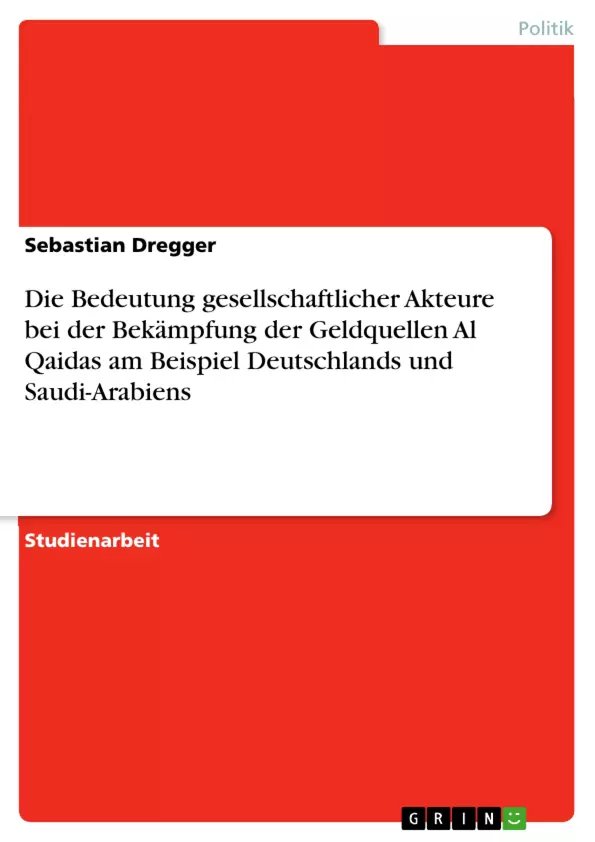Das Follow-the-money-Paradigma im Kampf gegen Al Qaida - und das bisher bescheidene Ergebnis Al Qaida seiner finanziellen Ressourcen zu berauben, hat sich als fester Bestandteil der internationalen Terrorismusbekämpfung spätestens seit den Anschlägen des 11. Septembers 2001 etabliert. Vor allem die USA und die Vereinten Nationen haben als unmittelbare Reaktion auf den 11. September darauf gedrängt, die Bekämpfung der Geldmittel Al Qaidas auf die internationale politische Agenda zu setzen. Mit dieser Form der Terrorismusbekämpfung, die von der UN, der EU und der FATF auf internationaler Ebene gefördert wird, werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll durch die nachträgliche Ermittlung der finanziellen Transaktionen, die etwa zur Vorbereitung des 11. Septembers getätigt wurden, eine bessere strafrechtliche Verfolgung der Attentäter und ihrer Hintermänner ermöglicht werden; zum anderen soll die Sperrung aller ermittelten Geldkonten die finanzielle Potenz Al Qaidas erheblich schwächen, mit der Folge, dass das Terrornetzwerk in Zukunft kaum mehr in der Lage wäre, Tausende von Kämpfern auszubilden und zu unterhalten und logistisch komplexe Attentate mit großem Zerstörungspotenzial wie etwa die des 11. Septembers durchzuführen, worauf letztlich die enorme Gefährlichkeit Al Qaidas als weitweit führende transnationale Terrororganisation beruht. Die Ergebnisse, die bisher im Rahmen dieser Politik international erzielt werden konnten, sind allerdings recht bescheiden gewesen: Einerseits verkünden eine Reihe von Staaten, allen voran die USA, wie erfolgreich sie bei der Trockenlegung der Geldquellen waren, was zudem in den Reporten der Vereinten Nation bestätigt wird; zum anderen aber gilt es sich vor Augen zu halten, dass Al Qaida eine ganze Serie verheerender Anschläge auch und gerade nach dem 11. September durchführen konnte (etwa Madrid 2004, London 2005), was letztlich auf eine weiter bestehende, gut funktionierende finanzielle Ausstattung des Terrornetzwerkes schließen lässt - trotz der internationalen Bemühungen, Al Qaidas Geldquellen nachhaltig auszutrocknen. So gehen Schätzungen immer noch davon aus, dass Al Qaida einen Jahresumsatz von 20- 50 Millionen Euro erzielt. Zudem ist es dem Terrornetzwerk nach seiner Vertreibung aus Afghanistan gelungen, seine Ausgaben von jährlich 35 Millionen auf 5 -10 Millionen Euro zu verringern. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- A. Das Follow-the-money-Paradigma im Kampf gegen Al Qaida – und das bisher bescheidene Ergebnis
- B. Erklärungsansätze
- 1) Das Problem fragiler Staatlichkeit im Kontext der Geldquellen Al Qaidas
- 2) Das Problem der Off-Shore-Zentren im Kontext der Geldquellen Al Qaidas
- 3) Der Erklärungsansatz dieser Arbeit – die Relevanz privater Akteure
- 4) Vorgehen
- A. Die Geldquellen
- 1) Das Privatvermögen seiner Mitglieder
- 2) Einkünfte aus wirtschaftlichen Tätigkeiten
- a) Legale Geschäfte
- b) Illegale Geschäfte
- aa) Drogenhandel
- bb) Waffenhandel
- cc) Diamanten- und Edelmetallschmuggel
- 3) Das Anwerben von privaten Spenden
- a) Die Einnahmen über karitativ-religiöse Einrichtungen
- b) Einnahmen über private Spender
- B. Die Geldtransfermethoden
- 1) Die Benutzung westlicher Banksysteme durch Al Qaida
- 2) Die Benutzung islamischer Banksysteme durch Al Qaida
- 3) Das informelle Geldtransfersystem der Hawala
- A. Deutschland
- B. Saudi-Arabien
- A. Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure
- B. Konsequenzen für die Politik aus der Bedeutung gesellschaftlicher Akteure
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al-Qaidas, anhand von Fallbeispielen Deutschlands und Saudi-Arabiens. Ziel ist es, die Wirksamkeit des „Follow-the-money“-Paradigmas zu hinterfragen und alternative Erklärungsansätze zu entwickeln, die die Rolle nicht-staatlicher Akteure stärker berücksichtigen.
- Die Effektivität des internationalen Kampfes gegen die Finanzierung von Al-Qaida
- Die Rolle fragiler Staatlichkeit bei der Terrorismusfinanzierung
- Der Einfluss privater Akteure auf die Geldquellen Al-Qaidas
- Der Vergleich der Strategien Deutschlands und Saudi-Arabiens zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Die Reaktion gesellschaftlicher Akteure auf staatliche Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt das „Follow-the-money“-Paradigma im Kampf gegen Al-Qaida vor und konstatiert dessen bisher bescheidenen Erfolg. Trotz internationaler Bemühungen, Al-Qaidas Finanzquellen auszutrocknen, konnte das Terrornetzwerk weiterhin Anschläge verüben. Die Arbeit untersucht daher alternative Erklärungsansätze, die die Rolle staatlicher und nicht-staatlicher Akteure berücksichtigen. Die Bedeutung fragiler Staatlichkeit und die Rolle von Offshore-Zentren werden angesprochen, bevor der eigene Erklärungsansatz – die Relevanz privater Akteure – vorgestellt wird. Die Methodik der Arbeit wird ebenfalls skizziert.
II. Die finanzielle Infrastruktur Al Qaidas: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Finanzierungsquellen Al-Qaidas, beginnend mit dem Privatvermögen der Mitglieder, über Einkünfte aus legalen und illegalen Geschäften (Drogenhandel, Waffenhandel, Schmuggel) bis hin zu privaten Spenden über karitative und religiöse Einrichtungen. Es analysiert zudem die Geldtransfermethoden, inklusive der Nutzung westlicher und islamischer Banksysteme sowie des informellen Hawala-Systems. Das Kapitel liefert somit ein umfassendes Bild der komplexen finanziellen Infrastruktur von Al-Qaida.
III. Die Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas in Deutschland und Saudi Arabien: Dieses Kapitel vergleicht die Strategien Deutschlands und Saudi-Arabiens im Kampf gegen die Finanzierung von Al-Qaida. Es analysiert die jeweiligen staatlichen Maßnahmen, einschließlich internationaler Zusammenarbeit, sowie deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Akteure (Muslime, Banken, Bankkunden, Königsfamilie, Ulama, Clans). Der Vergleich beider Länder soll die unterschiedlichen Herausforderungen und Erfolge bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verdeutlichen und die Rolle der jeweiligen Gesellschaften hervorheben.
Schlüsselwörter
Al-Qaida, Terrorismusfinanzierung, Follow-the-money-Paradigma, fragile Staatlichkeit, Offshore-Zentren, private Akteure, Deutschland, Saudi-Arabien, Geldwäsche, Hawala, gesellschaftliche Akteure, internationale Zusammenarbeit, Terrorismusbekämpfung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al-Qaidas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al-Qaidas, anhand von Fallbeispielen Deutschlands und Saudi-Arabiens. Sie hinterfragt die Effektivität des „Follow-the-money“-Paradigmas und entwickelt alternative Erklärungsansätze, die die Rolle nicht-staatlicher Akteure stärker berücksichtigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Effektivität des internationalen Kampfes gegen die Finanzierung von Al-Qaida, der Rolle fragiler Staatlichkeit bei der Terrorismusfinanzierung, dem Einfluss privater Akteure auf die Geldquellen Al-Qaidas, einem Vergleich der Strategien Deutschlands und Saudi-Arabiens zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Reaktion gesellschaftlicher Akteure auf staatliche Maßnahmen.
Welche Finanzierungsquellen von Al-Qaida werden untersucht?
Die Arbeit analysiert detailliert die Finanzierungsquellen Al-Qaidas, darunter das Privatvermögen der Mitglieder, Einkünfte aus legalen und illegalen Geschäften (Drogenhandel, Waffenhandel, Schmuggel) und private Spenden über karitative und religiöse Einrichtungen.
Welche Geldtransfermethoden werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Nutzung westlicher und islamischer Banksysteme durch Al-Qaida sowie das informelle Geldtransfersystem der Hawala.
Wie werden die Strategien Deutschlands und Saudi-Arabiens verglichen?
Das Kapitel III vergleicht die Strategien Deutschlands und Saudi-Arabiens im Kampf gegen die Finanzierung von Al-Qaida. Es analysiert die jeweiligen staatlichen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Akteure (Muslime, Banken, Bankkunden, Königsfamilie, Ulama, Clans).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit betont die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Terrorismusfinanzierung und zieht Konsequenzen für die Politik aus der Bedeutung dieser Akteure.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Al-Qaida, Terrorismusfinanzierung, Follow-the-money-Paradigma, fragile Staatlichkeit, Offshore-Zentren, private Akteure, Deutschland, Saudi-Arabien, Geldwäsche, Hawala, gesellschaftliche Akteure, internationale Zusammenarbeit, Terrorismusbekämpfung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur finanziellen Infrastruktur Al-Qaidas, ein Kapitel zum Vergleich der Bekämpfung der Geldquellen in Deutschland und Saudi-Arabien und ein Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Wirksamkeit des „Follow-the-money“-Paradigmas zu hinterfragen und alternative Erklärungsansätze zu entwickeln, die die Rolle nicht-staatlicher Akteure stärker berücksichtigen.
- Quote paper
- Sebastian Dregger (Author), 2006, Die Bedeutung gesellschaftlicher Akteure bei der Bekämpfung der Geldquellen Al Qaidas am Beispiel Deutschlands und Saudi-Arabiens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61285