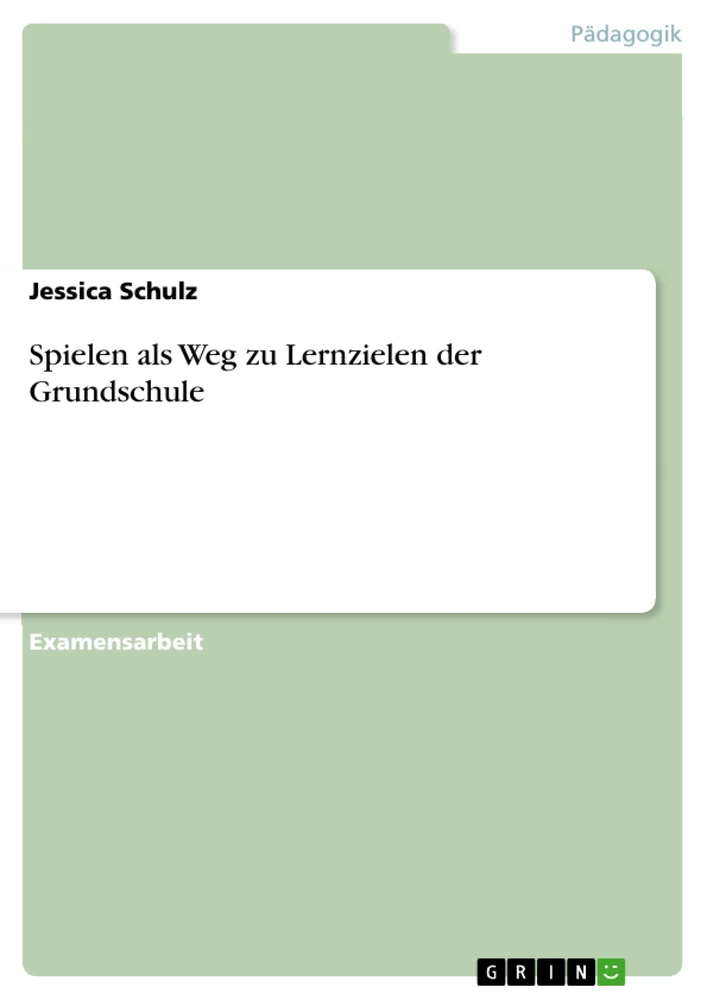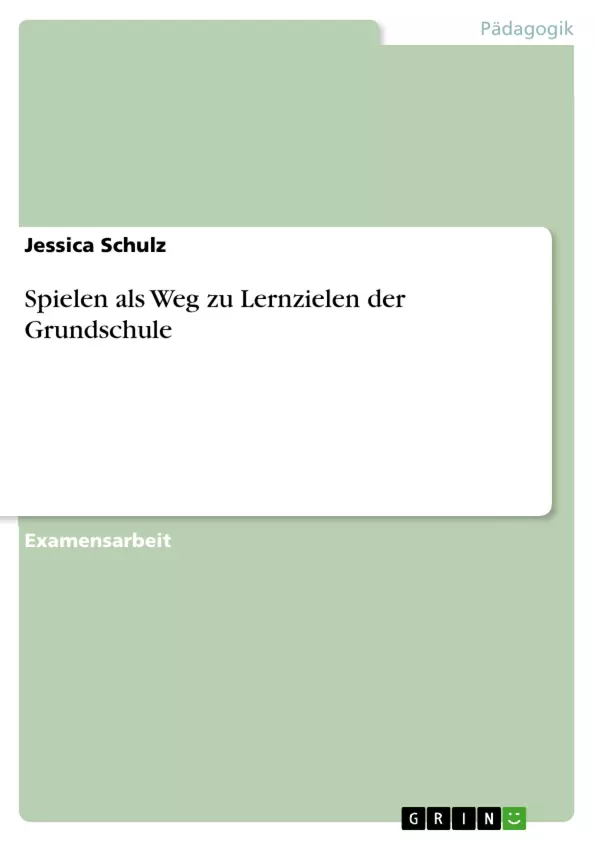Kleine Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Zeit mit Spielen 1 . In der spielerischen Auseinandersetzung mit der Umwelt erwerben sie u.a. psychomotorische und soziale Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (vgl. Hetzer 1975, 11). Beim Eintritt in die Grundschule kommt es bezüglich spielerischer Lernprozesse jedoch oftmals zu einem bedeutenden Einschnitt - Spielen wird sogleich als unnütz, unrealistisch und unergiebig abqualifiziert und in den außerschulischen Bereich verwiesen (vgl. Kluge 1981, 9). Hierbei wird allerdings übersehen, dass Spielen lange Zeit als Basis für sämtliche Lernprozesse gilt und in den ersten Lebensjahren des Kindes geradezu als Synonym für Lernen verwendet werden kann (vgl. Daublebsky 1988, 9). Vor diesem Hintergrund sollte kritisch hinterfragt werden, ob eine abrupte Zäsur dieser beiden, zuvor geradezu natürlich zusammenhängenden Phänomene, wirklich als sinnvoll erscheint. Es lassen sich einige Argumente anführen, warum der Einsatz spielorientierter Lernformen in der Grundschule sehr effektiv sein kann. So kann durch Spiel(en) bspw. der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert werden. Darüber hinaus lässt sich eine erhöhte Motivation der Schüler für Lernprozesse erreichen (vgl. Einsiedler 1999a, 160f.). Diese Vorteile sollten in der Grundschule genutzt werden, um Kinder an eine positive Lernhaltung heranzuführen und diese nachhaltig zu sichern. Aufgrund der hohen Leistungsanforderungen der heutigen Gesellschaft kommt dem spielerischen Lernen jedoch ungeachtet der angeführten Argumente scheinbar nur eine geringe Beachtung zu. Die herkömmliche Vermittlung von Kulturtechniken scheint angesichts des schlechten Abschneidens Deutschlands bei den internationalen Vergleichsstudien oberste Priorität zu haben. Die Grundschule wird von der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang zunehmend in die Pflicht genommen, die Qualität der Leistung zu sichern (vgl. Steinweg 2006, 14) - Spiel(en) findet daher oftmals nur noch im Sportunterricht, als Entspannung oder als s.g. „Dessert-Funktion“ Anwendung (vgl. Hielscher 1981, 11). [...]
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einführender Teil
- 1 Definitionen
- 1.1 Definition „Spiel(en)“
- 1.1.1 Diskussion des Begriffes „Spiel(en)“
- 1.1.2 Explikation des Begriffes „Spiel(en)“
- 1.2 Definition „Lernen“
- 1.2.1 Diskussion des Begriffes „Lernen“
- 1.2.2 Lerntheorien
- 2 Theoretische Zusammenhänge zwischen „Spielen“ und „Lernen“
- 2.1 Grundzüge der kognitiven Spieltheorie nach Jean Piaget
- 2.2 Grundzüge der Motivationspsychologie
- 2.3 Zwischenfazit
- 3 Veränderte Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spielen in der Grundschule
- 3.1 Veränderte Familienbedingungen
- 3.2 Veränderte Kindheit
- 3.2.1 Verplante Kindheit
- 3.2.2 Verinselung und Verhäuslichung
- 3.2.3 Medienkindheit
- 3.3 Grundschulen im Wandel
- 3.3.1 Schulische Aufgaben im Widerspruch
- 3.3.2 Probleme konventioneller schulischer Lernstrukturen
- 4 Spiel als Grundvoraussetzung für den Aufbau einer positiven Lernhaltung
- 4.1 Spielen lernen
- 4.2 Spiel als Mittel zur Erleichterung des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule und zum Abbau von Schulunlust
- 4.3 Weitere positive Aspekte des Spieles in der Grundschule
- 4.4 Zwischenfazit
- 5 Die Lernziele der Grundschule
- 5.1 Definition „Lernziele“
- 5.2 Die Lernziele der Grundschule aus historischer Perspektive
- 5.3 Die „aktuell gültigen Lernziele“ der Grundschule für das Bundesland Niedersachsen
- 6 Erreichung von Lernzielen durch ausgewählte Spielformen
- 6.1 Auswahl geeigneter Spielformen für die Grundschule
- 6.2 Untersuchung zur Erreichung von Lernzielen durch ausgewählte Spielformen
- 6.2.1 Darstellendes Spiel
- 6.2.2 Rollenspiele
- 6.2.3 Interaktionsspiele
- 6.2.4 Kooperationsspiele
- 6.2.5 Regelspiele
- 6.2.6 Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele
- 6.2.7 Planspiele
- 6.2.8 Lernspiele
- 6.2.9 Sprachspiele
- 6.2.10 Computerspiele
- 6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.3.1 Grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
- 6.3.2 Kreativität und Phantasie
- 6.3.3 Sozialkompetenz
- 6.3.4 Regelverständnis
- 6.3.5 Kommunikationsfähigkeit
- 6.3.6 Selbstkonzept
- 6.3.7 Lern- und Leistungsbereitschaft
- 6.3.8 Förderung weiterer fächerübergreifender Bildungs- und Erziehungsaufgaben
- 6.3.9 Konzentrationsfähigkeit
- 6.3.10 Problemlösungsverhalten
- 6.4 Möglichkeit der simultanen Realisierung aller schulischen Lernziele
- 7 Spielen in der Schule – Kritik, Hindernisse und Ansatzpunkte zur Verbesserung
- 7.1 Kritik am schulischen Einsatz von Spiel(en)
- 7.1.1 Spielforscher
- 7.1.2 Gesellschaft
- 7.1.3 Institution Schule
- 7.2 Institutionelle Hindernisse gegen eine umfassende Spielpraxis
- 7.3 Faktoren für den erfolgreichen Einsatz von Spiel(en) als Weg zu Lernzielen der Grundschule
- 7.3.1 Notwendige Veränderungen im Bereich institutioneller Vorgaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einsatz von Spielen als Methode zur Erreichung von Lernzielen in der Grundschule. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Spiels und des Lernens, analysiert veränderte Rahmenbedingungen und untersucht die Eignung verschiedener Spielformen zur Förderung unterschiedlicher Lernziele.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Spiel“ und „Lernen“
- Theoretische Zusammenhänge zwischen Spiel und Lernen
- Der Einfluss veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf den Einsatz von Spielen in der Schule
- Analyse der Eignung verschiedener Spielformen zur Erreichung von Lernzielen
- Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale beim Einsatz von Spielen im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einführender Teil: Dieser einführende Teil legt den Fokus auf die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Inwiefern können Spiele in der Grundschule effektiv zur Erreichung von Lernzielen eingesetzt werden? Er skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Ausblick auf die behandelten Themengebiete.
1 Definitionen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Spiel“ und „Lernen“. Es werden verschiedene Spieldefinitionen diskutiert und kritisch beleuchtet, um ein gemeinsames Verständnis für den weiteren Verlauf der Arbeit zu schaffen. Die Definition von „Lernen“ umfasst verschiedene Lerntheorien und deren Relevanz für den Kontext der Arbeit.
2 Theoretische Zusammenhänge zwischen „Spielen“ und „Lernen“: Hier werden die theoretischen Grundlagen für den Zusammenhang zwischen Spiel und Lernen erörtert. Die kognitive Spieltheorie Piagets und motivationspsychologische Aspekte werden vorgestellt und ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis hervorgehoben. Der Abschnitt unterstreicht die Bedeutung von intrinsischer Motivation und kognitiver Entwicklung durch spielerisches Lernen.
3 Veränderte Rahmenbedingungen für den Einsatz von Spielen in der Grundschule: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss veränderter Familienstrukturen, Kindheitserfahrungen (verplante Kindheit, Verinselung, Medienkindheit) und des Wandels der Grundschulen selbst auf die Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Spielen im Unterricht. Es werden die sich verändernden Anforderungen an die Schule und deren Auswirkungen auf die Lernprozesse diskutiert.
4 Spiel als Grundvoraussetzung für den Aufbau einer positiven Lernhaltung: Dieses Kapitel argumentiert für den Wert des Spiels als wichtigen Bestandteil einer positiven Lernhaltung. Es wird gezeigt, wie Spielen zum Aufbau von Lernfreude und zum erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beitragen kann. Die positiven Aspekte des Spiels im Hinblick auf Motivation und Lernbereitschaft der Kinder werden umfassend dargestellt.
5 Die Lernziele der Grundschule: In diesem Kapitel werden die Lernziele der Grundschule definiert und aus historischer Perspektive betrachtet. Der aktuelle niedersächsische Lehrplan dient als Referenzrahmen, um die zu erreichenden Lernziele im Detail darzustellen und als Grundlage für die anschließende Analyse des Einsatzes von Spielen zu verwenden.
6 Erreichung von Lernzielen durch ausgewählte Spielformen: Dieser umfangreiche Abschnitt untersucht die Eignung verschiedener Spielformen (Darstellendes Spiel, Rollenspiele, Interaktionsspiele, Kooperationsspiele, Regelspiele, Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele, Planspiele, Lernspiele, Sprachspiele, Computerspiele) zur Erreichung der im vorherigen Kapitel dargestellten Lernziele. Für jede Spielform werden konkrete Beispiele und deren didaktische Relevanz detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt, um aufzuzeigen, wie verschiedene Lernziele durch den Einsatz geeigneter Spielformen erreicht werden können.
7 Spielen in der Schule – Kritik, Hindernisse und Ansatzpunkte zur Verbesserung: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik am Einsatz von Spielen im Unterricht aus verschiedenen Perspektiven (Spielforscher, Gesellschaft, Institution Schule). Es werden institutionelle Hindernisse identifiziert und Ansatzpunkte zur Verbesserung der Spielpraxis in der Grundschule aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Strategien, um den positiven Einfluss von Spielen im Unterricht zu maximieren.
Schlüsselwörter
Spielen, Lernen, Grundschule, Lernziele, Spielformen, Motivation, Kognitive Entwicklung, Sozialkompetenz, pädagogische Praxis, Lehrplan Niedersachsen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Spielen und Lernen in der Grundschule
Was ist der Hauptfokus dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einsatz von Spielen als Methode zur Erreichung von Lernzielen in der Grundschule. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, analysiert veränderte Rahmenbedingungen und untersucht die Eignung verschiedener Spielformen zur Förderung unterschiedlicher Lernziele. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern können Spiele in der Grundschule effektiv zur Erreichung von Lernzielen eingesetzt werden?
Welche Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit beginnt mit der Definition und Abgrenzung der zentralen Begriffe „Spiel“ und „Lernen“. Es werden verschiedene Spieldefinitionen diskutiert und kritisch beleuchtet, und die Definition von „Lernen“ umfasst verschiedene Lerntheorien.
Welche theoretischen Zusammenhänge zwischen Spielen und Lernen werden behandelt?
Die Arbeit erörtert die theoretischen Grundlagen des Zusammenhangs zwischen Spiel und Lernen. Die kognitive Spieltheorie Piagets und motivationspsychologische Aspekte werden vorgestellt und ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis hervorgehoben. Die Bedeutung von intrinsischer Motivation und kognitiver Entwicklung durch spielerisches Lernen wird unterstrichen.
Wie werden veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigt?
Die Hausarbeit analysiert den Einfluss veränderter Familienstrukturen, Kindheitserfahrungen (verplante Kindheit, Verinselung, Medienkindheit) und den Wandel der Grundschulen selbst auf den Einsatz von Spielen im Unterricht. Die sich verändernden Anforderungen an die Schule und deren Auswirkungen auf die Lernprozesse werden diskutiert.
Welche Rolle spielt das Spiel beim Aufbau einer positiven Lernhaltung?
Die Arbeit argumentiert für den Wert des Spiels als wichtigen Bestandteil einer positiven Lernhaltung. Es wird gezeigt, wie Spielen zum Aufbau von Lernfreude und zum erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beitragen kann. Die positiven Aspekte des Spiels im Hinblick auf Motivation und Lernbereitschaft werden umfassend dargestellt.
Welche Lernziele der Grundschule werden betrachtet?
Die Lernziele der Grundschule werden definiert und aus historischer Perspektive betrachtet. Der aktuelle niedersächsische Lehrplan dient als Referenzrahmen, um die zu erreichenden Lernziele darzustellen und als Grundlage für die Analyse des Einsatzes von Spielen zu verwenden.
Welche Spielformen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Eignung verschiedener Spielformen zur Erreichung der Lernziele. Dazu gehören: Darstellendes Spiel, Rollenspiele, Interaktionsspiele, Kooperationsspiele, Regelspiele, Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele, Planspiele, Lernspiele, Sprachspiele und Computerspiele. Für jede Spielform werden konkrete Beispiele und deren didaktische Relevanz detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden in Bezug auf die Erreichung von Lernzielen durch Spiele erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, wie verschiedene Lernziele (z.B. Grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kreativität, Sozialkompetenz, Regelverständnis, Kommunikationsfähigkeit etc.) durch den Einsatz geeigneter Spielformen erreicht werden können. Die Möglichkeit der simultanen Realisierung aller schulischen Lernziele wird diskutiert.
Welche Kritikpunkte und Hindernisse beim Einsatz von Spielen im Unterricht werden angesprochen?
Die Arbeit widmet sich der Kritik am Einsatz von Spielen im Unterricht aus verschiedenen Perspektiven (Spielforscher, Gesellschaft, Institution Schule). Institutionelle Hindernisse werden identifiziert und Ansatzpunkte zur Verbesserung der Spielpraxis in der Grundschule aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Strategien zur Maximierung des positiven Einflusses von Spielen im Unterricht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Spielen, Lernen, Grundschule, Lernziele, Spielformen, Motivation, Kognitive Entwicklung, Sozialkompetenz, pädagogische Praxis, Lehrplan Niedersachsen.
- Quote paper
- Jessica Schulz (Author), 2006, Spielen als Weg zu Lernzielen der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61410