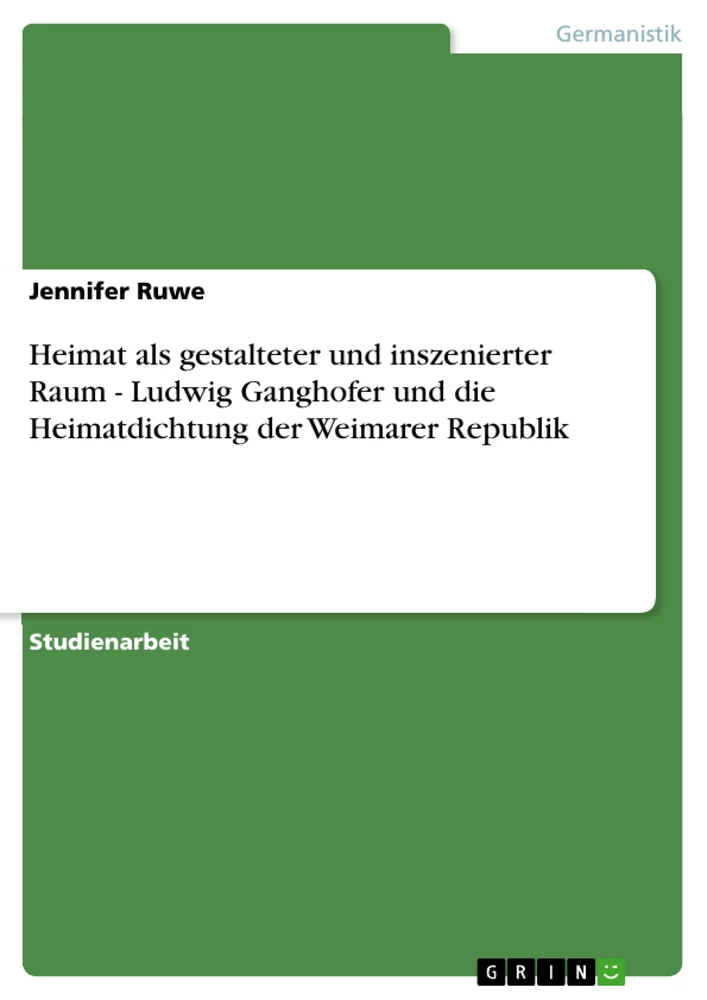„Man hörte noch den Lärm des Dorfes, den Hall verschwommener Stimmen und das Geläut einer Kirchenglocke, die zur sonntäglichen Vesper rief. Dann verschwanden die letzten Häuser hinter Büschen und Bäumen. Entlang dem zerrissenen Ufer eines Wildbaches ging’s eine Weile an Bergwiesen und zerstreuten Feldgehölzen vorüber, und sacht begann das schmale Sträßlein zu steigen. Während die Kutsche in langsamer Fahrt in den von Sonnenglanz umwobenen Hochwald einlenkte, klang vom Dorfe her noch ein letzter Glockenton, als möchte das im Tal versinkende Treiben der Menschen Abschied von dem einsamen Manne nehmen, der sich aus dem Wirbel des Lebens in die abgeschiedene Stille der Berge flüchtete.“1
Ludwig Ganghofer beginnt so einen seiner bekanntesten Hochlandromane -Das Schweigen im Walde.Und dieser kurze Abschnitt trägt in sich bereits den Kern der ganghoferschen Märchenwelt, die fernab von Lärm und Alltag in wilder Natur voll Sonnenglanz und Idylle denjenigen erwartet, der den Aufstieg in die Bergwelt wagt. Es verlangt vom Leser nicht sonderlich viel Fantasie, die zum Text passenden Bilder vor dem geistigen Auge erscheinen zu lassen. Woher kommen diese Bilder nur? Meine Generation denkt dabei vielleicht zuerst an Fantasyfilme a là Der Herr der Ringe.Aber diese Schilderung stammt aus einer Zeit, als es offenbar noch keiner Transposition der Handlung in eine non-reale Welt bedurfte um Rationalität und Wahrheitsempfinden des Publikums oder des Lesers zu umgehen. Es handelt sich bei den Schilderungen Ganghofers um romantische (Natur-) Bilder, die sich hauptsächlich aus Klischees speisen und damit in der filmischen Umsetzung allen Vorstellungen entsprechen. Vielleicht deshalb gehört Ganghofer zu den meist verfilmten deutschen Autoren. Zu Lebzeiten bereits ein Bestseller-Autor, gab er vielen durch die Veränderungen der Moderne desorientierten Menschen Geschichten voller Ordnung, Glück und Geborgenheit. Und dabei ging es nicht nur um Ablenkung vom Alltag und Flucht in eine Märchenwelt. Nein - Ganghofer machte Mut und Hoffnung auf eine reale Verbesserung der Menschheit und des Lebens. Für diese Authentizität stand Ganghofer quasi mit seinem Namen, die Glaubhaftigkeit seiner Romane und damit auch sein Erfolg wurden nur dadurch möglich, dass der Autor seine Geschichten anscheinend selbst lebte.
Das Anliegen der folgenden Arbeit ist es, Ganghofer und seine Hochlandgeschichten als Teil der Heimatliteratur-Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Literatur in der Weimarer Republik
- 2. Entstehung der Heimatliteratur
- 3. München contra Berlin
- 4. Ludwig Ganghofer
- 4.1. Vita
- 4.2. Aspekte der ganghoferschen Literatur
- 4.2.1. Natur und Stadt
- 4.2.2. Kindheit und Jugend
- 4.2.3. Charaktere
- 4.3. Zur Selbstinszenierung Ganghofers
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Ludwig Ganghofer und seinen Hochlandgeschichten als Teil der Heimatliteratur-Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Fokus steht die Konstruktion eines typisierten Bildes von Heimat als realem und idealem Ort, das in seinen weitesten Entwicklungen schließlich ein Teil der nationalsozialistischen Ideologie wurde. Insbesondere wird die Selbstinszenierung Ganghofers untersucht, die Fragen nach der Gewichtung von ideologischen Vorstellungen und finanziellem Pragmatismus aufwirft und damit auch den Blick auf den Beginn einer Massenliteratur und den damit verbundenen Wandel von Autorenstand und Literaturbetrieb lenkt.
- Heimatliteratur als Reaktion auf die Verstädterung und Entwurzelung
- Konstruktion eines idealisierten Bildes von Heimat
- Die Rolle von Ludwig Ganghofer in der Heimatliteratur-Bewegung
- Selbstinszenierung des Autors und der Einfluss auf die Glaubhaftigkeit seiner Werke
- Die Entwicklung der Heimatliteratur in den Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt Ludwig Ganghofer und seine Hochlandromane als Vertreter der Heimatliteratur vor. Die Einleitung verdeutlicht die typische Idylle und Naturverherrlichung, die in Ganghofers Werken zu finden sind und den Leser in eine Welt voller Sonnenglanz und Harmonie eintauchen lässt. Dabei wird deutlich, dass Ganghofer seine Romane als Flucht aus der modernen Welt, aber auch als Hoffnung auf eine reale Verbesserung der Menschheit und des Lebens inszenierte.
1. Literatur in der Weimarer Republik
Das Kapitel beleuchtet die Literatur der Weimarer Republik und die Abkehr vom Expressionismus hin zur „Neuen Sachlichkeit“. Es wird deutlich, dass die Literatur dieser Zeit stark von den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und der damit verbundenen Unsicherheiten geprägt war. Während die „Neue Sachlichkeit“ sich mit der Darstellung der zeitgenössischen Realität befasste, suchte ein Großteil der Bevölkerung nach Ablenkung und Entspannung in einer idealisierten Welt. Die zunehmende Verbreitung von Massenmedien wie Film und Rundfunk führte zu einem Wandel im Literaturbetrieb, der sich an den Bedürfnissen der Leserschaft orientierte. Die Literatur der Weimarer Republik spaltet sich so in zwei Ebenen: die avantgardistische Großstadtliteratur und die volkstümliche Heimatliteratur, die den Sehnsüchten nach Geborgenheit und Sicherheit entsprach.
2. Entstehung der Heimatliteratur
Dieses Kapitel untersucht die Anfänge der Heimatliteratur, die als Reaktion auf die industrielle Revolution entstand. Besonders in Österreich und Süddeutschland entwickelte sich eine regionalistische Literatur, die das ländliche Leben idealisierte und der Verstädterung und Entwurzelung eine heile Welt der Provinz entgegensetzte. Die Heimatliteratur erlebte um die Jahrhundertwende eine Aufwertung als neues Paradigma, das von der vermeintlichen „Entartung“ der modernen Literatur abweichen sollte. In engem Zusammenhang mit der Heimatkunstbewegung stand die Heimatliteratur als Reaktion auf den großstädtischen Literaturbetrieb. Heimatdichter wie Ludwig Ganghofer oder Hans Carossa verherrlichten in ihren Romanen alte Ideale und Traditionen. Es wird aber auch ein weiterer Strang der Heimatdichtung beleuchtet, der sich mit gesellschaftlichen Problemen und den Veränderungen in der Heimat auseinandersetzt, z. B. Ludwig Thoma oder Hermann Hesse. Eine stark nationalistische und antisemitische Tendenz zeichnet sich in den Werken von Hans Friedrich Blunck und Adolf Bartel ab, die schließlich zur „Blut und Boden“-Literatur führten, die ab 1933 von der Reichsschrifttumskammer gefördert wurde.
Schlüsselwörter
Heimatliteratur, Ludwig Ganghofer, Weimarer Republik, Neue Sachlichkeit, Massenliteratur, Selbstinszenierung, Ideologie, Nationalsozialismus, Heimatkunstbewegung, Blut und Boden.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ludwig Ganghofer und wofür ist er bekannt?
Ludwig Ganghofer war ein Bestseller-Autor der Heimatliteratur, bekannt für seine Hochlandromane wie "Das Schweigen im Walde", die eine idyllische Bergwelt thematisieren.
Warum war die Heimatliteratur in der Weimarer Republik so populär?
Sie diente als Gegenpol zur modernen Großstadtliteratur und bot Menschen, die durch Modernisierung und Krieg desorientiert waren, Ordnung, Glück und Geborgenheit.
Was bedeutet "Selbstinszenierung" bei Ganghofer?
Ganghofer inszenierte sich so, als ob er seine Geschichten selbst lebte, was die Glaubwürdigkeit seiner Werke erhöhte und ihn zu einem der meistverfilmten Autoren machte.
Wie entwickelte sich die Heimatliteratur in Richtung Nationalsozialismus?
Die Idealisierung von "Blut und Boden" und die Ablehnung der "entarteten" Moderne in Teilen der Heimatkunstbewegung boten Anknüpfungspunkte für die nationalsozialistische Ideologie.
Was ist der Unterschied zwischen "Neuer Sachlichkeit" und Heimatdichtung?
Während die Neue Sachlichkeit die oft harte Realität der Gegenwart darstellte, bot die Heimatdichtung eine Flucht in eine zeitlose, idyllische Märchenwelt.
- Quote paper
- Jennifer Ruwe (Author), 2005, Heimat als gestalteter und inszenierter Raum - Ludwig Ganghofer und die Heimatdichtung der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61480