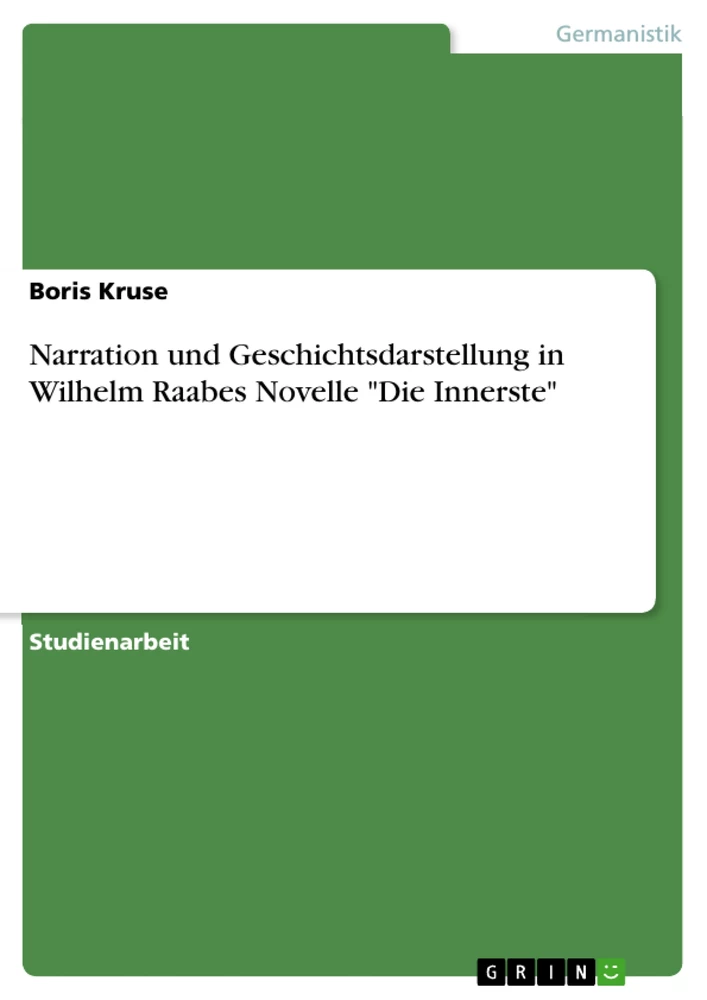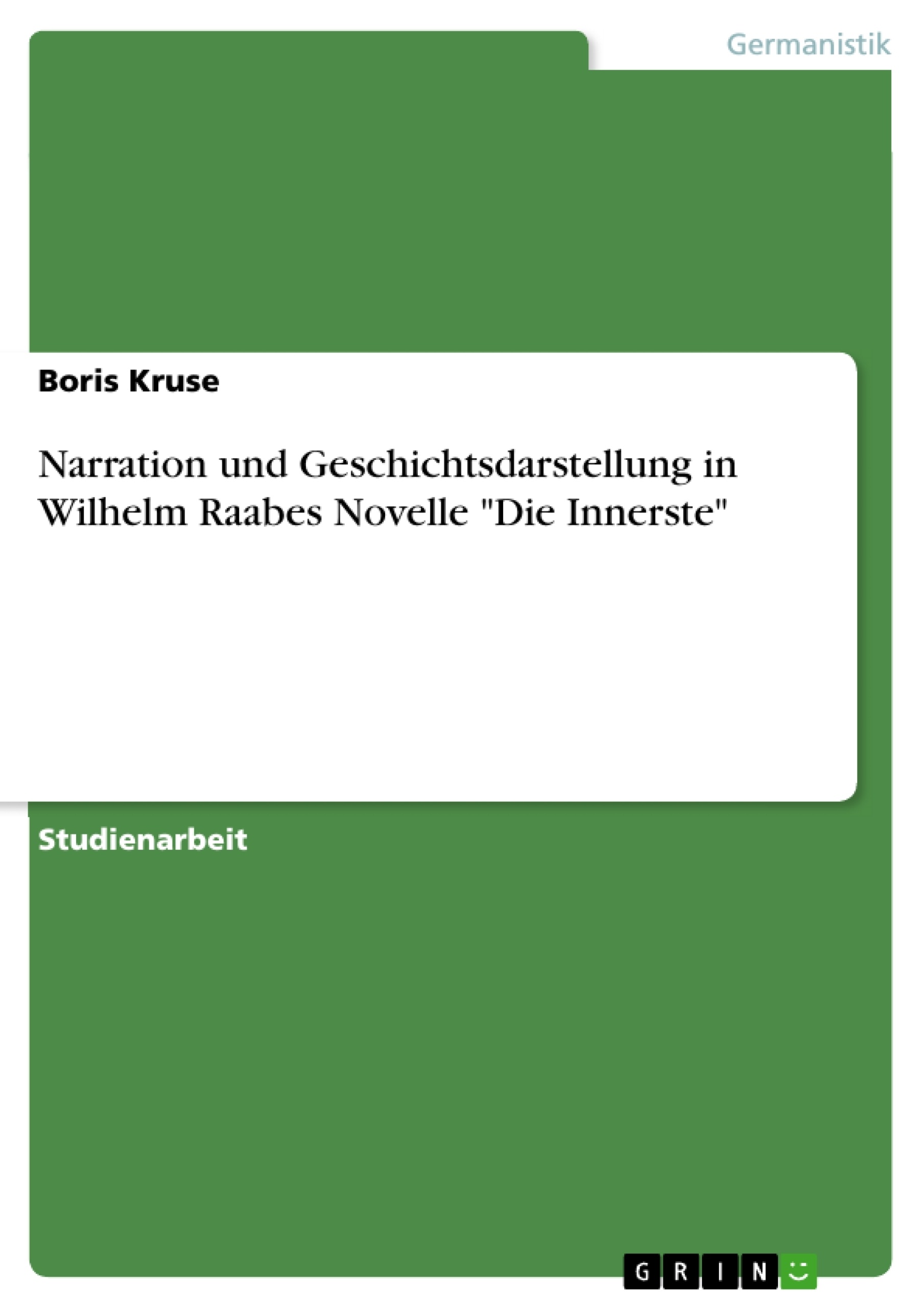Das literarische Werk Wilhelm Raabes wurde immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, kleinbürgerlich- philiströsen Vorstellungen verhaftet zu sein.
„Die Masse verfällt dem Chaotischen der Geschichte“, so bringt Fritz Martini die Weltsicht Raabes auf den Punkt, „Daneben stellt er [=Raabe] jedoch das Ethos und die Freiheit eines Menschentums, das, ebenso gejagt, gepeinigt, hilflos, gleichwohl eine innere Ordnung in sich selbst bewahrt und in seinem eigenen kleinen Umkreis wiederherstellt.“
Das mutet sicher ein bißchen nach harmlos- belehrender Unterhaltung an und legt nahe, daß es sich um einen Schriftsteller handelt, der in den moralischen und ästhetischen Wertekategorien seiner Zeit gefangen war.
Andererseits kann sich Raabes Erzählkunst mit ihren einfühlsamen Milieuschilderungen und reflektierenden Seitenhieben einer ungebrochen hohen Wertschätzung erfreuen. Zudem war dem Dichter daran gelegen, mit jeglichen Vorstellungen von einer vernünftigen, letztgültigen Sinnkonstruktion des Geschichtlichen abzurechnen. Sein Wirken hatte zum Ziel, die Wahrheit „der wirklichen, wahrhaftigen heißen Daseinsschlacht, in dem großen, furchtbaren, anfang- und endlosen Drama des Lebens“ darzustellen. Mehrfach wählte er dazu Themen aus der Zeitgeschichte.
Zur exemplarischen Untersuchung all dieser Vorurteile bietet sich die Novelle „Die Innerste“ aus dem Jahr 1874 an. Hier verarbeitet Raabe einen historischen Stoff- den 7jährigen Krieg als Hintergrund für eine Geschichte, in der unergründliche, übermächtige Gewalten in die Lebenswelt einfacher Leute einbrechen. In der besagten Novelle ist eine auffallende Verstrickung aus historischem Sujet und erzählerischem Gestus gegeben- dies zu beweisen, wird die Hauptaufgabe der vorliegenden Arbeit sein. Es soll ferner versucht werden, den vertretenen Anschauungen über die Entscheidungsmacht von menschlichen Subjekten in ihrer alltäglichen Lebenswelt wie im historischen Kontext nachzuspüren.
Dabei wird einer eingehenden Analyse der erzählerischen Mittel Raum gegeben. Es soll so textnah wie möglich verfahren werden, um insbesondere im Detail eigene Lesarten zu entwickeln. Dennoch wäre es kaum sinnvoll, die Resultate früherer Auseinandersetzungen mit dem Werk auszuklammern. Diese Arbeit verdankt insbesondere den Aufsätzen von Benno von Wiese und Uwe Vormweg wesentliche Impulse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Raabe und die Innerste
- Bedeutungsebenen zwischen Faktizität und Imagination
- Variationen des Volksaberglaubens
- Von Wassernixen und verborgenen Sehnsüchten
- Konstruierte Gegenbilder
- Vom Geschichtenerzählen zum Geschichtsbild
- Stilistische Aspekte
- Anklänge von Intertextualität
- Vom Geschichtenerzählen zum Geschichtsbild
- Schlußbetrachtung: Philiströse Unterhaltung, Gesellschaftskritik oder künstlerische Innovation?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Wilhelm Raabes Novelle „Die Innerste" und untersucht, wie er den historischen Stoff des Siebenjährigen Krieges in eine Geschichte übermächtiger Kräfte einbettet, die in das Leben einfacher Menschen eingreifen. Ziel ist es, die Verflechtung von historischem Sujet und erzählerischem Gestus in der Novelle aufzuzeigen sowie die verschiedenen Perspektiven auf die Entscheidungsmacht von Individuen in ihrer alltäglichen Lebenswelt und im historischen Kontext zu erforschen.
- Die Verknüpfung von Geschichte und Fiktion in der Novelle
- Die Darstellung von Machtstrukturen und deren Einfluss auf das Leben der Figuren
- Die Rolle des Volksaberglaubens und der Imagination im Kontext der historischen Ereignisse
- Der erzählerische Stil Raabes und seine Verwendung von Intertextualität
- Die Einordnung der Novelle in Raabes Gesamtwerk und die Frage nach ihrer Bedeutung für die Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Raabes Werk und dessen Rezeption im Kontext von „kleinbürgerlich-philiströsen" Vorwürfen vor. Sie führt die Novelle „Die Innerste" als exemplarischen Fall ein und verdeutlicht die zentrale Frage der Arbeit: die Verflechtung von historischem Stoff und Erzählweise.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Raabes Schaffen im Allgemeinen und der Entstehung der „Krähenfelder Geschichten" im Besonderen. Es wird auf die besondere Stellung der Novellen innerhalb Raabes Werks sowie auf dessen Stilentwicklung hingewiesen, die von zunehmender Kompliziertheit und Vielperspektivität geprägt ist. Außerdem werden die geografischen Bezüge der „Krähenfelder Geschichten" und die Bedeutung von Milieu für Raabes Werk beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die verschiedenen Bedeutungsebenen in „Die Innerste". Es werden die Rolle des Volksaberglaubens, die Verbindung von Wassernixen und Sehnsüchten sowie die Konstruktion von Gegenbildern im Kontext der Novelle analysiert.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Geschichtenerzählen in „Die Innerste". Dabei werden stilistische Aspekte, Anklänge von Intertextualität sowie die Frage nach dem Geschichtsbild in der Novelle behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse der Novelle „Die Innerste" von Wilhelm Raabe, wobei Themen wie historische Fiktion, Volksaberglaube, Intertextualität, Erzählkunst, Gesellschaftskritik und die Frage nach der Entscheidungsmacht von Individuen im historischen Kontext zentrale Bedeutung haben. Die Arbeit greift auf Erkenntnisse aus der Raabe-Forschung, insbesondere von Benno von Wiese und Uwe Vormweg, zurück.
Häufig gestellte Fragen
Welchen historischen Hintergrund nutzt Wilhelm Raabe in "Die Innerste"?
Raabe nutzt den Siebenjährigen Krieg als historischen Rahmen, in dem übermächtige Gewalten in das Leben einfacher Menschen einbrechen.
Wie verknüpft Raabe Geschichte mit Volksaberglauben?
In der Novelle verschmelzen historische Fakten mit Elementen des Volksaberglaubens, wie etwa Wassernixen, die verborgene Sehnsüchte der Figuren symbolisieren.
Was ist das zentrale Thema der Novelle "Die Innerste"?
Das Werk thematisiert die Daseinsschlacht des Lebens und die Frage, wie Individuen in einer chaotischen Geschichte eine innere Ordnung bewahren können.
Wird Raabe zu Recht als "philiströser" Schriftsteller bezeichnet?
Die Arbeit untersucht diesen Vorwurf kritisch und zeigt, dass Raabes Erzählkunst durch Vielperspektivität und Gesellschaftskritik weit über bloße Unterhaltung hinausgeht.
Welche Rolle spielt das Milieu in Raabes Erzählweise?
Raabe nutzt einfühlsame Milieuschilderungen und geografische Bezüge, um die soziale Realität und die psychologische Tiefe seiner Charaktere greifbar zu machen.
- Quote paper
- Boris Kruse (Author), 2002, Narration und Geschichtsdarstellung in Wilhelm Raabes Novelle "Die Innerste", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61654