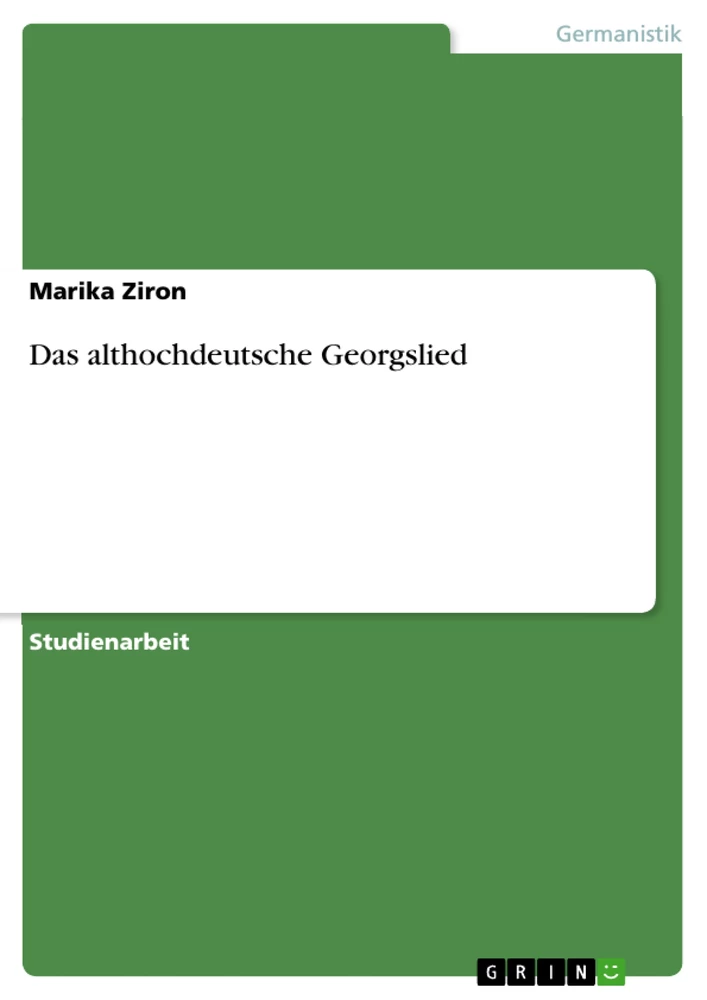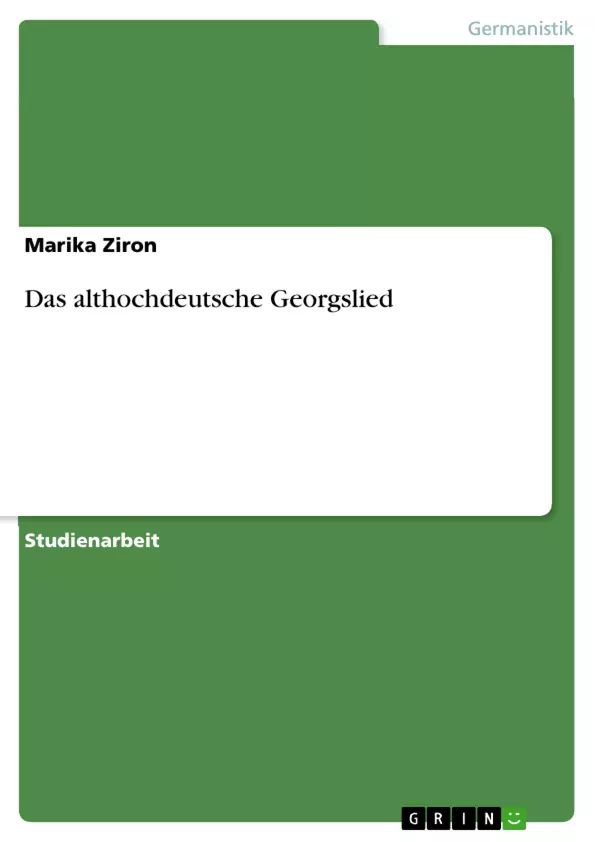Die Wissenschaft beschäftigte und beschäftigt sich noch heute sehr intensiv mit diesem Lied der Heiligenverehrung. Schon die Rekonstruktion der Textform ist äußerst schwierig und teilweise nicht mehr realisierbar, da Teile des Textes so schwer geschädigt sind, dass eine sichere Entzifferung nicht mehr möglich ist. Haubrichs spricht in seinen Ausführungen „über einen der schwierigsten, am schlechtesten überlieferten, durch äußere Einwirkungen ebenso wie durch Unverständnis des Kopisten nachhaltig zerstörten und zudem Fragment gebliebenen Text(e) der althochdeutschen Zeit, ja des gesamten Mittelalters […]“ Bei vielen anderen Texten würden wir uns eine weniger zahlreiche Überlieferung wünschen, um Einheitlichkeit herstellen zu können. Anders beim Georgslied. Hier wäre der Variantenreichtum für die Wissenschaft sehr hilfreich. Leider ist dies aber nicht der Fall und so muss die Untersuchung ausgehend von der einzigen Textgrundlage erfolgen, was zahlreiche Schwierigkeiten mit sich bringt. Einige dieser möchte ich auf den folgenden Seiten näher erläutern. Dabei beginne ich mit der Analyse des Sachgegenstandes, indem ich einige Informationen zur Person des heiligen Georgs und der Geschichte seiner Verehrung anführe. Im Folgenden möchte ich mich dem Thema der Überlieferung zuwenden und in diesem Zusammenhang auch die, für die Erforschung des Textes, überaus wertvolle Fassung Rostgards kurz ansprechen. Im Anschluss daran wende ich mich dem Lied an sich zu. Zu Beginn werde ich einige kurze Aussagen zu Gestalt und Aufbau des Textes geben und versuchen darzustellen, welche Hinweise uns diese z.B. in Bezug auf die Adressaten geben. Nachdem ich am Beginn meiner Arbeit auf die Georgsverehrung an sich eingegangen bin, versuche ich an späterer Stelle, den Inhalt des Heiligenliedes kurz und überblickhaft zusammenzufassen und eine Gliederung des Textes aufzuzeigen. Eines der größten Probleme, über das in der Wissenschaft auch heute noch keine einheitliche Position erreicht wurde, besteht in der Bestimmung der Entstehungszeit und des Entstehungsortes des Georgsliedes. Auch diesen Punkt möchte ich ausführlich erläutern und einige der verschiedenen Positionen und deren Begründung gegenüberstellen. Zentral bei der Beantwortung dieser Frage ist die Sprache des Georgsliedes und die Vielzahl der verwendeten sprachlichen Mittel. In einem längeren Schlussteil möchte ich mich folglich auch der Betrachtung dieser zuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Allgemeines
- Der heilige Georg und seine Verehrung
- Das Georgslied
- Überlieferung
- Allgemeines
- Rostgaards Fassung
- Aufbau und Form
- Inhalt
- Gliederung
- Entstehungsort und Zeit
- Sprache
- Vokalismus
- Konsonantismus
- Wörter und Wortverbindungen
- Überlieferung
- Allgemeines
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem althochdeutschen Georgslied, einem wichtigen Text der Heiligenverehrung, der in einer Handschrift des Dichters Otfrid von Weißenburg überliefert ist. Das Georgslied ist aufgrund seiner schwierigen Textüberlieferung und seiner Fragmentarität ein komplexes Forschungsfeld. Ziel dieser Arbeit ist es, die Herausforderungen der Textrekonstruktion zu beleuchten und das Georgslied in seinen historischen, sprachlichen und literarischen Kontext zu setzen.
- Die Überlieferung des Georgsliedes und die Schwierigkeiten der Textrekonstruktion
- Die historische Person des Heiligen Georg und seine Verehrung im Mittelalter
- Der Aufbau, die Form und der Inhalt des Georgsliedes
- Die Sprache des Georgsliedes und ihre Besonderheiten
- Die Frage nach dem Entstehungszeitpunkt und dem Entstehungsort des Georgsliedes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des althochdeutschen Georgsliedes ein und beschreibt die Herausforderungen der Textrekonstruktion aufgrund der schlechten Überlieferung und der fragmentarischen Natur des Textes. Der Hauptteil widmet sich zunächst dem heiligen Georg und seiner Verehrung im Mittelalter. Anschließend wird das Georgslied selbst analysiert, wobei die Überlieferung, der Aufbau, der Inhalt, die Gliederung, der Entstehungszeitpunkt und die Sprache des Textes im Fokus stehen. Die Sprache wird dabei im Detail betrachtet, einschließlich des Vokalismus, des Konsonantismus und der Wörter und Wortverbindungen. Die Arbeit endet mit einem Schlusskapitel, das die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Althochdeutsch, Georgslied, Heiligenverehrung, Überlieferung, Textrekonstruktion, Fragment, Sprache, Vokalismus, Konsonantismus, Entstehungszeit, Entstehungsort, Otfrid von Weißenburg, Rostgaards Fassung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das althochdeutsche Georgslied?
Es ist eines der ältesten deutschen Heiligenlieder und besingt das Leben und das Martyrium des heiligen Georg. Es ist in einer Handschrift aus dem 9. Jahrhundert überliefert.
Warum ist die Textrekonstruktion so schwierig?
Der Text ist nur fragmentarisch erhalten und durch äußere Einwirkungen sowie Fehler des damaligen Kopisten stark beschädigt, was eine sichere Entzifferung an vielen Stellen unmöglich macht.
Welche Bedeutung hat die Fassung von Rostgard?
Die Abschrift von Frederik Rostgard aus dem 17. Jahrhundert ist für die Forschung wertvoll, da sie den Text in einem Zustand zeigt, bevor weitere Teile des Originals verloren gingen oder unleserlich wurden.
Wo und wann ist das Georgslied entstanden?
Die genaue Herkunft ist umstritten. Die Forschung diskutiert Orte wie das Kloster Reichenau oder Fulda und datiert die Entstehung meist in das späte 9. Jahrhundert.
Welche sprachlichen Besonderheiten weist das Lied auf?
Das Lied zeigt eine Mischung aus verschiedenen Dialektmerkmalen und eine Vielzahl archaischer Wörter und Wortverbindungen, die typisch für die althochdeutsche Dichtung sind.
- Citar trabajo
- Marika Ziron (Autor), 2006, Das althochdeutsche Georgslied, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61891