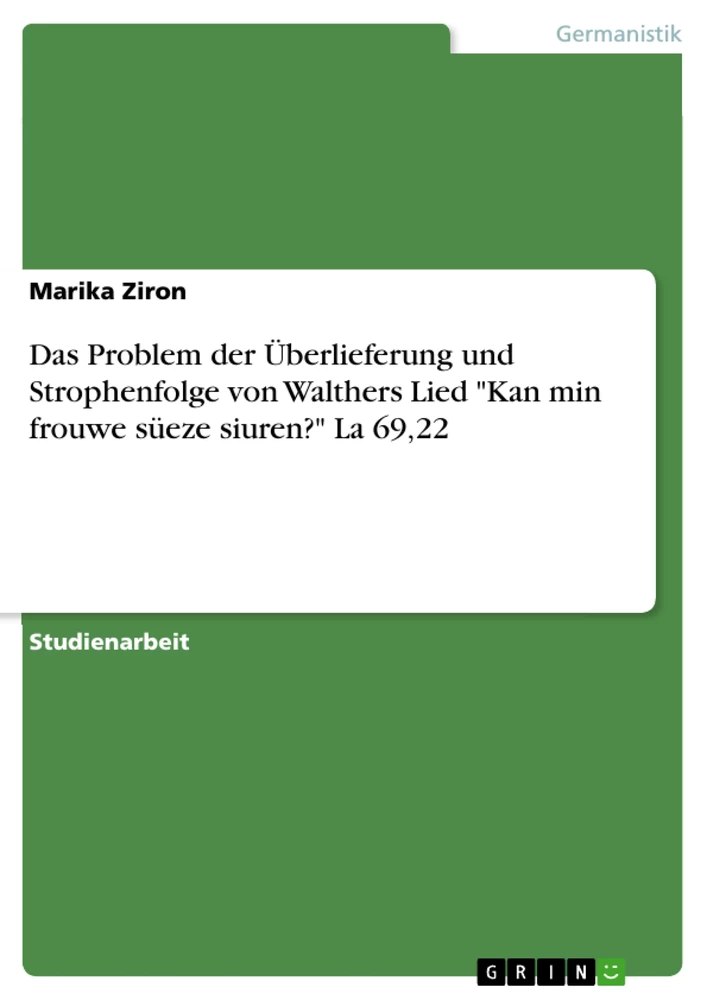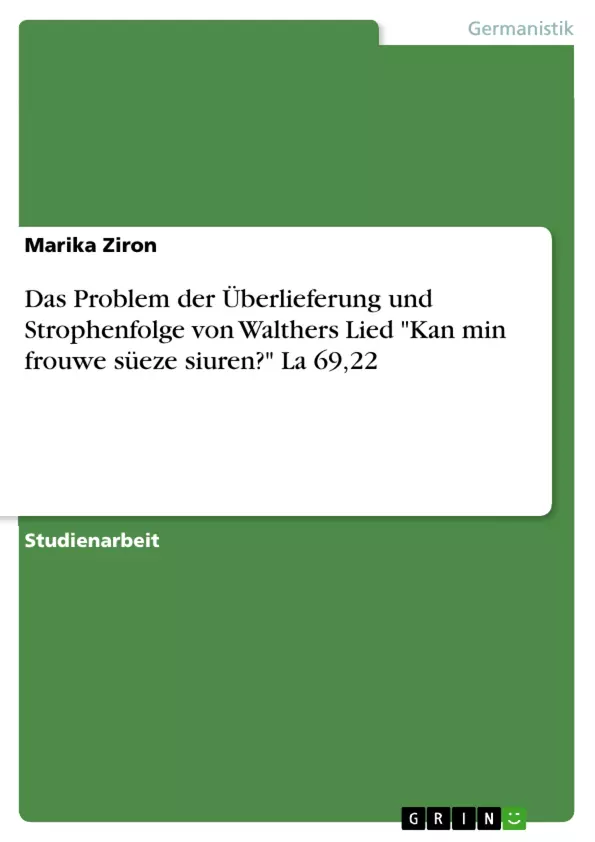Walthers Lied La 69,22 Kan min frouwe süeze siuren? gehört zu den bekanntesten seiner Minnelieder, „nicht zuletzt weil die Forschung es als programmatisch für Walthers Minne-Konzeption begreift.“ Mit seiner 6fachen Überlieferung ist es außerdem eines der am besten bezeugten Lieder Walthers von der Vogelweide. Doch gerade durch diese zahlreiche Überlieferung ergeben sich auch Probleme, die seit langem in der Forschung diskutiert werden. Liedstrophen bilden zumeist für sich geschlossene Einheiten, die in sich kohärent sind. „Wie sich solche Einzelstrophen nun zur höheren Einheit des Liedes verbinden, wird gerade bei mittelalterlicher Lyrik immer wieder zur interpretatorischen Schlüsselfrage.“ Aus den zahlreichen Überlieferungsvarietäten der Lieder wurde auf verschiedene Aufführungsvarianten aufgrund verschiedener Situationen geschlossen. Heute versucht man die unterschiedlichen Fassungen zu interpretieren, nicht mehr mit dem Hauptziel eine ursprüngliche Anordnung zu ermitteln, sondern um den Sinn der verschiedenen Überlieferungen aufzuzeigen. Auch ich möchte in dieser Arbeit versuchen die Handschriften, in denen das Lied La 69,22 überliefert ist und deren Strophenfolge zu untersuchen. Ziel soll es sein unterschiedliche Sinngebungen, Wirkungen und Ziele des Sängers, die durch die Strophenanordnung entstehen, genauer darzulegen. Beginnen werde ich mit einer kurzen Erläuterung der allgemeinen Überlieferung mittelalterlicher Lyrik und im Speziellen der Lyrik Walther von der Vogelweide. Im Anschluss daran wende ich mich den Überlieferungsträgern des hier zu besprechenden Liedes zu. Nur kurz und überblickhaft gehe ich auf die Metrik und Form des Liedes ein. Im Hauptteil der Arbeit möchte ich versuchen ausgehend von der in der Großen Heidelberger Handschrift überlieferten Fassung C das Lied und insbesondere die Stellung der Strophen zu interpretieren und mit den Fassungen A, E, F und O zu vergleichen. Dabei geht es mir, wie schon angedeutet nicht darum festzustellen, welche Fassung die „bessere“ ist, sondern um die individuelle Sinngebung, welche durch die Strophenanordnung entsteht. Ich hoffe, es gelingt mir aufzuzeigen, dass keine der Fassungen mit Sicherheit zu widerlegen ist und diese immer auch auf den persönlichen Hintergrund des Sängers und die höfische Umgebung zu beziehen sind. In diesen Kontext eingebunden liefern sie weitreichende Erkenntnisse über das Leben eines Minnesängers, seine Möglichkeiten und Grenzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Überlieferung
- 2.1.1 Allgemeines
- 2.1.2 Kan min frouwe süeze siuren? (La 69,22)
- 2.1.3 A - Die kleine Heidelberger Liederhandschrift
- 2.1.4 C Die Große Heidelberger Liederhandschrift
- 2.1.5 E - Würzburger Liederhandschrift
- 2.1.6 F – Weimarer Liederhandschrift
- 2.1.7 O Pergament Handschrift
- 2.1.8 s Haager Liederhandschrift
- 2.2 Metrik und Form
- 2.2.1 Allgemeines
- 2.2.2 Kan min frouwe süeze siuren (La 69,22)
- 2.3 Interpretation der Fassungen
- 2.3.1 Die Strophenfolge der Fassung C
- 2.3.2 Die Strophenfolge der Fassung A
- 2.3.3 Die Strophenfolge der Fassungen EFO
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Lied „Kan min frouwe süeze siuren?“ (La 69,22) von Walther von der Vogelweide, welches zu seinen bekanntesten Minneliedern gehört. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Überlieferungsformen und ihrer Auswirkungen auf die Interpretation des Liedes. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Sinngebungen, Wirkungen und Ziele des Sängers, die durch die Strophenanordnung entstehen, darzulegen.
- Untersuchung der Überlieferung von Walthers Lied „Kan min frouwe süeze siuren?“
- Analyse der verschiedenen Handschriften und deren Strophenfolge
- Interpretation der Strophenanordnungen und ihrer Auswirkungen auf die Bedeutung des Liedes
- Vergleich der verschiedenen Fassungen und ihrer individuellen Sinngebungen
- Einbettung der Interpretationsmöglichkeiten in den historischen Kontext der höfischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Lied „Kan min frouwe süeze siuren?“ in den Kontext der Forschung und der Minnelyrik Walthers von der Vogelweide. Sie beschreibt die Bedeutung des Liedes und die Herausforderungen, die sich aus der Vielfältigkeit der Überlieferungsformen ergeben.
2. Hauptteil
2.1 Überlieferung
Dieser Abschnitt behandelt die allgemeine Überlieferung mittelalterlicher Lyrik und beleuchtet die Besonderheiten der Überlieferung von Walthers Lied. Er stellt die verschiedenen Handschriften (A, C, E, F, O, s) vor, in denen das Lied überliefert ist, und analysiert die jeweiligen Strophenfolgen.
2.2 Metrik und Form
Dieser Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über die Metrik und Form des Liedes.
2.3 Interpretation der Fassungen
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Fassungen des Liedes in ihrer Strophenfolge interpretiert. Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, eine „bessere“ Fassung zu ermitteln, sondern um die individuellen Sinngebungen, die durch die jeweilige Strophenanordnung entstehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Walther von der Vogelweide, Minnelyrik, „Kan min frouwe süeze siuren?“, Überlieferung, Strophenfolge, Handschriften, Interpretation, Sinngebung, höfische Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walthers Lied „Kan min frouwe süeze siuren?“
Das Lied (La 69,22) ist ein bedeutendes Minnelied von Walther von der Vogelweide, das als programmatisch für seine Konzeption der Minne angesehen wird.
Warum ist die Überlieferung dieses Liedes problematisch?
Das Lied ist in sechs verschiedenen Handschriften überliefert, die jeweils unterschiedliche Strophenfolgen aufweisen, was die Interpretation der ursprünglichen Absicht erschwert.
Welche Handschriften enthalten das Lied La 69,22?
Zu den wichtigsten Überlieferungsträgern gehören die Kleine Heidelberger Liederhandschrift (A), die Große Heidelberger Liederhandschrift (C) sowie die Würzburger (E) und Weimarer (F) Handschriften.
Wie beeinflusst die Strophenfolge die Bedeutung des Liedes?
Unterschiedliche Anordnungen können verschiedene Sinngebungen und Wirkungen erzeugen, die oft auf den persönlichen Hintergrund des Sängers oder das höfische Umfeld abgestimmt waren.
Was ist das Ziel der modernen Forschung zu diesen Fassungen?
Heute versucht man nicht mehr zwingend eine „Ur-Fassung“ zu finden, sondern die individuellen Aussagen und Funktionen der verschiedenen überlieferten Varianten zu verstehen.
- Citar trabajo
- Marika Ziron (Autor), 2006, Das Problem der Überlieferung und Strophenfolge von Walthers Lied "Kan min frouwe süeze siuren?" La 69,22, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61892