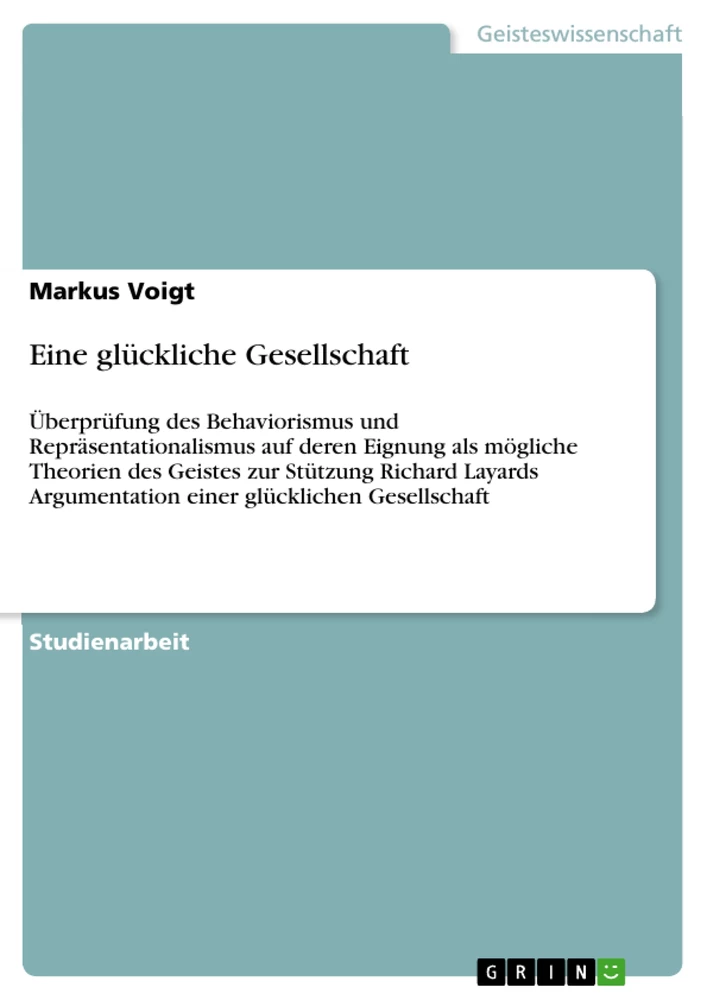Richard Layard arbeitet in seinem Buch Die glückliche Gesellschaft damit, die Menschen nach ihrem Glücksempfinden zu befragen. Zur Absicherung seiner Ergebnisse stützt sich Layard auf Umfragen, bei denen die Aussagen der Befragten mit der Beurteilung von Freunden und Bekannten der Probanden zum gleichen Sachverhalt verglichen wurden. 1 Wenn Layard die Selbsteinschätzung der Menschen über ihre eigenen Glücksgefühle sowie die Einschätzung von Menschen über den aktuellen Glückszustand der anderen heranzieht, muss er davon ausgehen, dass diese Befragten einen wie auch immer gearteten und einigermaßen zuverlässigen Zugang zur Gefühlswelt, sowohl der eigenen als auch zu der ihrer Mitmenschen, haben. Um zu erklären, ob und wie zuverlässig die Kenntnis der Menschen über ihr mentales Leben ist, wurden von Philosophen verschiedene Theorien des Geistes erdacht. Aus Sicht dieser Theoretiker erklären diese Theorien was wir über uns und andere wissen und wie zuverlässig dieses Wissen ist. Er sollte aus Sicht der Geisttheoretiker also eine der geläufigen Theorien akzeptieren, um die Grundlage dafür angeben zu können, warum er die Aussagen für zuverlässig und damit wahr hält. In den folgenden Abschnitten möchte ich versuchen zu klären, welche Anforderungen Layard implizit an eine Theorie des Geistes stellt, und später zwei in Frage kommende Modelle vorstellen und überprüfen, ob und in wie weit diese für seine Zwecke funktional sind.
Layard macht in seiner Argumentation implizit deutlich, welche Anforderungen er an eine Theorie des Geistes stellt. Zunächst möchte ich klären, wie diese Anforderungen beschaffen sind. Im nächsten Schritt werde ich versuchen zu zeigen, inwiefern die von mir gewählten Theorien des Geistes seinen Forderungen gerecht werden. Im Bezug auf die Verlässlichkeit des Wissens über die eigenen Gefühle nimmt Layard Irrtumsfreiheit an: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Layards Argumentation in Die glückliche Gesellschaft
- Definition der Eigenschaften der von Layard benötigten Theorie des Geistes
- Humes Skeptizismus und die Messergebnisse der Hirnforscher
- Descartes
- Eine Theorie des Geistes nach Gilbert Ryle
- Wissen über eigene und fremde mentale Vorgänge
- Zuverlässigkeit des Selbstwissens und Konsequenzen für Layards These
- Der Repräsentationalismus nach Dretske
- Verwendbarkeit von Wissen und Irrtumsresistenz
- Funktionsweise des Repräsentationalismus – Ein Beispiel
- Verlässlichkeit von Wissen beim Repräsentationalismus
- Überlegungen zur Übertragung des Kalibrierungsprozesses auf den Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Eignung von Behaviorismus und Repräsentationalismus als Theorien des Geistes, um die von Richard Layard in seinem Buch "Die glückliche Gesellschaft" vertretene Argumentation für eine glückliche Gesellschaft zu untermauern. Layard plädiert für eine Politik, die das Glück der Menschen maximiert, und stützt seine Argumente auf Befragungen und Messergebnisse, die das subjektive Glücksempfinden der Menschen erfassen. Der Fokus liegt darauf, zu klären, ob die von Layard benötigten Theorien des Geistes die Voraussetzungen für verlässliches Wissen über die eigene und die fremde Gefühlswelt erfüllen.
- Analyse der Anforderungen an eine Theorie des Geistes, die Layards Argumentation stützen könnte
- Bewertung des Behaviorismus und des Repräsentationalismus in Bezug auf ihre Fähigkeit, Layards Anforderungen zu erfüllen
- Untersuchung der Zuverlässigkeit von Selbst- und Fremdwissen in Bezug auf mentale Zustände
- Betrachtung der Rolle des Repräsentationalismus bei der Erklärung der Beziehung zwischen mentalen Zuständen und neuronalen Prozessen
- Diskussion der Implikationen der gewählten Theorien für die Messung und Steigerung des menschlichen Glücks
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1.1: Layards Argumentation in Die glückliche Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Argumentation von Richard Layard in seinem Buch "Die glückliche Gesellschaft". Layard argumentiert, dass das menschliche Glück messbar sei und dass politische Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Glück der Menschen zu maximieren. Er stützt sich auf Umfragen, bei denen die Aussagen der Befragten mit der Beurteilung ihrer Freunde und Bekannten verglichen werden.
- Kapitel 1.2: Definition der Eigenschaften der von Layard benötigten Theorie des Geistes: In diesem Kapitel werden die Anforderungen an eine Theorie des Geistes definiert, die Layards Argumentation stützen könnte. Layard setzt voraus, dass Menschen verlässliches Wissen über ihre eigenen Gefühle und die Gefühle ihrer Mitmenschen haben. Diese Annahme erfordert eine Theorie des Geistes, die dieses Wissen erklären kann.
- Kapitel 2: Humes Skeptizismus und die Messergebnisse der Hirnforscher: Dieses Kapitel beleuchtet den Skeptizismus von David Hume und diskutiert, wie die Messergebnisse der Hirnforscher das Wissen über das eigene und das fremde Gefühlsleben beeinflussen können.
- Kapitel 3: Descartes: In diesem Kapitel wird die Theorie des Geistes von René Descartes behandelt und deren Einfluss auf die Frage nach dem verlässlichen Wissen über die Gefühlswelt diskutiert.
- Kapitel 4: Eine Theorie des Geistes nach Gilbert Ryle: Dieses Kapitel stellt die Theorie des Geistes von Gilbert Ryle vor und diskutiert deren Implikationen für das Wissen über eigene und fremde mentale Vorgänge.
- Kapitel 4.1: Wissen über eigene und fremde mentale Vorgänge: Dieses Kapitel beleuchtet die Theorie des Geistes von Gilbert Ryle im Detail und diskutiert, wie diese Theorie das Wissen über eigene und fremde mentale Vorgänge erklärt.
- Kapitel 4.2: Zuverlässigkeit des Selbstwissens und Konsequenzen für Layards These: Dieses Kapitel setzt sich mit der Zuverlässigkeit des Selbstwissens auseinander und diskutiert, welche Konsequenzen diese für Layards Argumentation hat.
- Kapitel 5: Der Repräsentationalismus nach Dretske: Dieses Kapitel stellt die Theorie des Repräsentationalismus nach Fred Dretske vor und untersucht deren Eignung als Grundlage für ein verlässliches Wissen über die eigene und die fremde Gefühlswelt.
- Kapitel 5.1: Verwendbarkeit von Wissen und Irrtumsresistenz: Dieses Kapitel untersucht, wie der Repräsentationalismus das Wissen über die Welt und die eigene Gefühlswelt erklärt und welche Voraussetzungen für Irrtumsresistenz erfüllt sein müssen.
- Kapitel 5.2: Funktionsweise des Repräsentationalismus – Ein Beispiel: In diesem Kapitel wird anhand eines Beispiels die Funktionsweise des Repräsentationalismus erläutert und gezeigt, wie diese Theorie die Beziehung zwischen mentalen Zuständen und der Außenwelt erklärt.
- Kapitel 5.3: Verlässlichkeit von Wissen beim Repräsentationalismus: Dieses Kapitel diskutiert die Zuverlässigkeit von Wissen, das auf dem Repräsentationalismus basiert, und untersucht die Faktoren, die die Genauigkeit dieses Wissens beeinflussen.
- Kapitel 5.4: Überlegungen zur Übertragung des Kalibrierungsprozesses auf den Menschen: Dieses Kapitel untersucht, ob der Kalibrierungsprozess, der im Repräsentationalismus eine Rolle spielt, auf den Menschen übertragen werden kann, um das Wissen über die eigene und die fremde Gefühlswelt zu erklären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Theorien des Geistes, insbesondere dem Behaviorismus und dem Repräsentationalismus, im Kontext der Messung und Steigerung des menschlichen Glücks. Zentrale Themen sind die Zuverlässigkeit von Selbst- und Fremdwissen, die Beziehung zwischen mentalen Zuständen und neuronalen Prozessen, sowie die Implikationen dieser Theorien für die Argumentation von Richard Layard in seinem Buch "Die glückliche Gesellschaft".
Häufig gestellte Fragen
Welche Hauptthese vertritt Richard Layard in seinem Buch?
Layard argumentiert, dass das Ziel der Politik die Maximierung des menschlichen Glücks sein sollte und dass dieses Glück durch Befragungen und wissenschaftliche Methoden messbar ist.
Was ist die Kritik am Behaviorismus im Kontext von Glück?
Die Arbeit untersucht nach Gilbert Ryle, ob rein beobachtbares Verhalten ausreicht, um verlässliche Aussagen über das innere Glücksempfinden eines Menschen zu treffen.
Was besagt der Repräsentationalismus nach Dretske?
Dieser Ansatz untersucht, wie mentale Zustände Informationen über die Außenwelt repräsentieren und inwieweit dieses Wissen vor Irrtümern geschützt ist.
Sind Selbstauskünfte über das eigene Glück zuverlässig?
Layard setzt voraus, dass Menschen einen privilegierten Zugang zu ihrer Gefühlswelt haben. Die Arbeit prüft diese Annahme anhand verschiedener philosophischer Theorien des Geistes.
Welche Rolle spielen Hirnforscher in Layards Argumentation?
Layard nutzt Messergebnisse der Hirnforschung, um subjektive Glücksgefühle objektiv zu untermauern und die Verlässlichkeit der Befragungsdaten zu stützen.
- Quote paper
- Markus Voigt (Author), 2006, Eine glückliche Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62087