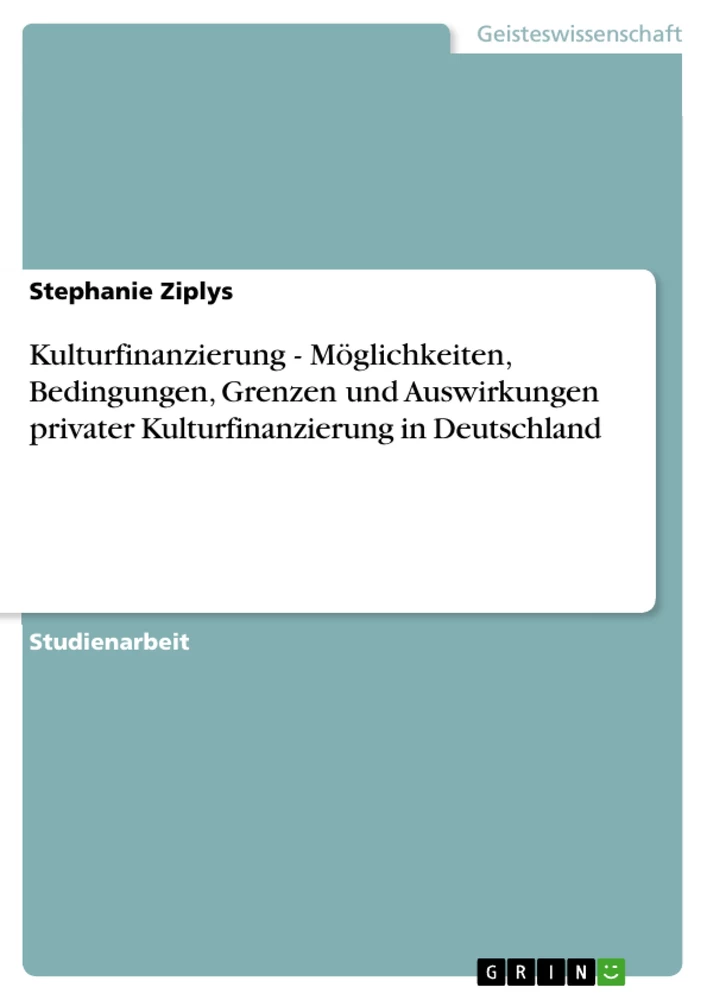Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die öffentliche Hand in Deutschland nicht mehr wie bisher in der Lage ist, das öffentliche und gemeinnützige Kulturangebot zu finanzieren. Eine Entwicklung in Richtung stärkerer privatwirtschaftlicher Finanzierung zeichnet sich bereits seit den 80er-Jahren ab. Es ist zu erwarten, dass der Finanzierungsdruck kultureller Einrichtungen durch die Streichung öffentlicher Gelder noch zunehmen wird, und somit stellt sich die Frage nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten des öffentlichen Kulturbetriebs, die die Kürzungen der staatlichen Kulturausgaben auffangen können und dabei die Werte und Traditionen, die der Kulturpolitik und -förderung in Deutschland zugrunde liegen, sowie die Strukturen, auf denen diese aufbauen, berücksichtigen.
Die Erarbeitung neuer Konzepte der Kulturfinanzierung kann nicht geschehen ohne einen Blick auf das Verständnis von Kultur und Kulturbetrieb als Empfänger finanzieller Leistungen und auf kulturpolitische Ziele und Instrumente, die der öffentlichen Kulturfinanzierung in Deutschland zugrunde liegen. Dass eine solche Betrachtung von Rahmenbedingungen der Kulturproduktion nötig ist, um die verschiedenen Möglichkeiten der Kulturfinanzierung in ihrer Anwendbarkeit auf das System der Kulturproduktion bewerten zu können, wird sich bei der Gegenüberstellung des Kulturbetriebs von Deutschland und der USA zeigen, aus der deutlich wird, dass eine direkte Übertragung kulturpolitischer Modelle anderer Länder nicht möglich ist, wenn diese auf anderen Grundannahmen über die Aufgaben von Kultur sowie der Rolle des Staates im Bezug auf diese beruhen. Trotzdem lassen sich hier und auch in anderen Ländern Ansatzpunkte für eine Umgestaltung bzw. Weiterentwicklung des Finanzierungssystems der Kultur in Deutschland finden, und so ist es sinnvoll, kritisch zu betrachten, in welcher Art und Weise eine Einbindung importierter „kultureller Praktiken“ so möglich ist, dass sie dem deutschen System gerecht wird.
Nach einer Erläuterung der Kulturfinanzierungssysteme in Deutschland und den USA werden die verschiedenen Möglichkeiten privater Finanzierung aufgezeigt, eingeteilt in Gruppen, die nach der Quelle der Finanzierung unterscheiden, und diese gleichzeitig bewertet. Abschließend erfolgt die Darstellung einiger Bedingungen, deren Realisation für eine stärkere Nutzung privater Finanzierungsformen nötig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- System der Kulturfinanzierung in Deutschland
- Kulturbegriff und Kulturbetrieb in Deutschland
- System der öffentlichen Kulturfinanzierung in Deutschland
- Staatskunst und Bürokratisierung
- System der Kulturfinanzierung in den USA
- Möglichkeiten zukünftiger Kulturfinanzierung in Deutschland
- Erlöse aus dem Kulturbetrieb
- Einnahmen aus betriebsnahen Strukturen
- Drittmittel von privater Seite
- Kreditaufnahme
- Drittmittel aus öffentlicher Hand
- Matching Funds und Public-Private-Partnerships
- Sachspenden und ehrenamtliche Mitarbeit
- Differenzierte Kulturfinanzierung
- Private Kulturfinanzierung, Rechtsformen und Steuerrecht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die aktuelle Situation der Kulturfinanzierung in Deutschland und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen einer verstärkten privaten Kulturfinanzierung. Dabei werden die Herausforderungen durch die sich wandelnden Finanzierungsbedingungen, das deutsche Kulturverständnis und die Rolle des Staates in der Kulturpolitik beleuchtet.
- Entwicklungen der Kulturfinanzierung in Deutschland und die Herausforderungen durch den Rückgang öffentlicher Gelder
- Das deutsche Kulturverständnis und seine Auswirkungen auf die Kulturfinanzierung
- Möglichkeiten und Grenzen privater Kulturfinanzierung in Deutschland
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Steuerrecht im Kontext der privaten Kulturfinanzierung
- Der Einfluss des US-amerikanischen Kulturmodells auf die deutsche Kulturfinanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Problematik der öffentlichen Kulturfinanzierung in Deutschland und die Notwendigkeit alternativer Finanzierungsmodelle. Kapitel 2 beschreibt das deutsche Kulturfinanzierungssystem und den weitreichenden Kulturbegriff, der die Förderung verschiedener Kulturbereiche umfasst. Kapitel 3 stellt das System der Kulturfinanzierung in den USA im Vergleich dar und analysiert die Unterschiede im Kulturverständnis und der Rolle des Staates. Kapitel 4 untersucht verschiedene Möglichkeiten zukünftiger Kulturfinanzierung in Deutschland, wobei die Kapitel 4.1 bis 4.7 detailliert auf die einzelnen Finanzierungsquellen eingehen. Kapitel 5 betrachtet die Notwendigkeit einer differenzierten Kulturfinanzierung. Kapitel 6 behandelt die Rechtsformen und steuerrechtlichen Aspekte der privaten Kulturfinanzierung. Das Fazit fasst die zentralen Punkte der Arbeit zusammen und bewertet die Chancen und Risiken der privaten Kulturfinanzierung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Kulturfinanzierung, Kulturpolitik, Kulturbetrieb, Deutschland, USA, öffentliche Finanzierung, private Finanzierung, Drittmittel, Sponsoring, Matching Funds, Public-Private-Partnerships, Kulturbegriff, Kulturverständnis, Rechtsformen, Steuerrecht
Häufig gestellte Fragen
Warum reicht die öffentliche Kulturfinanzierung in Deutschland nicht mehr aus?
Durch knappe öffentliche Haushalte und steigenden Finanzierungsdruck ist der Staat zunehmend auf private Unterstützung angewiesen.
Welche Möglichkeiten der privaten Kulturfinanzierung gibt es?
Dazu zählen Sponsoring, Spenden, Matching Funds, Public-Private-Partnerships sowie ehrenamtliche Mitarbeit.
Was unterscheidet das deutsche vom US-amerikanischen Kulturmodell?
In Deutschland ist Kultur weitgehend eine öffentliche Aufgabe (Staatskunst), während sie in den USA primär privat finanziert wird.
Was sind Matching Funds?
Ein Modell, bei dem die öffentliche Hand einen Betrag in gleicher Höhe dazugibt, den eine Kultureinrichtung privat eingeworben hat.
Welche rechtlichen Hürden gibt es bei privater Förderung?
Rechtsformen und das Steuerrecht spielen eine zentrale Rolle, da sie über die Abzugsfähigkeit von Spenden und die Attraktivität für Sponsoren entscheiden.
- Quote paper
- Stephanie Ziplys (Author), 2004, Kulturfinanzierung - Möglichkeiten, Bedingungen, Grenzen und Auswirkungen privater Kulturfinanzierung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62123