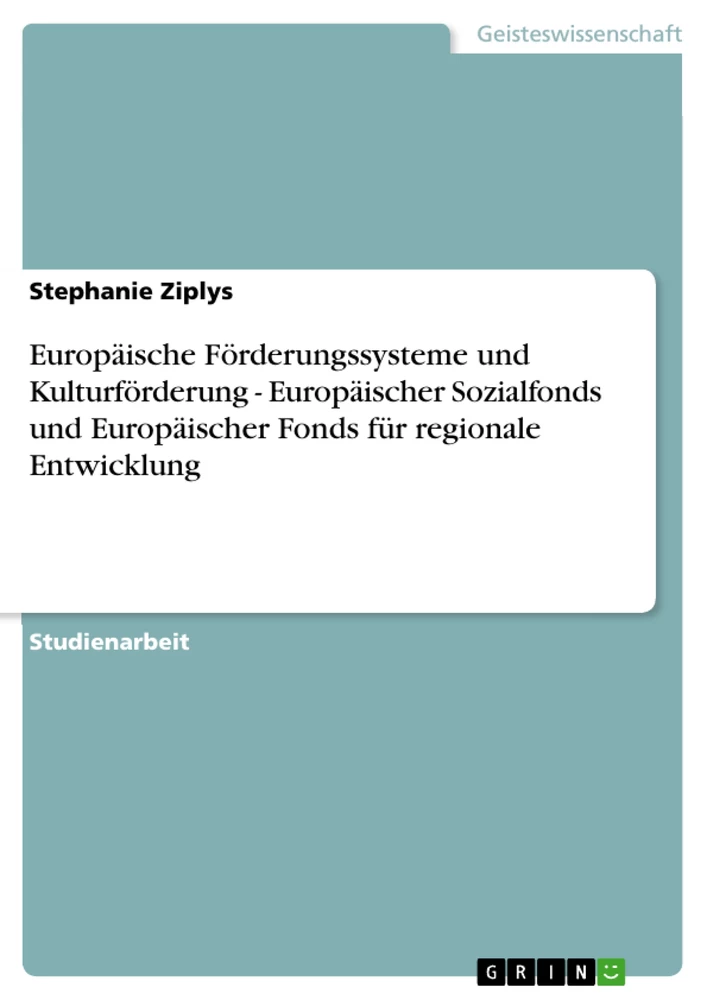Die Europäische Union als Staatenverbund von mittlerweile 25 Mitgliedsstaaten entstand aus dem Willen heraus, die europäischen Volkwirtschaften zu vereinigen und durch Verringerung der wirtschaftlichen Entwicklungsunterschiede die harmonische Entwicklung zu fördern. Zur Umsetzung dieser Ziele schafft sie im Laufe ihrer Geschichte verschiedene Förderinstrumente, von denen der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung eine zentrale Rolle einnehmen. Sie dienen der Umverteilung der Beiträge der Mitgliedsstaaten zugunsten benachteiligter Regionen. Von den Fördermitteln können Unternehmen, Kultureinrichtungen, Non Profit-Organisationen und Beschäftigungsinitiativen in Förderregionen, die zu den Programmzielen einen Beitrag leisten, profitieren. Neben nationalen Fördergeldern und der Unterstützung durch Stiftungen oder Unternehmen bietet sich hier für öffentliche Kulturverwaltungen und auch für Kultureinrichtungen eine weitere wichtige finanzielle Unterstützungsmöglichkeit, sofern sie Grundlagen, Prinzipien, Sinn und Zweck, Antrags-, Kontroll- und Bewertungsverfahren dieser komplexen Förderungsprogramme durchschauen.
Diese Arbeit soll als Leitfaden dazu dienen, genau dieses möglich zu machen. Nach einer allgemeinen Einführung in Grundlagen, Prinzipien, Sinn und Zweck der Europäischen Förderungssysteme und der Europäischen Kulturförderung und den Erfordernissen für den Antragsteller, die sich daraus ergeben, werden der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds (ESF) als Förderinstrumente zugunsten benachteiligter Regionen und Gebiete und ihre Prinzipien vorgestellt. Anschließend soll das grundlegende Wissen für das Antrags-, Kontroll- und Bewertungsverfahren vermittelt werden, wobei zur Verdeutlichung der komplexen Strukturen die Umsetzung des EFRE und EFS - Programms in Hamburg herangezogen wird. Neben den Kenntnissen über Rechtsgrundlagen, förderfähige Organisationen und Projekte werden die am Antrag-, Bewertungs- und Kontrollverfahren beteiligten Institutionen und ihre Instrumente sowie Auswahl- und Bewertungskriterien zur Qualitätssicherung vorgestellt. Abschließend wird auf die finanziellen Aspekte und Zahlungsverfahren der Strukturfonds sowie die Vertragsgrundlagen eingegangen.
Im Anhang finden sich praktische Tipps zur Projektplanung und Beantragung von EU-Fördermitteln und Kontaktadressen informierender Institutionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäische Förderungssysteme und Kulturförderung
- Grundlagen, Prinzipien, Sinn und Zweck der Europäischen Förderungssysteme und der Europäischen Kulturförderung
- Strukturfonds - Im Dienst der Regionen
- Die Beantragung von Fördergeldern aus den Europäischen Strukturfonds
- Rechtsgrundlagen
- Förderfähige Gebiete: Bsp. Ziel 2 Städtische Gebiete
- Förderfähige Organisationen
- Förderfähige Projekte
- Antragswege und -verfahren für Strukturfonds
- Bewertungs- und Kontrollkriterien der EU
- Das Einheitliche Programmplanungsdokument des EFRE in Hamburg
- Kontroll- und Bewertungssysteme
- Zahlungsverfahren und Finanzangelegenheiten
- Vereinbarung
- Fazit und Perspektiven für das Strukturförderungsprogramm ab 2007
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dient als Leitfaden für die Beantragung von Fördergeldern aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Der Fokus liegt auf der Funktionsweise dieser Förderprogramme im Kontext der Kulturförderung und den notwendigen Schritten für eine erfolgreiche Antragsstellung.
- Grundlagen, Prinzipien und Ziele der Europäischen Förderungssysteme
- Die Bedeutung der Kulturförderung innerhalb der EU-Strategien
- Das Antrags-, Kontroll- und Bewertungsverfahren für Strukturfonds
- Die Rolle des EFRE und ESF bei der Unterstützung von Kulturprojekten
- Finanzielle Aspekte und Zahlungsverfahren der Strukturfonds
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Europäische Union als Verbund von Staaten vor, die den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt fördern wollen. Der ESF und EFRE werden als zentrale Förderinstrumente zur Umverteilung von Ressourcen zugunsten benachteiligter Regionen vorgestellt. Die Bedeutung dieser Förderprogramme für öffentliche Kulturverwaltungen und Kultureinrichtungen wird hervorgehoben.
- Europäische Förderungssysteme und Kulturförderung: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen, Prinzipien und Ziele der Europäischen Förderungssysteme, insbesondere im Hinblick auf die Kulturförderung. Es erläutert, wie die EU Kultur als Träger eines europäischen Bewusstseins fördert und gleichzeitig nationale und regionale Unterschiede berücksichtigt.
- Strukturfonds - Im Dienst der Regionen: Dieses Kapitel stellt die Strukturfonds als Förderinstrumente für benachteiligte Regionen und Gebiete vor. Es beleuchtet die Prinzipien und Ziele der Strukturfonds und erklärt, wie sie zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitragen.
- Die Beantragung von Fördergeldern aus den Europäischen Strukturfonds: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktischen Aspekte der Antragsstellung für Fördergelder aus den Strukturfonds. Es behandelt die Rechtsgrundlagen, förderfähigen Gebiete, Organisationen und Projekte, sowie die am Antrag-, Bewertungs- und Kontrollverfahren beteiligten Institutionen und deren Instrumente.
- Antragswege und -verfahren für Strukturfonds: Dieses Kapitel erläutert die spezifischen Schritte und Prozesse, die bei der Beantragung von Fördergeldern aus den Strukturfonds zu befolgen sind.
- Bewertungs- und Kontrollkriterien der EU: Dieses Kapitel befasst sich mit den Kriterien, die die EU für die Bewertung und Kontrolle von Förderprojekten verwendet. Es stellt die verschiedenen Bewertungskriterien und Kontrollsysteme vor, die für die Qualitätssicherung eingesetzt werden.
- Kontroll- und Bewertungssysteme: Dieses Kapitel setzt sich mit den konkreten Mechanismen zur Kontrolle und Bewertung von Förderprojekten auseinander. Es beschreibt, wie die EU die Verwendung der Fördermittel überwacht und die Wirksamkeit der Projekte beurteilt.
- Zahlungsverfahren und Finanzangelegenheiten: Dieses Kapitel behandelt die finanziellen Aspekte der Strukturfonds, einschließlich der Zahlungsverfahren und der Vertragsgrundlagen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern Europäische Förderungssysteme, Kulturförderung, Strukturfonds, insbesondere EFRE und ESF, Antragsverfahren, Kontroll- und Bewertungskriterien, Finanzielle Aspekte und Zahlungsverfahren.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele des ESF und des EFRE?
Der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) dienen der Umverteilung von Beiträgen der Mitgliedsstaaten zugunsten benachteiligter Regionen, um wirtschaftliche Entwicklungsunterschiede zu verringern.
Wer kann von europäischen Fördermitteln profitieren?
Unternehmen, Kultureinrichtungen, Non-Profit-Organisationen und Beschäftigungsinitiativen in Förderregionen können profitieren, sofern sie zu den Programmzielen beitragen.
Welche Rolle spielt die Kulturförderung in der EU?
Kultur wird als Träger eines europäischen Bewusstseins gefördert, wobei gleichzeitig nationale und regionale Unterschiede berücksichtigt werden.
Wie wird die Umsetzung der Strukturfonds in Hamburg verdeutlicht?
Die Arbeit nutzt das Einheitliche Programmplanungsdokument des EFRE in Hamburg, um die komplexen Strukturen des Antrags- und Kontrollverfahrens zu erklären.
Welche Kriterien nutzt die EU zur Qualitätssicherung von Projekten?
Die EU setzt spezifische Auswahl-, Bewertungs- und Kontrollkriterien sowie Monitoring-Systeme ein, um die Wirksamkeit der geförderten Projekte sicherzustellen.
- Citation du texte
- Stephanie Ziplys (Auteur), 2006, Europäische Förderungssysteme und Kulturförderung - Europäischer Sozialfonds und Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62125