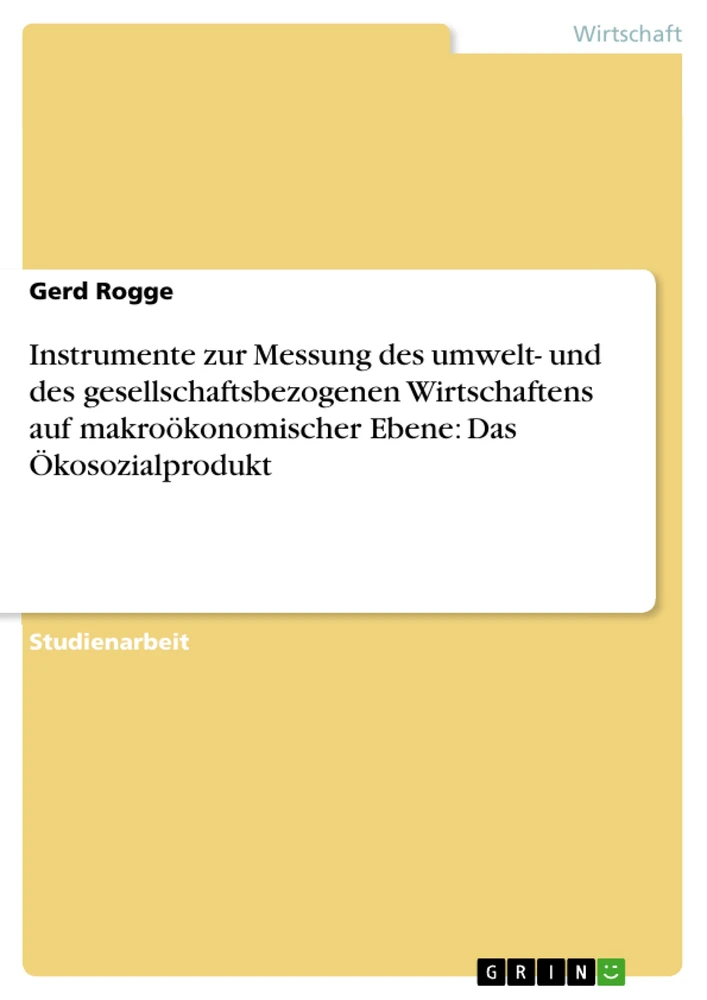Seit den 80er und 90er Jahren ist eine deutliche (globaler werdende) Zunahme von Umweltbelastungen und -zerstörungen zu beobachten. Beispiele dafür sind: Treibhauseffekt, Waldsterben, Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung, Ozonabbau, Abholzung der Regenwälder etc. Unterstützt vom rapiden Bevölkerungswachstum führt vor allem die Ressourcennutzung und -verschwendung zur einer starken Belastung der Ökosphäre und zu der Zerstörung vieler Ökosysteme. Eine weitere Ursache für die Zunahme ist im menschlichen Verhalten verankert. In unterentwickelten Staaten wird die Umweltverschmutzung oder -zerstörung oft in Kauf genommen, wenn es um die Befriedigung existenzieller (materieller) Lebensbedürfnisse geht. Hinzu kommt das Wunschdenken, mit verstärktem Wirtschaftswachstum (auch auf Kosten der Umwelt) die Kluft zwischen ihnen und den „reichen“ Ländern zu verringern. In den sog. „entwickelten“ Staaten mit hohem materiellem Wohlstand sind andere Gründe vorherrschend. Dort ist man in der Vergangenheit kaum dazu bereit gewesen auf materielle Ansprüche zugunsten einer besseren Umweltqualität und damit einer verbesserten Lebensqualität zu verzichten. Erst seit den 80er Jahren hat sich die Einstellung gewandelt und es ist zu einem stärker ausgeprägtem Umweltbewusstsein in weiten Bereichen der Bevölkerung gekommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökologische Belastung in Zahlen
- Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und das Bruttosozialprodukt (BSP)
- „Qualitatives Wachstum“
- Kritik an der VGR bzw. am BSP
- Hauptdefizite der VGR aus ökologischer Sicht
- „Nachhaltigkeit“ als grundlegendes Wirkprinzip
- Das Ökosozialprodukt (ÖSP) als alternativer Ansatz zur Wohlfahrtsmessung
- Die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR)
- Zielsetzung
- Anforderungen
- Struktur
- Schwierigkeiten bei der Erstellung einer UGR
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Kritik an der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) und dem Bruttosozialprodukt (BSP) als Messgrößen für Wohlstand. Er argumentiert, dass diese Indikatoren die ökologischen Kosten des Wirtschaftens nicht ausreichend berücksichtigen. Der Text präsentiert das Ökosozialprodukt (ÖSP) als eine Alternative zur Wohlfahrtsmessung, die Umweltaspekte einbezieht.
- Kritik am BSP als Wohlstandsindikator
- Defizite der VGR aus ökologischer Sicht
- Das ÖSP als alternatives Konzept zur Wohlfahrtsmessung
- Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Wirtschaften
- Die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR) als Instrument zur Messung ökologischer Belastungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Zunahme der Umweltbelastungen und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtungsweise des Wirtschaftens. Das zweite Kapitel geht auf die Schwierigkeiten bei der monetären Bewertung ökologischer Schäden ein. Das dritte Kapitel beschreibt die VGR und das BSP als traditionelle Messgrößen für die gesamtwirtschaftliche Leistung und stellt ihre Kritikpunkte dar. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Defiziten der VGR aus ökologischer Sicht und der Bedeutung von Nachhaltigkeit. Das fünfte Kapitel stellt das ÖSP als alternativen Ansatz zur Wohlfahrtsmessung vor. Das sechste Kapitel widmet sich der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) als Instrument zur Messung ökologischer Belastungen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Umweltökonomie, Nachhaltigkeit, die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR), das Bruttosozialprodukt (BSP), das Ökosozialprodukt (ÖSP), die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR) und die Messung von Wohlstand. Die Kritik an den traditionellen Messgrößen des Wirtschaftens steht im Zentrum des Textes und der Wunsch nach einer umfassenderen Betrachtungsweise, die ökologische und soziale Aspekte integriert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ökosozialprodukt (ÖSP)?
Das Ökosozialprodukt ist ein alternativer Ansatz zur Wohlfahrtsmessung, der im Gegensatz zum traditionellen Bruttosozialprodukt ökologische Schäden und Ressourcenverbrauch als Kostenfaktoren einbezieht.
Warum wird das Bruttosozialprodukt (BSP) als Wohlstandsindikator kritisiert?
Kritisiert wird, dass das BSP Reparaturleistungen nach Umweltkatastrophen als Wachstum verbucht und die Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen nicht negativ bilanziert.
Was ist die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR)?
Die UGR ist ein Instrument zur statistischen Erfassung der Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Umwelt, um ökologische Belastungen messbar zu machen.
Was bedeutet "qualitatives Wachstum"?
Qualitatives Wachstum zielt auf eine Steigerung der Lebensqualität ab, die nicht allein auf materiellem Konsum basiert, sondern Umweltqualität und soziale Aspekte berücksichtigt.
Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit in der Makroökonomie?
Nachhaltigkeit fungiert als grundlegendes Wirkprinzip, das fordert, heute so zu wirtschaften, dass künftige Generationen die gleichen Lebensgrundlagen vorfinden.
- Arbeit zitieren
- Gerd Rogge (Autor:in), 2006, Instrumente zur Messung des umwelt- und des gesellschaftsbezogenen Wirtschaftens auf makroökonomischer Ebene: Das Ökosozialprodukt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62142