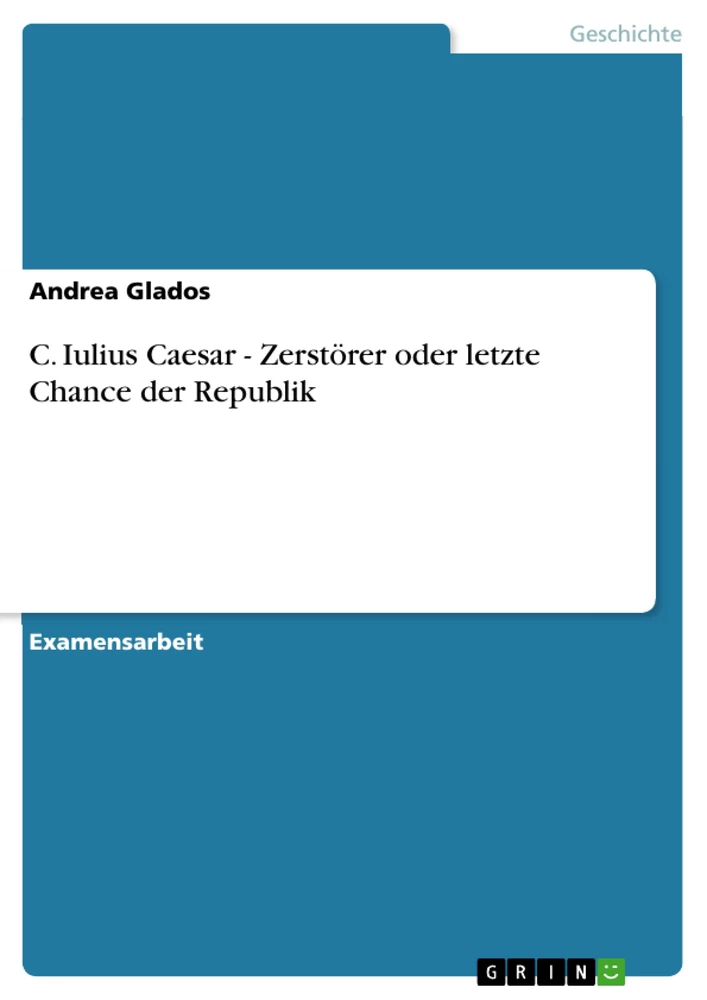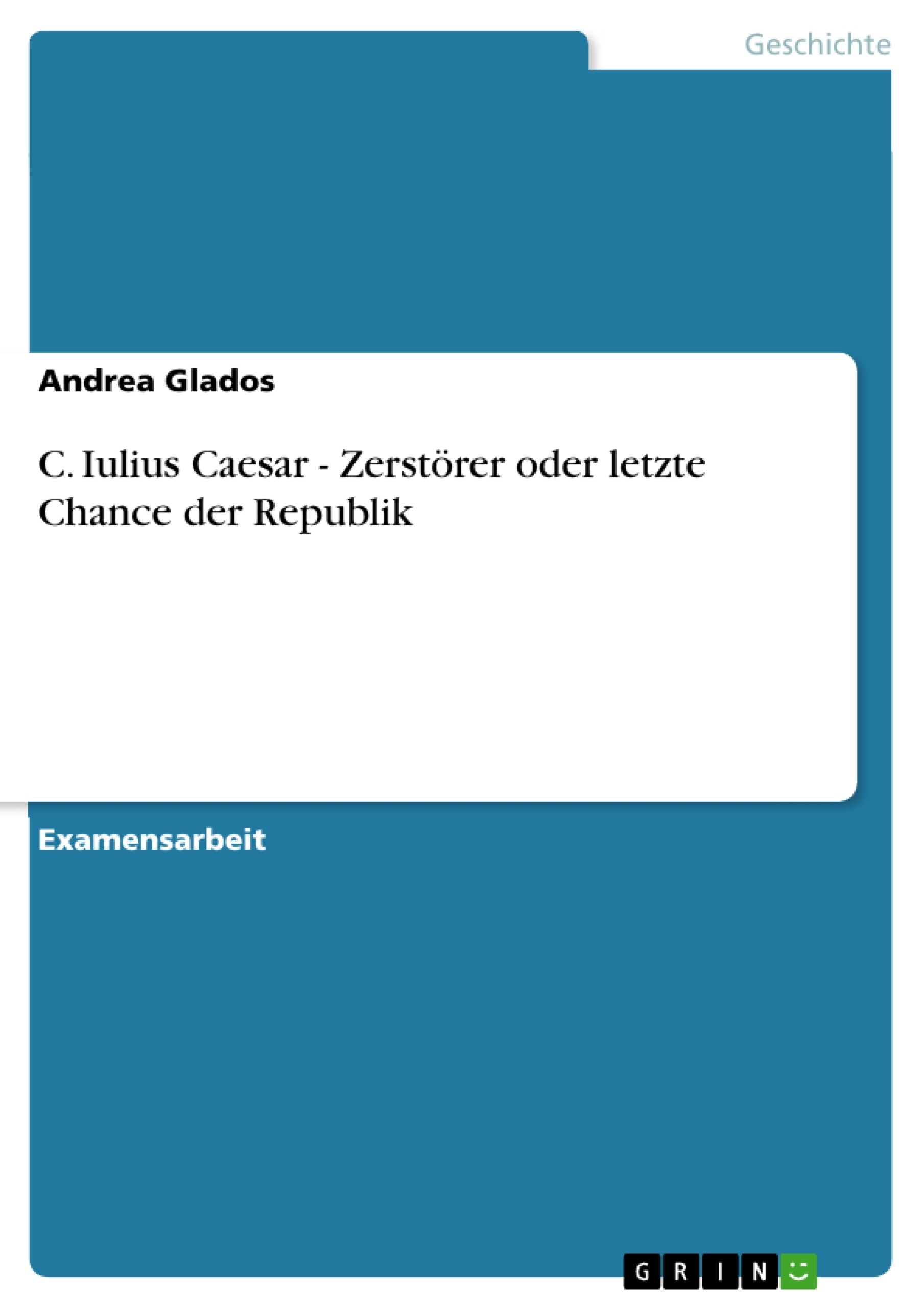Einleitung
Selten hat eine Persönlichkeit der Antike die Nachwelt derart in ihren Bann gezogen, wie dies bei dem römischen Feldherrn und Politiker Gaius Julius Caesar der Fall ist. Noch heute versuchen Wissenschaftler wie Laien in die Psyche des Mannes einzudringen, der im ersten vorchristlichen Jahrhundert die Geschicke des römischen Staates lenkte. Dabei steht oftmals die Frage im Mittelpunkt, ob er nun eine Monarchie errichten und damit den Untergang der bewährten Republik besiegeln wollte, oder eben nicht. In der Forschung haben sich im Verlauf der Jahrzehnte hierzu zwei grundlegende Tendenzen manifestiert: Während vornehmlich ältere Wissenschaftler, wie etwa Eduard Meyer, der festen Überzeugung sind, der Plan Caesars sei es gewesen, schlussendlich die res publica durch eine Tyrannis zu ersetzen, scheint die neuere Forschung indes geprägt durch die Auffassung, Caesar habe sich mit der von ihm errichteten dictatura perpetua zufrieden gegeben, nicht zuletzt weil er damit die Befugnisse einer „de-facto-Monarchie 1“ innehatte, ohne sich der anrüchigen dominatio verdächtig zu machen 2. Da dieser äußerst kurze Abriss der Caesarforschung gewiss nicht der Vielfalt der historischen Analysen gerecht werden kann, aber auch nicht soll, wurde bei der Bearbeitung des Themas, dem Tribut zollend, nur auf eine Auswahl der relevanten Schriften zurückgegriffen. Hierbei stehen einerseits besonders die Arbeiten Hermann Strasburgers, wie auch die Caesarbiographie seines Mentors Matthias Gelzer, und andererseits nicht minder die Darstellungen Martin Jehnes, Kurt Raaflaubs, sowie Hinnerk Bruhns’, Luciano Canforas und Astrid Kraazs im Vordergrund der Aufbereitung. Nichtsdestotrotz ist die Arbeit primär von der Motivation getragen, anhand zeitgenössischer Quellen, wie Plutarch, Sueton, Cicero und Caesar selbst, die Motive des römischen Feldherrn zu ergründen. Die Frage inwiefern anhand der Quellen ein ‚Plan’, also das zielbewusste Streben nach einer Monarchie nachvollziehbar wird, soll schließlich im Fokus der vorliegenden Staatsexamensarbeit liegen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- cursus honorum suo anno
- Caesar - ein zweiter Marius
- Der politische Aufstieg
- Als Aedil ein Tyrann
- 63 v. Chr. ein schicksalhaftes Jahr
- Pontifex Maximus
- Die Coniuratio Catilinae
- 59 v. Chr. - eine Entscheidung gegen die Republik?
- Das Proconsulat
- „Iacta alea est“ – ein schier unlösbarer Konflikt
- Hochmut kommt vor dem Fall
- Primus inter Pares?
- Peinlich Prätentiös – zu den Ehrbeschlüssen
- Die Verschwörung
- Die Iden des März 44 v. Chr. – ein Exkurs
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob Gaius Julius Caesar eine Monarchie errichten und damit die römische Republik zerstören wollte. Sie analysiert Caesars politische Karriere und sein Wirken im Kontext der damaligen Ereignisse, um seine Motive zu ergründen. Die Arbeit stützt sich dabei auf zeitgenössische Quellen und berücksichtigt die verschiedenen Interpretationen in der Forschung.
- Caesars politischer Aufstieg und seine Rolle im römischen Staat
- Die Interpretation von Caesars Handlungen im Hinblick auf seine angeblichen monarchischen Ambitionen
- Die Rolle wichtiger Zeitgenossen Caesars (z.B. Cicero, Cato) und deren Einfluss auf die politische Landschaft
- Die quellenkritische Auseinandersetzung mit den antiken Berichten über Caesar
- Die Bewertung der verschiedenen Forschungsperspektiven zu Caesar und dem Untergang der Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert die gegensätzlichen Forschungsansätze zur Frage nach Caesars monarchischen Ambitionen. Sie betont die Bedeutung der quellenkritischen Auseinandersetzung mit antiken Autoren und die Notwendigkeit, Caesar im Kontext seiner Zeit zu verstehen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse zeitgenössischer Quellen, um Caesars Motive zu ergründen und die Frage nach einem bewussten Plan zur Errichtung einer Monarchie zu untersuchen.
cursus honorum suo anno: Dieses Kapitel beschreibt Caesars politischen Aufstieg, seine Karriere und seine Aktionen als Aedil. Es vergleicht ihn mit Marius und beleuchtet seine politischen Strategien und Bündnisse. Der Fokus liegt auf der Analyse seines Werdegangs und der Herausbildung seiner Machtposition, ohne explizit auf die Frage nach monarchischen Bestrebungen einzugehen, sondern diese Entwicklung als Kontext darzustellen.
63 v. Chr. ein schicksalhaftes Jahr: Das Kapitel behandelt zwei wichtige Ereignisse im Jahr 63 v. Chr.: Caesars Wahl zum Pontifex Maximus und seine Rolle bei der Niederschlagung der Catilinarischen Verschwörung. Beide Ereignisse beleuchten Caesars wachsenden Einfluss und seine politischen Fähigkeiten, aber auch die Ambivalenz seiner Rolle innerhalb des bestehenden Systems. Die Analyse fokussiert auf den Einfluss dieser Ereignisse auf seine weitere Karriere und den Ausbau seiner Machtbasis.
59 v. Chr. - eine Entscheidung gegen die Republik?: Dieses Kapitel analysiert das Jahr 59 v. Chr. und Caesars Konsulat, wo er mit seinen Verbündeten (Pompeius und Crassus) das erste Triumvirat bildete. Es untersucht die politischen Manöver und Machtstrategien, die Caesar zu diesem Zeitpunkt anwandte und die weitreichenden Folgen für die römische Republik. Der Fokus liegt auf der Beurteilung dieser Ereignisse im Licht der Frage, ob Caesars Handlungen bereits als bewusstes Agieren gegen die Republik gewertet werden können.
Das Proconsulat: Hier wird Caesars Wirken als Prokonsul in Gallien behandelt. Es werden seine militärischen Erfolge und die damit verbundene Stärkung seiner Position analysiert. Das Kapitel erläutert den Kontext dieser Kampagne und wie Caesars Erfolg seinen Einfluss und seine Popularität im römischen Staat weiter stärkte, was seine spätere Machtübernahme entscheidend prägte.
„Iacta alea est“ – ein schier unlösbarer Konflikt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius. Es analysiert die Ursachen des Konflikts und die politischen und militärischen Strategien der beteiligten Parteien. Es wird die Eskalation der Situation bis zum Bürgerkrieg beleuchtet, und die entscheidenden Schritte, die zu Caesars Sieg führten, werden umfassend dargestellt.
Hochmut kommt vor dem Fall: Dieser Abschnitt beschreibt Caesars Herrschaft als Diktator und untersucht die verschiedenen Aspekte seines politischen Handelns. Es werden die unterschiedlichen Maßnahmen und politischen Entscheidungen unter der Lupe genommen, die in der Forschung als Indizien für seine angeblichen monarchischen Bestrebungen interpretiert werden.
Schlüsselwörter
Gaius Julius Caesar, Römische Republik, Cursus honorum, Coniuratio Catilinae, Triumvirat, Bürgerkrieg, Diktatur, Monarchie, Quellenkritik, Plutarch, Sueton, Cicero, Machtkampf, Politische Strategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gaius Julius Caesar – Monarch oder Republikaner?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Gaius Julius Caesar eine Monarchie errichten und damit die römische Republik zerstören wollte. Sie analysiert Caesars politische Karriere und sein Wirken im Kontext der damaligen Ereignisse, um seine Motive zu ergründen. Die Arbeit stützt sich dabei auf zeitgenössische Quellen und berücksichtigt verschiedene Interpretationen in der Forschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Caesars politischen Aufstieg, seine Rolle im römischen Staat, die Interpretation seiner Handlungen im Hinblick auf monarchische Ambitionen, die Rolle wichtiger Zeitgenossen wie Cicero und Cato, die quellenkritische Auseinandersetzung mit antiken Berichten über Caesar und die Bewertung verschiedener Forschungsperspektiven zum Untergang der Republik. Spezifische Ereignisse wie die Catilinarische Verschwörung, das erste Triumvirat, Caesars Prokonsulat in Gallien und der Bürgerkrieg gegen Pompeius werden detailliert analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in Kapitel zu Caesars politischem Aufstieg (cursus honorum), dem schicksalhaften Jahr 63 v. Chr. (Pontifex Maximus und Catilinarische Verschwörung), dem Jahr 59 v. Chr. und dem ersten Triumvirat, Caesars Prokonsulat in Gallien, dem Bürgerkrieg ("Iacta alea est"), Caesars Herrschaft als Diktator ("Hochmut kommt vor dem Fall") und einer abschließenden Betrachtung. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse und deren Interpretation im Kontext der Forschungsfrage.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf zeitgenössische Quellen und berücksichtigt die verschiedenen Interpretationen in der Forschung. Genannt werden explizit Plutarch und Sueton, sowie implizit Cicero. Die quellenkritische Auseinandersetzung mit diesen antiken Berichten ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit legt nicht explizit eine Schlussfolgerung dar, sondern präsentiert eine Analyse von Caesars Handlungen und den verschiedenen Interpretationen in der Forschung. Der Leser soll selbst eine Bewertung der Frage nach Caesars monarchischen Ambitionen vornehmen können, basierend auf den dargestellten Fakten und Argumenten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gaius Julius Caesar, Römische Republik, Cursus honorum, Coniuratio Catilinae, Triumvirat, Bürgerkrieg, Diktatur, Monarchie, Quellenkritik, Plutarch, Sueton, Cicero, Machtkampf, Politische Strategien.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Leser, die sich mit der römischen Geschichte und der Figur Gaius Julius Caesar auseinandersetzen möchten. Sie bietet eine strukturierte und professionelle Analyse der Thematik.
- Arbeit zitieren
- Andrea Glados (Autor:in), 2006, C. Iulius Caesar - Zerstörer oder letzte Chance der Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62226