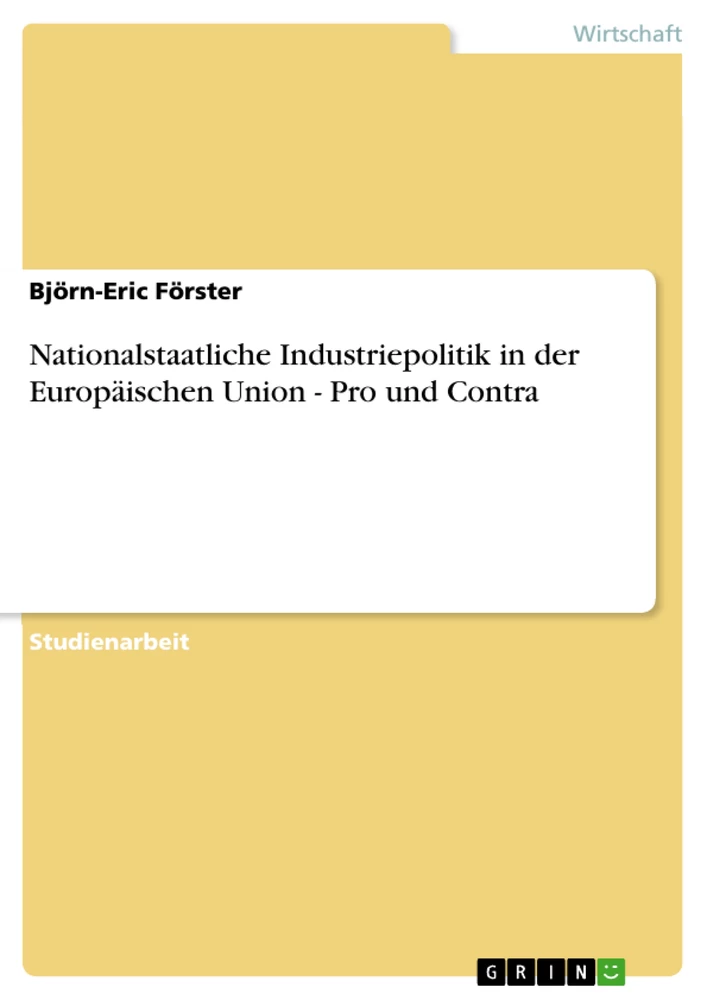Neben finanziellen Beihilfen betreiben Staaten weitere Handlungen und Maßnahmen, durch die Industrie und ihre Entwicklung beeinflusst werden. Beispielsweise gründete Frankreich als Reaktion auf die Selbstdiagnose einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der zukunftsträchtigen Hochtechnologie Anfang dieses Jahres die „Agentur zur Förderung der industriellen Innovation“. Eine interdisziplinäre Förderung von für den „Massenmarkt der Zukunft“ tauglichen Innovationen durch Beihilfen bzw. rechts- oder handelspolitischen Maßnahmen ist das erklärte Ziel der Agentur. Auch die jüngsten Veröffentlichungen der Europäischen Union (EU) belegen, dass Industriepolitik aus Europa und seinen Staaten nicht wegzudenken ist. In ihrer Pressemitteilung vom 5. Oktober 2005 proklamiert die Europäische Kommission (KOM) eine neue Ausrichtung der europäischen Industriepolitik für das Verarbeitende Gewerbe. Die Neuorientierung umfasst neben sieben sektorübergreifenden Initiativen bspw. zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder der industriellen Forschung und Innovationen auch sieben neue sektorspezifische Maßnahmen für u.a. die Pharmazie und die chemische wie auch biotechnische Industrie.
Industriepolitik steht im Mittelpunkt rivalisierender politischer und wirtschaftlicher Interessenslagen. In Abhängigkeit von ihrer Grundauffassung über wirtschaftspolitische Leitbilder fordern Ökonomen liberale Konzepte politischmarktwirtschaftlicher Rahmensetzung oder befürworten interventionistische Eingriffe, um den Erhalt, die Anpassung oder Wachstumsförderung der Industrie zu erreichen. Aus diesem Konflikt entsteht für die Industriepolitik folgendes Dilemma: „Industriepolitik … steht … in einem Spannungsverhältnis. Einerseits wird aufgrund der marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung ein Bedarf für Industriepolitik gar nicht oder nur sehr eingeschränkt gesehen, andererseits werden unterschiedliche Probleme der Industrieunternehmen, Marktversagen u.a. als Argumente für Industriepolitik vorgebracht.“
Darüber hinaus besteht Konfliktpotenzial über die industriepolitischen Kompetenzen und Zuständigkeiten innerhalb der Union und ihren nationalen Mitgliedsstaaten, zu dessen Auflösung eine genaue Beleuchtung des Subsidiaritätsprinzips notwendig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Aufbau und Ziel der Arbeit
- Grundlagen der Industriepolitik
- Begriffsbestimmung und Einordnung im wirtschaftspolitischen Aufgabenfeld
- Industriepolitische Kompetenzabgrenzung der Jurisdiktionen
- Instrumente der Industriepolitik
- Auswirkungen und Implikationen nationaler Industriepolitik innerhalb der Europäischen Union
- Begründung der Industriepolitik
- Vom Wettbewerbsleitbild zur theoretischen Rechtfertigung
- Nationale Industriepolitik auf positive Wohlfahrtseffekte im Inland ausgerichtet
- Beurteilung aus europäischer Sicht
- Kritische Anmerkungen zur (nationalen) Industriepolitik
- Negative Konsequenzen auf europäischer Ebene
- Rückschlüsse für die Europäische Union
- Abschließende Bewertung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Rolle der nationalstaatlichen Industriepolitik innerhalb der Europäischen Union. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwiefern nationale Industriepolitik mit den Prinzipien des Binnenmarktes und des Wettbewerbsrechts vereinbar ist und welche Auswirkungen sie auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft hat.
- Bedeutung der Industriepolitik für die nationale Wirtschaftsentwicklung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Beihilfenregelungen der EU
- Konfliktpotenzial zwischen nationaler Industriepolitik und europäischer Wettbewerbspolitik
- Analyse von Fallbeispielen und aktuellen Entwicklungen
- Alternativen und Perspektiven für eine effiziente Industriepolitik im europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der nationalen Industriepolitik in der Europäischen Union herausgestellt und die Motivation für die Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel beleuchtet die Grundlagen der Industriepolitik, ihre Begriffsbestimmung, Einordnung in das wirtschaftspolitische Aufgabenfeld und die Kompetenzabgrenzung zwischen den einzelnen Jurisdiktionen. Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen und Implikationen nationaler Industriepolitik innerhalb der Europäischen Union. Es werden die Argumente für und gegen eine nationale Industriepolitik sowie ihre potenziellen positiven und negativen Auswirkungen auf das In- und Ausland erörtert.
Schlüsselwörter
Nationale Industriepolitik, Europäische Union, Wettbewerbspolitik, Beihilfen, Binnenmarkt, Wettbewerbsfähigkeit, Wohlfahrtseffekte, Subsidiaritätsprinzip, Marktversagen.
Häufig gestellte Fragen zur Industriepolitik in der EU
Was ist das Dilemma der Industriepolitik?
Das Dilemma liegt im Spannungsfeld zwischen der marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung (liberale Sicht) und der Notwendigkeit staatlicher Eingriffe bei Marktversagen (interventionistische Sicht).
Wie beeinflusst das Subsidiaritätsprinzip die Industriepolitik?
Es regelt die Kompetenzverteilung: Maßnahmen sollen auf nationaler Ebene erfolgen, es sei denn, eine europäische Lösung ist aufgrund grenzüberschreitender Effekte effizienter.
Was sind typische Instrumente nationaler Industriepolitik?
Dazu gehören finanzielle Beihilfen, steuerliche Vergünstigungen, Forschungsförderung sowie rechts- oder handelspolitische Maßnahmen zur Unterstützung strategischer Sektoren.
Warum kritisiert die EU nationale Beihilfen oft?
Nationale Beihilfen können den Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren, indem sie Unternehmen in einem Land künstliche Vorteile gegenüber Konkurrenten aus anderen EU-Staaten verschaffen.
Welche Sektoren stehen oft im Fokus der Industriepolitik?
Besonders Hochtechnologie, Pharmazie, chemische Industrie und biotechnische Branchen gelten als zukunftsträchtig und werden daher häufig staatlich gefördert.
- Arbeit zitieren
- Björn-Eric Förster (Autor:in), 2005, Nationalstaatliche Industriepolitik in der Europäischen Union - Pro und Contra, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62272