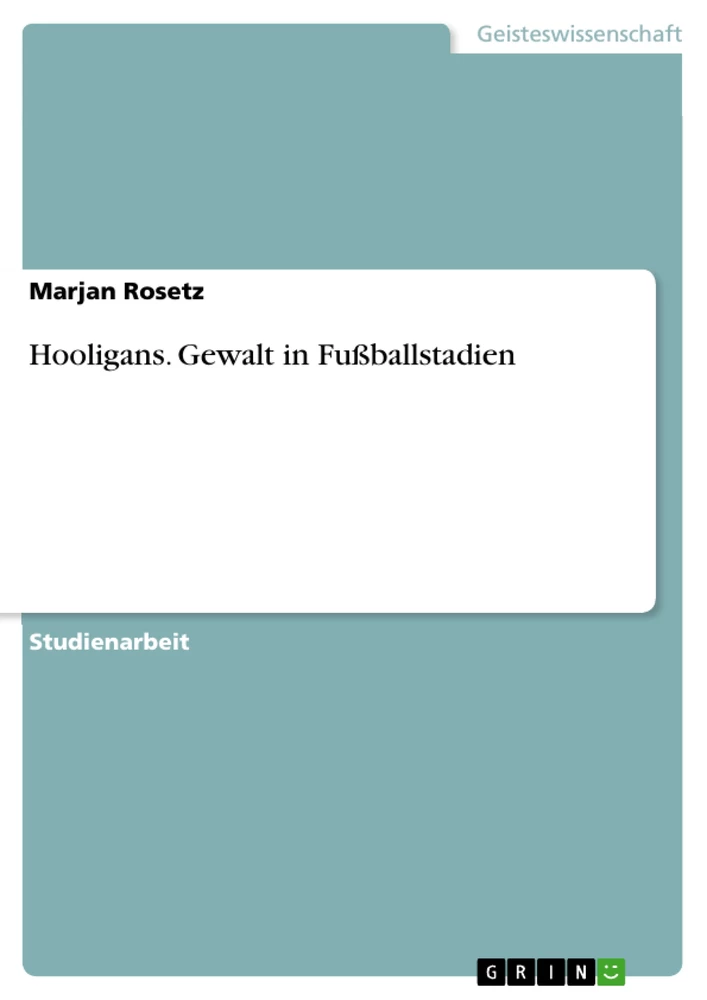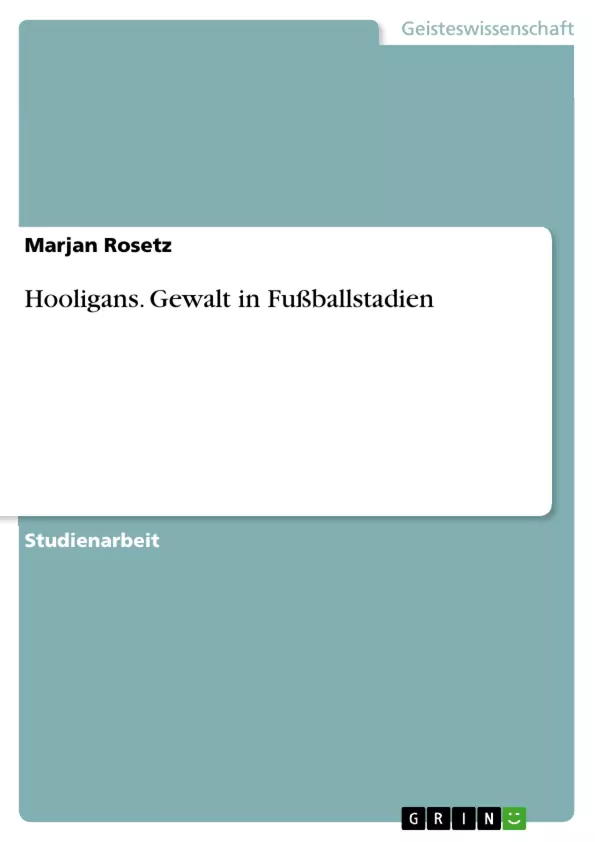Gerade durch die schrecklichen Ereignisse am Rande der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich , ist die Gewalt der Hooligans wieder zunehmend in den Fokus der gesellschaftlichen Diskussion gelangt. Jedoch die oft sehr einseitige und emotional hochstilisierte Darstellung der Fußballrowdies in den Medien kann keinem, der ernsthaft wissen will, was diese für Menschen sind, oder woher diese Gewaltbereitschaft kommt, eine realistische Antwort geben.
Diese wissenschaftliche Arbeit versucht ein möglichst realistisches Bild über jene Jugendlichen zu liefern und eine plausible Erklärung des Hooligan-Phänomens zu geben, basierend auf einigen der zahlreichen Studien, die schon über dieses Thema erstellt wurden.
Hierbei werden auch gesamtgesellschaftliche Faktoren beleuchtet, die wesentlich zur Entstehung der Hooligankultur beigetragen haben. Hooligan, dieses Wort kommt aus dem englischen Sprachgebrauch und heißt soviel wie Randalierer. Aber sind diese Jugendlichen einfach nur Gewalttäter, die Lust daran verspüren andere Menschen schwer zu verletzen, oder gibt es doch differenzierte Gründe für dieses Verhalten? Die nachfolgenden Seiten werden Aufschluß darüber geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bill Buford "Geil auf Gewalt" - Teilnehmende Beobachtung eines Schriftstellers unter englischen Hooligans
- Der Autor
- Innere Struktur
- Woher kommt die Gewalt?
- Identitätsbildung
- Zusammenfassung des Buches
- Die Entwicklung der Fankultur in Deutschland
- Die erste Phase - Milieuspezifische Sozialisation des Fußballfans
- Die zweite Phase - Individualisierungstendenzen und Kommerzialisierung
- Die 3. Phase - Entstehung der Hooligangruppen
- Der Hooligan von heute
- Gruppeninterne Strukturen und Motivation der Hooligans
- Das Streben nach Respekt und Bedeutung
- Kameradschaft und episodale Schicksalsgemeinschaft
- Gesellschaft als totale Institution und der totale Druck
- Identitätssuche und Nationalstolz
- Der besondere Fall der „Ost-Hools\" und die Veränderungen durch die Wende
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Hooligan-Gewalt im Kontext von Fußballspielen. Sie analysiert die Ursachen und die Entwicklung dieser Form der Gewalt und beleuchtet die spezifischen Motivlagen der Hooligans.
- Analyse der Ursachen für Hooligan-Gewalt
- Entwicklung der Fankultur in Deutschland und England
- Motivation und Strukturen der Hooligangruppen
- Soziale und gesellschaftliche Faktoren, die zur Entstehung der Hooligankultur beitragen
- Die Rolle der Identitätssuche und des Nationalstolzes im Kontext von Hooligan-Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Hooligan-Gewalt ein und beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz des Themas. Das zweite Kapitel widmet sich Bill Bufords Buch "Geil auf Gewalt", in dem der Autor die englische Hooliganszene aus der Innensicht eines teilnehmenden Beobachters beschreibt. Er beleuchtet die innere Struktur der Hooligangruppen, die Motivlagen für Gewalt und die Rolle der Identitätssuche. Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklung der Fankultur in Deutschland und identifiziert verschiedene Phasen mit spezifischen Merkmalen. Das vierte Kapitel behandelt die Strukturen, Motivationen und das Streben nach Respekt und Bedeutung der heutigen Hooligans. Der besondere Fall der „Ost-Hools\" und die Veränderungen durch die Wende werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Hooligan, Fußballgewalt, Fankultur, Identitätsbildung, Nationalstolz, soziale Faktoren, gesellschaftliche Entwicklung, Teilnehmende Beobachtung, England, Deutschland, Ost-Hools
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für Hooligan-Gewalt?
Ursachen liegen oft in Identitätssuche, dem Streben nach Respekt innerhalb einer Gruppe und gesellschaftlichen Faktoren wie dem Druck in modernen Institutionen.
Wer ist Bill Buford und was beschreibt sein Buch "Geil auf Gewalt"?
Buford ist ein Schriftsteller, der als teilnehmender Beobachter englische Hooligans begleitete, um die innere Dynamik und den Rausch der Gewalt zu verstehen.
Wie hat sich die Fankultur in Deutschland entwickelt?
Die Entwicklung verlief in Phasen: von der milieuspezifischen Sozialisation über Individualisierungstendenzen bis hin zur Entstehung spezialisierter Hooligangruppen.
Was motiviert Hooligans zur Gewalt?
Neben dem Adrenalinkick spielen Kameradschaft, das Erleben einer "Schicksalsgemeinschaft" und oft auch ein fehlgeleiteter Nationalstolz eine zentrale Rolle.
Wer sind die sogenannten „Ost-Hools“?
Es handelt sich um Hooligangruppen aus Ostdeutschland, deren Gewaltpotenzial und Strukturen massiv durch die gesellschaftlichen Umbrüche nach der Wende geprägt wurden.
Stellen Medien Hooligans realistisch dar?
Die Arbeit kritisiert, dass Medien Hooligans oft emotional hochstilisieren und einseitig darstellen, anstatt die tieferen soziologischen Gründe zu beleuchten.
- Quote paper
- Marjan Rosetz (Author), 1999, Hooligans. Gewalt in Fußballstadien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/624