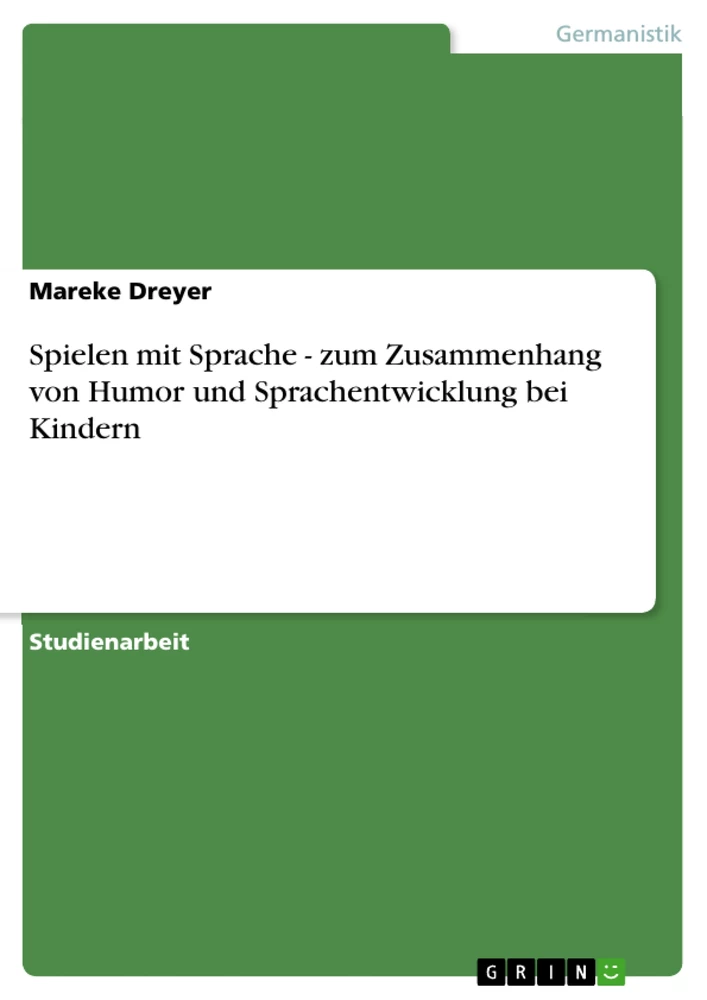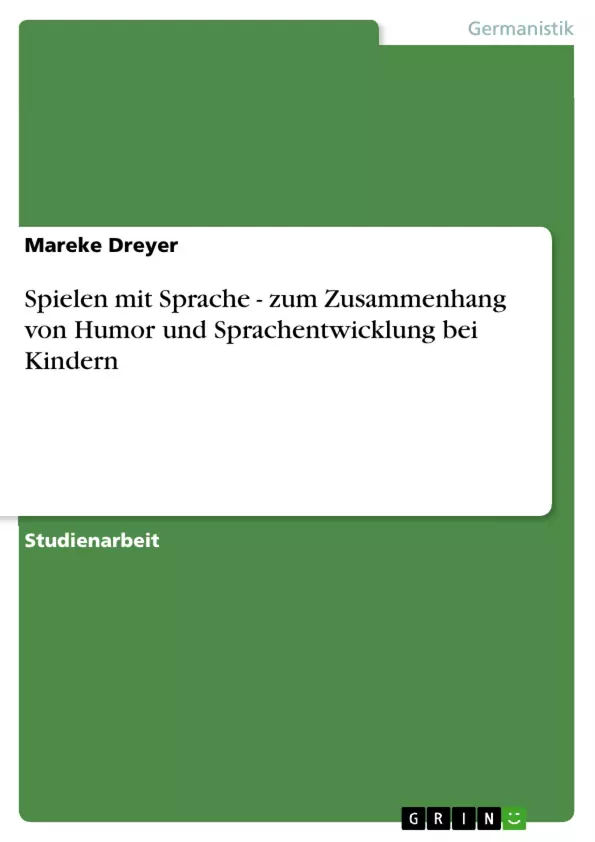Überall auf der Welt wird gelacht. Humor verbindet (und trennt) Menschen in allen Kulturen; auf allen Kontinenten wird gelacht und gescherzt, und das schon sehr lange. Die meisten Forscher sehen den Spieltrieb als direkten Vorläufer des Humors, das Lachen galt als ein Spielsignal (vgl. Grit Kienzlen 2006, S.1f.). Humor kann aber auch als „Entwicklungsphänomen beschrieben werden, das erfolgreiche Interaktion zwischen einem Individuum und seinem kulturellen und sozialen Kontext vermittelt“ (Bönsch-Kauke 2003, S. 59). Humorforschung ist angelehnt an diese Aussage ein interdisziplinäres Forschungsfeld, auf dem sich die verschiedensten Wissenschaften tummeln: Von der Philosophie, Anthropologie und Religionswissenschaft über Medizin und Psychologie bis hin zur Pädagogik und Soziologie beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit diesem Phänomen. Entsprechend dieser Bandbreite an Interesse und Interessenten gibt es eine Vielzahl von Definitionsansätzen und Erklärungsversuchen. Humor und Lachen als ein Ausdrucksmittel sollen beispielsweise dem Spannungs- und Aggressionsabbau dienen (Entspannungstheorie), schaffen Zugehörigkeits- bzw. Abgrenzungsempfindungen in sozialen Gruppen (Superioritätstheorie) und haben die Wahrnehmung von Kontrasten zur Grundlage (Inkongruenztheorie).
Ich beschäftige mich in dieser Arbeit exemplarisch mit dem Zusammenhang von Humor und Spracherwerb bei Kindern. Dass es eine physiologische Verknüpfung von aufrechtem Gang, Entwicklung des Kehlkopfs zum Sprechapparat und Spracherwerb einerseits und der Entwicklung von Humor andererseits gibt, hat der Humorforscher und Theologe John Morreall postuliert (ebd. S. 3). In der linguistischen Humorforschung ist es nun Hermann Helmers’ Verdienst, die Wechselwirkung von Humor und Spracherwerb bei Kindern untersucht zu haben. Seine Untersuchungsergebnisse werde ich im Folgenden darstellen. Dabei stelle ich die Entwicklungsschritte des kindlichen Humors und deren Voraussetzungen im Prozess des kindlichen Spracherwerbs vor. Nachfolgend wird die umgekehrte Wirkung des Humors auf die Entwicklungsschritte im Spracherwerb beschrieben. In einem kurzen letzten Abschnitt widme ich mich, sozusagen als Brückenschlag in die Gegenwart, den Unterschieden im Humor- und Sprachverhalten von Mädchen und Jungen. Die Arbeit schließt mit einem von der linguistischen Humorforschung formulierten zukünftigen Forschungsbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen zum Humorbegriff bei Kindern
- Von Aristoteles über Freud...
- ... bis Helmers
- Entwicklungsschritte des kindlichen Humors
- Vorsprachlicher Humor
- Umstrukturierung von Lauten und Umbau von Satzelementen
- Semantische Verkehrungen
- Episierung
- Integration und Emanzipation als Faktoren des Humors
- Bedeutung des Humors für die Sprachentwicklung
- Reinforcement
- Sprechtraining
- Sprachliche Kreativität
- Ästhetisierung
- Kritische Reflexion
- Humor bei Mädchen und Jungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang von Humor und Spracherwerb bei Kindern. Sie untersucht, wie die Entwicklung des kindlichen Humors mit der Sprachentwicklung verwoben ist und umgekehrt, wie Humor die Sprachentwicklung beeinflusst. Die Arbeit analysiert die Entwicklungsschritte des kindlichen Humors, beginnend mit vorsprachlichem Humor und dem Spielen mit Lauten, bis hin zu semantischen Verkehrungen, Episierung und der Integration und Emanzipation als Faktoren des Humors. Sie beleuchtet auch die Bedeutung des Humors für die Sprachentwicklung, insbesondere in Bezug auf Reinforcement, Sprechtraining, sprachliche Kreativität, Ästhetisierung und kritische Reflexion.
- Die Entwicklung des kindlichen Humors in seinen verschiedenen Phasen
- Der Einfluss des Humors auf die Sprachentwicklung
- Die Rolle der Sprache im kindlichen Humor
- Die Verbindung zwischen Humor und sozialer Interaktion
- Humor als Ausdruck von Kreativität und kritischer Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und die Relevanz des Themas Humor und Spracherwerb bei Kindern vor. Es zeichnet einen kurzen historischen Überblick zur Humorforschung und stellt die verschiedenen Ansätze und Theorien zum Humor dar.
- Vorüberlegungen zum Humorbegriff bei Kindern: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Humorverständnisses bei Kindern, ausgehend von Aristoteles und Freud bis hin zu Helmers. Es beleuchtet, wie Kinder Sprache zur Produktion von Humor einsetzen und welche Bedeutung Sprache im kindlichen Humor spielt.
- Entwicklungsschritte des kindlichen Humors: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des kindlichen Humors von der vorsprachlichen Phase bis hin zu komplexeren Formen des Humors, die auf Sprachverständnis und -verwendung beruhen. Es beleuchtet verschiedene Formen des kindlichen Humors, wie z.B. Lautspiele, semantische Verkehrungen und Episierung.
- Bedeutung des Humors für die Sprachentwicklung: Dieses Kapitel untersucht, wie Humor die Sprachentwicklung positiv beeinflusst. Es beleuchtet verschiedene Aspekte, wie z.B. Reinforcement, Sprechtraining, sprachliche Kreativität, Ästhetisierung und kritische Reflexion.
Schlüsselwörter
Kindlicher Humor, Sprachentwicklung, Spracherwerb, Humorforschung, Sprachspiele, Komik, Lachen, Interaktion, Entwicklungspsychologie, Linguistik, Helmers, Freud, Aristoteles.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zusammenhang zwischen Humor und der Sprachentwicklung bei Kindern?
Humor und Sprachentwicklung sind eng miteinander verwoben. Während sprachliche Fähigkeiten notwendig sind, um komplexe Witze zu verstehen, wirkt Humor umgekehrt als Verstärker (Reinforcement) und Sprechtraining, das die Lust an der sprachlichen Kreativität fördert.
Welche Rolle spielt der Spieltrieb für die Entstehung von Humor?
Forscher sehen den Spieltrieb als direkten Vorläufer des Humors. Lachen galt ursprünglich als ein Spielsignal, das eine erfolgreiche Interaktion im sozialen Kontext ermöglicht.
Was versteht man unter der Inkongruenztheorie des Humors?
Die Inkongruenztheorie besagt, dass Humor auf der Wahrnehmung von Kontrasten und Widersprüchen basiert. Wenn Erwartungen durch eine überraschende Wendung durchbrochen werden, entsteht ein komischer Effekt.
Was sind semantische Verkehrungen im kindlichen Humor?
Semantische Verkehrungen sind eine Entwicklungsphase des Humors, in der Kinder bewusst Bedeutungen von Wörtern vertauschen oder Dinge falsch benennen, um Komik zu erzeugen.
Gibt es Unterschiede im Humorverhalten zwischen Jungen und Mädchen?
Ja, die Forschung weist auf Unterschiede im Humor- und Sprachverhalten hin, die oft soziokulturell geprägt sind und sich in der Art der Interaktion widerspiegeln.
- Quote paper
- Mareke Dreyer (Author), 2006, Spielen mit Sprache - zum Zusammenhang von Humor und Sprachentwicklung bei Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62423