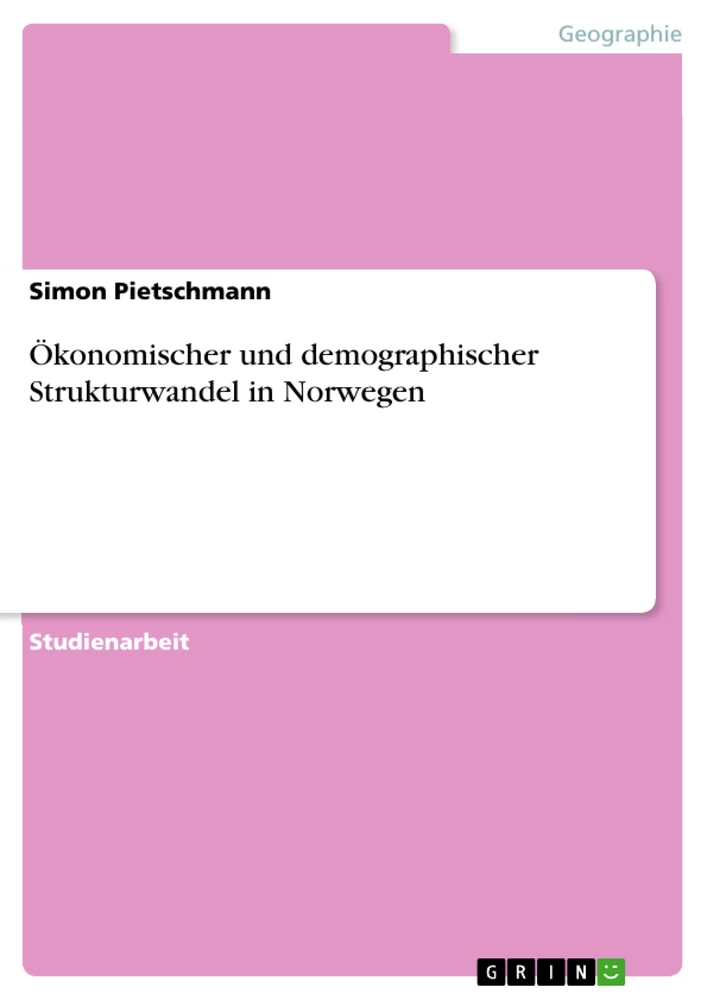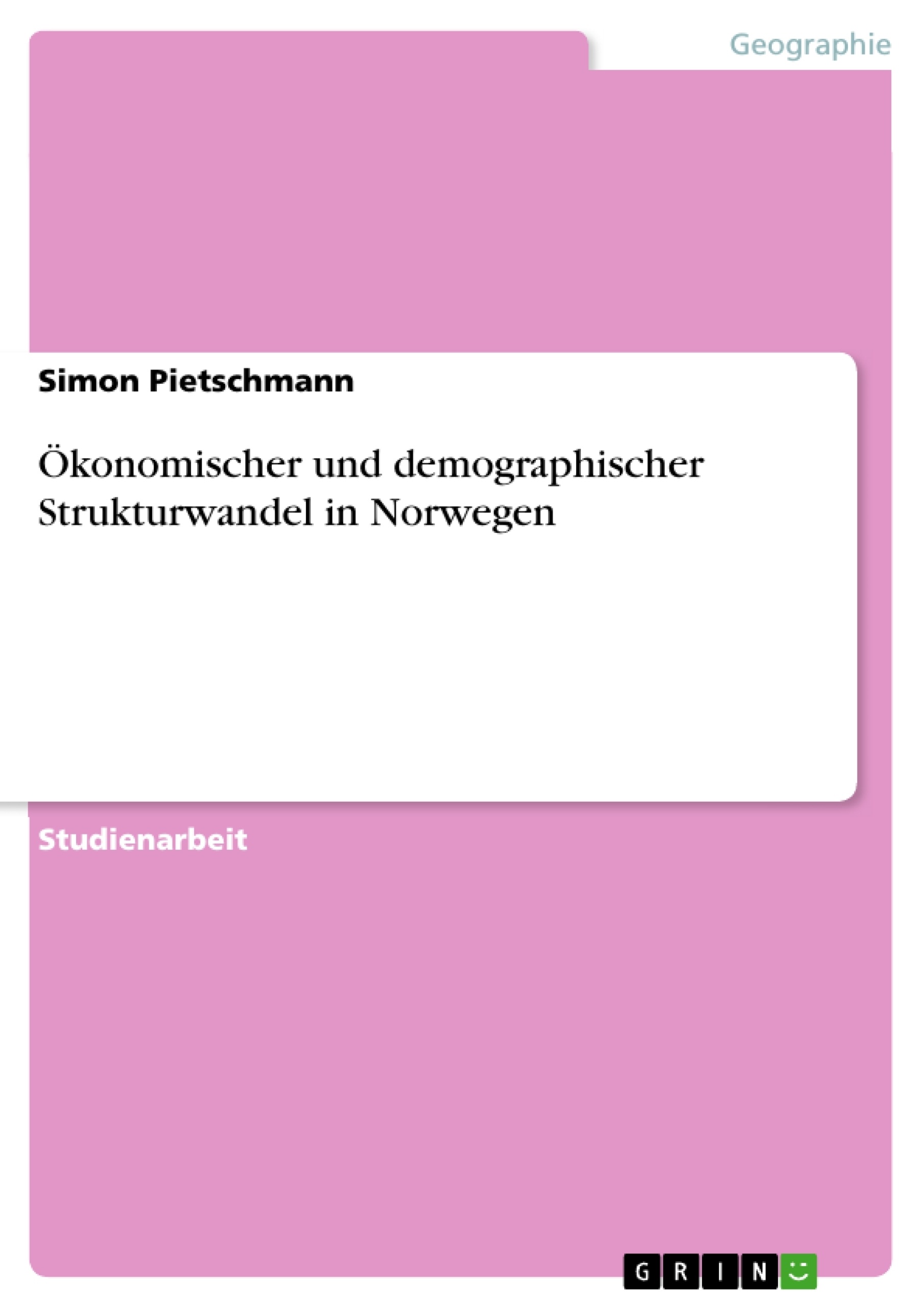Mit Norwegen assoziieren noch immer sehr viele Menschen Fjorde, Angeln, Pullover, abgelegene Blockhütten und das Königshaus. Es scheint so, als ob dieses Land, welches flächenmäßig beinahe so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, aber nur einen Bruchteil von dessen Bevölkerung beheimatet, seit Jahrzehnten in romantischer Naturidylle dahinschwebt. Doch der Schein trügt. Norwegen hat seit dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Strukturwandel erlebt. Ziel dieser Arbeit ist es, diesen Transformationsprozess näher zu beleuchten und wesentliche Merkmale und Auswirkungen herauszukristallisieren. Dabei richtet sich der Fokus im Folgenden zunächst auf den ökonomischen Wandel, da dieser Erklärungsmuster für Veränderungen in der Sozial- und Siedlungsstruktur bietet. Im Anschluss daran wird der demographische Wandel untersucht, weil sich an ihm eine Beziehung zur ökonomischen Entwicklung illustrieren lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil: Strukturwandel in Norwegen
- Ökonomischer Wandel
- National
- Primärer Sektor
- Fischfang und Fischaufzucht
- Land- und Forstwirtschaft
- Sekundärer Sektor
- Tertiärer Sektor
- Demographischer Wandel
- Natürliche Bevölkerungsbewegung
- Bevölkerungswanderung
- Folgen des Strukturwandels
- Ökonomischer Wandel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Strukturwandel in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg und hat zum Ziel, den Transformationsprozess näher zu beleuchten und wichtige Merkmale und Auswirkungen herauszukristallisieren. Dabei wird der Fokus zunächst auf den ökonomischen Wandel gelegt, der Erklärungsmuster für Veränderungen in der Sozial- und Siedlungsstruktur bietet. Anschließend wird der demographische Wandel untersucht, um eine Beziehung zur ökonomischen Entwicklung aufzuzeigen.
- Ökonomischer Wandel in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg
- Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und dessen Auswirkungen
- Veränderungen in den Wirtschaftssektoren (Primär-, Sekundär- und Tertiärsektor)
- Demographische Entwicklung und ihre Beziehung zum ökonomischen Wandel
- Folgen des Strukturwandels für die norwegische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung bietet eine kurze Einführung in die Thematik des Strukturwandels in Norwegen und stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit vor.
- Hauptteil: Strukturwandel in Norwegen:
- Ökonomischer Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet den ökonomischen Wandel in Norwegen, beginnend mit einer Betrachtung des Bruttoinlandsprodukts und seiner Entwicklung. Es werden die verschiedenen Wirtschaftssektoren (Primär-, Sekundär- und Tertiärsektor) analysiert und deren Veränderungen im Laufe der Zeit dargestellt.
- Demographischer Wandel: Dieses Kapitel untersucht den demographischen Wandel in Norwegen und fokussiert auf die natürliche Bevölkerungsbewegung und die Bevölkerungswanderung.
- Folgen des Strukturwandels: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des Strukturwandels auf die norwegische Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Strukturwandel, Norwegen, ökonomischer Wandel, demographischer Wandel, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Wirtschaftssektoren, Fischfang, Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen, Bevölkerungsentwicklung, natürliche Bevölkerungsbewegung, Bevölkerungswanderung, Folgen des Strukturwandels.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Strukturwandel hat Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt?
Norwegen hat sich von einer eher traditionell geprägten Gesellschaft hin zu einer modernen Industrienation mit einem starken Dienstleistungssektor entwickelt, wobei die Entdeckung von Ressourcen und der technologische Fortschritt eine zentrale Rolle spielten.
Wie hat sich der primäre Sektor in Norwegen verändert?
Obwohl Fischfang und Landwirtschaft historisch wichtig waren, hat ihre relative wirtschaftliche Bedeutung abgenommen. Dennoch bleibt die Fischaufzucht (Aquakultur) ein bedeutender Teil der modernen norwegischen Wirtschaft.
Was ist der Fokus der demographischen Untersuchung in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die natürliche Bevölkerungsbewegung (Geburten/Sterbefälle) und die Binnenwanderung, um den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Siedlungsstruktur aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für die Analyse?
Das BIP dient als zentraler Indikator für den ökonomischen Wandel und hilft dabei, die Transformationsprozesse der verschiedenen Wirtschaftssektoren über die Jahrzehnte hinweg zu quantifizieren.
Was sind die Folgen des Strukturwandels für die norwegische Gesellschaft?
Der Wandel führte zu Veränderungen in der Sozialstruktur, Urbanisierungsprozessen und einer Verschiebung der Arbeitsplätze vom primären und sekundären Sektor hin zum tertiären Sektor (Dienstleistungen).
- Quote paper
- Simon Pietschmann (Author), 2006, Ökonomischer und demographischer Strukturwandel in Norwegen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62477