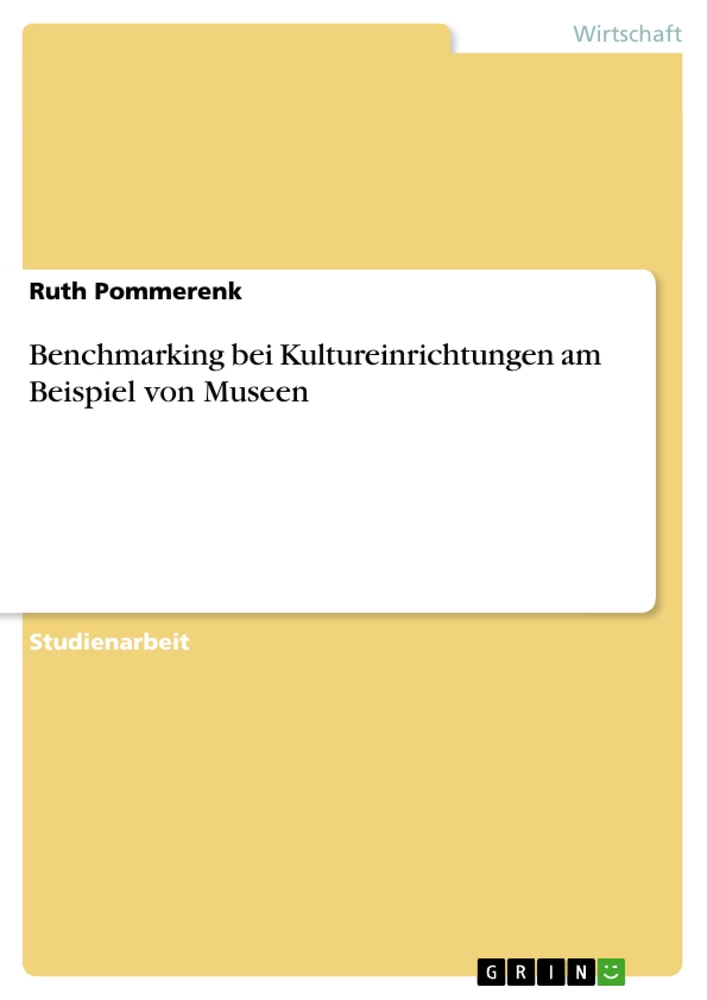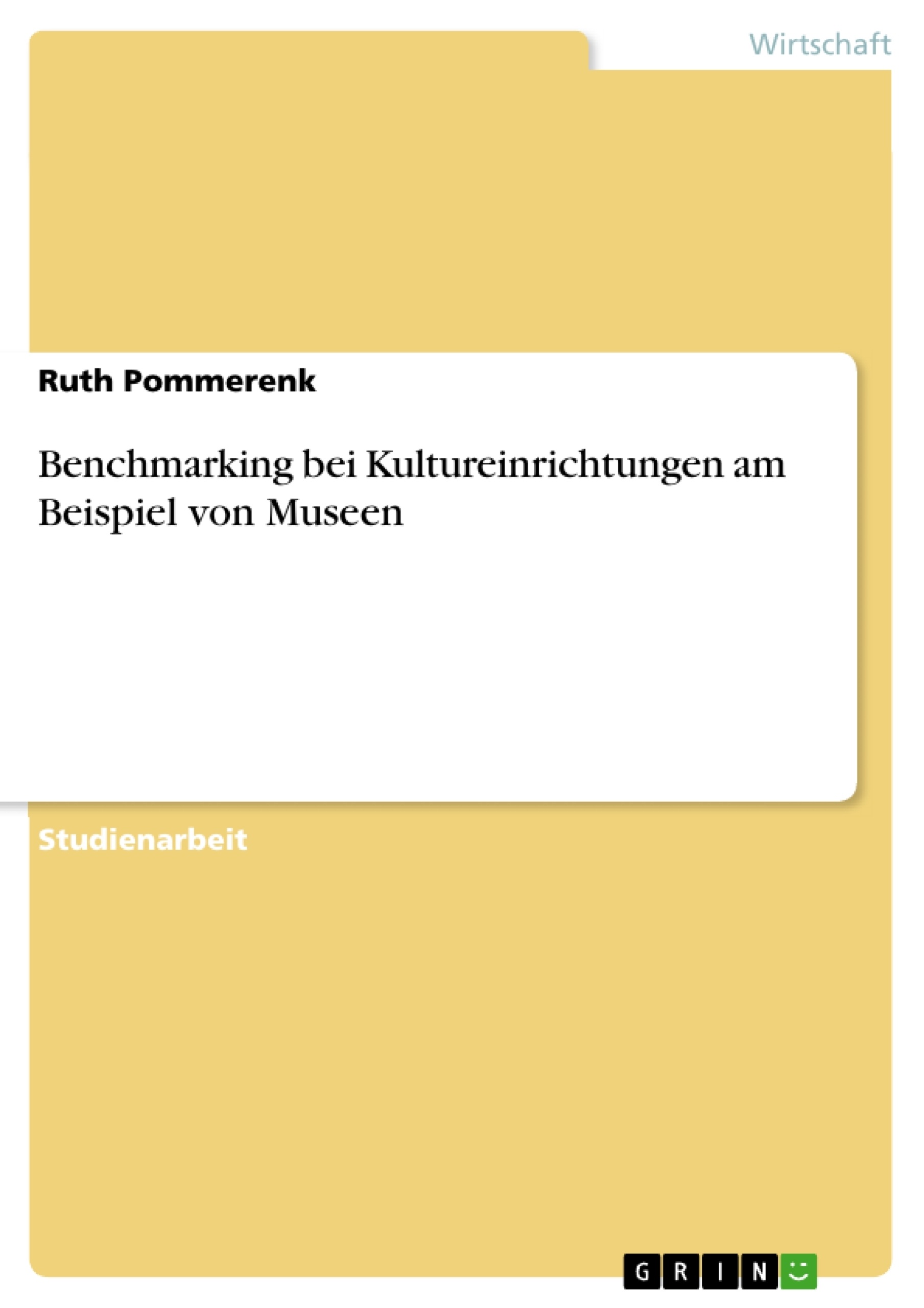Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sehen sich Museen mit großen Herausforderungen konfrontiert: Da die öffentliche Hand zunehmend weniger Mittel für die Finanzierung kultureller Aufgaben zur Disposition stellt, herrscht zwischen den öffentlichen Kultureinrichtungen ein heftiger Verteilungskampf, in dem sich die Museen auf Dauer behaupten müssen. Zudem hat in den letzten Jahren die Zahl der privaten Anbieter deutlich zugenommen, die - in Konkurrenz zu den Museen - vielfältige Kultur-, Bildungs-, Unterhaltungs- und Freizeiterlebnisse offerieren. Deshalb werden Museen im Wettbewerb um das Interesse der Besucher nur dann langfristig gegenüber anderen Kultur- und Freizeitanbietern bestehen können, wenn sie sich Wettbewerbsvorteile erarbeiten, also von den Besuchern als einzigartig und unverwechselbar wahrgenommen werden. Da sich Vorteile nicht ohne die genaue Kenntnis der Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen der Besucher aufbauen lassen, gilt als zentrales Mittel zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen die Besucherorientierung. Eine nachhaltige Verbesserung der Besucherorientierung von Museen lässt sich mit Hilfe der Managementmethode Benchmarking realisieren.
Benchmarking ist eine mittlerweile in vielen Wirtschaftszweigen erprobte und bewährte Mangementmethode für das Lernen von "besten Lösungen". Sie zielt darauf ab, durch den Vergleich zwischen Einrichtungen herauszufinden, wo innerhalb der eigenen Organisation Verbesserungspotentiale existieren und wie diese ausgeschöpft werden können. Benchmarking kann Museen somit dabei helfen Schwachstellen im Hinblick auf ihre Besucherorientierung zu ermitteln und Lösungswege für Verbesserungen zu finden, um im kulturellen Marktwettbewerb bestehen zu können.
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der Managementmethode Benchmarking, wobei Begriffsdefinitionen von Benchmarking vorgenommen und die historische Entwicklung sowie die Ziele des Benchmarking erläutert werden. Desweiteren wird die Stellung des Benchmarking im Kontext der Managementinstrumente TQM, Kaizen und Business Reengineering beschrieben. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Arten des Benchmarking dargestellt. Dabei wird eine Differenzierung nach Vergleichspartnern, die die Unterscheidung in internes und externes Benchmarking beinhaltet, sowie nach dem Benchmarking-Objekt vorgenommen. Anschließend werden die Phasen des Benchmarking entsprechend dem Prozessmodell von Camp dargestellt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Aufgabenstellung und thematische Abgrenzung
- Grundlagen der Managementmethode Benchmarking
- Begriffsdefinitionen
- Historische Entwicklung des Benchmarking
- Ziele des Benchmarking
- Benchmarking im Kontext anderer Managementinstrumente
- TQM
- Kaizen
- Business Reengineering
- Arten des Benchmarking
- Differenzierung nach Vergleichspartnern
- Internes Benchmarking
- Unternehmensbezogenes Benchmarking
- Konzernbezogenes Benchmarking
- Externes Benchmarking
- Marktbezogenes Benchmarking
- Branchenbezogenes Benchmarking
- Branchenunabhängiges Benchmarking
- Internes Benchmarking
- Differenzierung nach dem Benchmarking-Objekt
- Differenzierung nach Vergleichspartnern
- Phasen des Benchmarking
- Planung
- Analyse
- Integration
- Aktion
- Reife
- Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen
- Bestimmung des Benchmarking-Objekts
- Bestimmung der Benchmarks
- Bestimmung der Benchmarking-Partner
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Managementmethode Benchmarking und deren Anwendung im Kontext von Kultureinrichtungen, insbesondere Museen. Ziel ist es, die Grundlagen des Benchmarking zu erläutern und die verschiedenen Arten und Phasen des Prozesses zu beschreiben. Die Arbeit zeigt anhand eines Beispiels aus dem Museumsbereich, wie Benchmarking praktisch angewendet werden kann.
- Grundlagen und Definition des Benchmarking
- Verschiedene Arten des Benchmarking (intern, extern, etc.)
- Phasen des Benchmarking-Prozesses
- Anwendung des Benchmarking in Kultureinrichtungen
- Beispielhafte Umsetzung des Benchmarking am Beispiel von Museen
Zusammenfassung der Kapitel
Aufgabenstellung und thematische Abgrenzung: Dieses Kapitel beschreibt den Umfang und die Ziele der Arbeit. Es definiert den Fokus auf die Anwendung der Benchmarking-Methode in Kultureinrichtungen, speziell Museen, und grenzt die Arbeit thematisch ab. Es legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel, indem es den Kontext und die Forschungsfrage klar umreißt.
Grundlagen der Managementmethode Benchmarking: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Benchmarking dar. Es beginnt mit der Definition des Begriffs, beleuchtet die historische Entwicklung und beschreibt die Ziele, die mit Benchmarking verfolgt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einordnung des Benchmarking in den Kontext anderer Managementinstrumente wie TQM, Kaizen und Business Reengineering, um dessen Position und Nutzen im Managementkontext zu verdeutlichen. Die Interdependenzen und Unterschiede zu diesen anderen Methoden werden ausführlich diskutiert.
Arten des Benchmarking: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten des Benchmarking, unterteilt nach Vergleichspartnern (intern/extern, unternehmensbezogen/konzernbezogen, marktbezogen/branchenbezogen/branchenunabhängig) und dem Benchmarking-Objekt. Es vertieft die Verständnisgrundlagen durch detaillierte Erklärungen der verschiedenen Ansätze und deren Anwendungsszenarien. Die jeweilige Auswahl der Vergleichspartner und Objekte wird im Detail beleuchtet und deren Auswirkungen auf den Erfolg des Prozesses erläutert.
Phasen des Benchmarking: Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Phasen des Benchmarking-Prozesses von der Planung über die Analyse und Integration bis hin zur Aktion und dem Erreichen von Reife. Es erläutert die einzelnen Schritte detailliert und verdeutlicht die Bedeutung einer strukturierten Vorgehensweise für den Erfolg des Benchmarking. Der Fokus liegt auf den notwendigen Schritten und deren Abfolge, um einen erfolgreichen Benchmarking-Prozess zu gewährleisten.
Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen: Dieses Kapitel wendet die zuvor beschriebenen theoretischen Grundlagen auf den Praxisfall von Museen an. Es beschreibt die Bestimmung des Benchmarking-Objekts, der Benchmarks und der Benchmarking-Partner. Es illustriert die praktische Anwendung des Benchmarking an konkreten Beispielen aus dem Museumsbereich und zeigt die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Vorgehensweise auf. Die Auswahl geeigneter Kennzahlen und Vergleichspartner steht im Mittelpunkt der Diskussion.
Schlüsselwörter
Benchmarking, Kultureinrichtungen, Museen, Managementmethode, Vergleichspartner, Benchmarking-Objekt, TQM, Kaizen, Business Reengineering, interne Benchmarking, externe Benchmarking.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Benchmarking in Kultureinrichtungen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Managementmethode Benchmarking und ihrer Anwendung in Kultureinrichtungen, insbesondere Museen. Sie untersucht die Grundlagen des Benchmarking, beschreibt verschiedene Arten und Phasen des Prozesses und zeigt anhand eines Beispiels aus dem Museumsbereich, wie Benchmarking praktisch angewendet werden kann.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Grundlagen und Definition des Benchmarking, verschiedene Arten des Benchmarking (intern, extern usw.), die Phasen des Benchmarking-Prozesses, die Anwendung des Benchmarking in Kultureinrichtungen und eine beispielhafte Umsetzung am Beispiel von Museen. Zusätzlich werden verwandte Managementmethoden wie TQM, Kaizen und Business Reengineering im Kontext des Benchmarking diskutiert.
Welche Arten von Benchmarking werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen internem und externem Benchmarking. Internes Benchmarking umfasst unternehmensbezogenes und konzernbezogenes Benchmarking. Externes Benchmarking wird unterteilt in marktbezogenes, branchenbezogenes und branchenunabhängiges Benchmarking. Die Unterscheidung erfolgt außerdem nach dem Benchmarking-Objekt.
Welche Phasen umfasst der Benchmarking-Prozess?
Der Benchmarking-Prozess wird in fünf Phasen unterteilt: Planung, Analyse, Integration, Aktion und Reife. Jede Phase wird in der Arbeit detailliert beschrieben und deren Bedeutung für den Erfolg des Prozesses hervorgehoben.
Wie wird Benchmarking in Kultureinrichtungen, speziell Museen, angewendet?
Die Arbeit zeigt anhand eines Beispiels aus dem Museumsbereich, wie die Bestimmung des Benchmarking-Objekts, der Benchmarks und der Benchmarking-Partner erfolgt. Sie illustriert die praktische Anwendung und diskutiert Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Vorgehensweise im Museums Kontext.
Welche Managementmethoden werden im Vergleich zum Benchmarking betrachtet?
Die Arbeit setzt Benchmarking in Beziehung zu anderen Managementmethoden wie TQM (Total Quality Management), Kaizen (kontinuierliche Verbesserung) und Business Reengineering. Die Interdependenzen und Unterschiede zu diesen Methoden werden ausführlich diskutiert, um den Nutzen und die Positionierung des Benchmarking im Managementkontext zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Benchmarking, Kultureinrichtungen, Museen, Managementmethode, Vergleichspartner, Benchmarking-Objekt, TQM, Kaizen, Business Reengineering, internes Benchmarking, externes Benchmarking.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die Inhalte und Schwerpunkte jedes Abschnitts beschreibt. Diese Zusammenfassung gibt einen umfassenden Überblick über den Aufbau und die Argumentationslinie der Seminararbeit.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit der Managementmethode Benchmarking und deren Anwendung in Kultureinrichtungen auseinandersetzen. Sie bietet einen umfassenden Einblick in die Theorie und Praxis des Benchmarking im Kontext von Museen und anderen Kultureinrichtungen.
- Quote paper
- Ruth Pommerenk (Author), 2002, Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6248