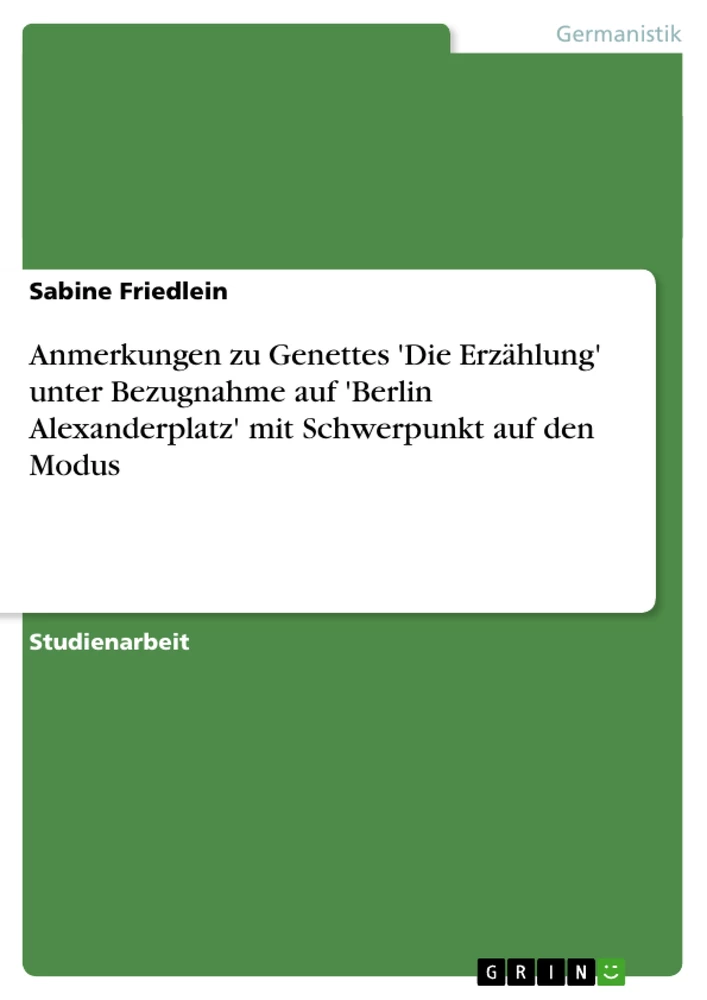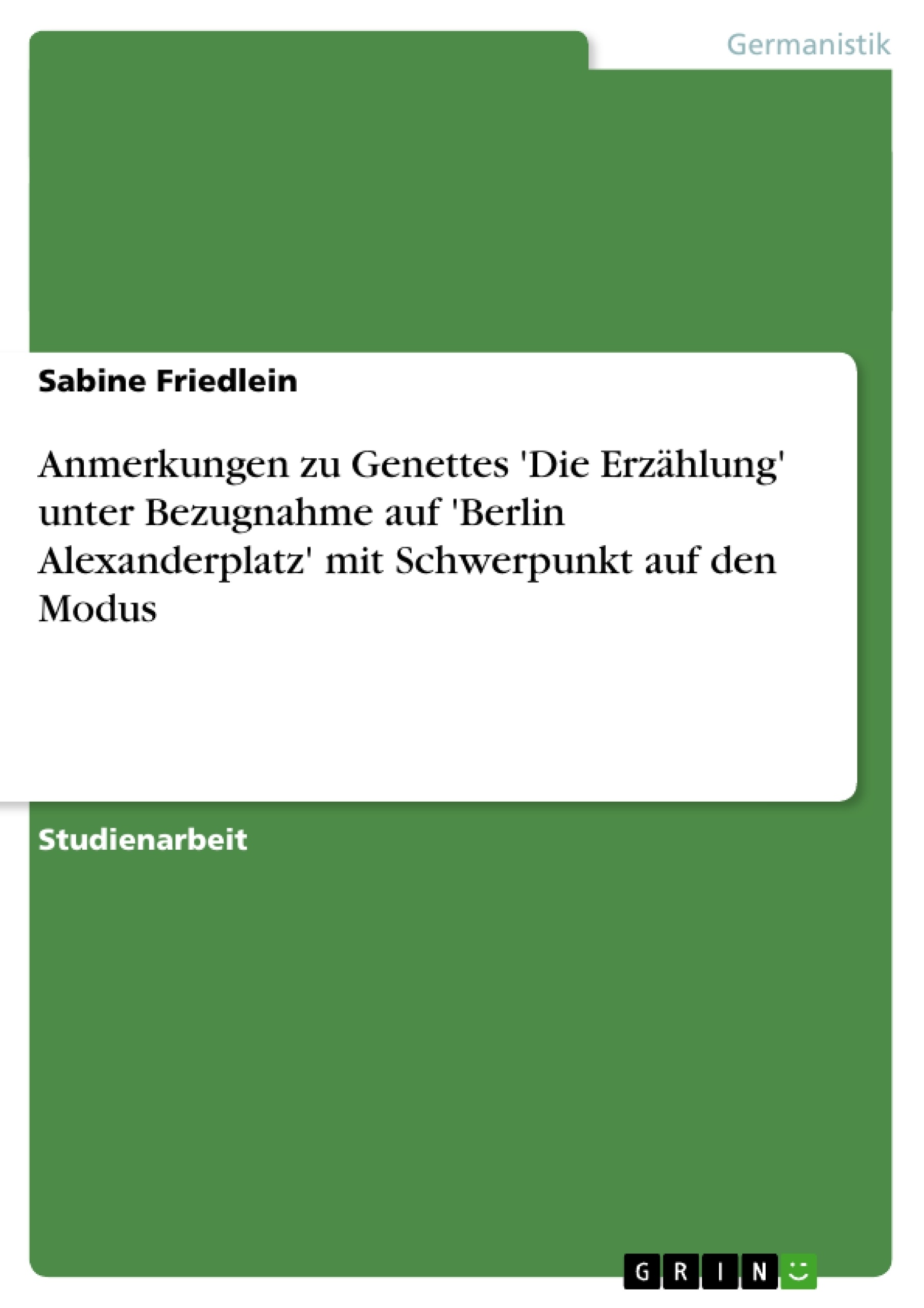Einleitung
Gérard Genette diskutiert seine Erzähltheorie Discours du récit (1972), bzw. Noveau discours du récit (1983) vor dem Hintergrund von Prousts A la recherche du temps perdu1. Döblins Berlin Alexanderplatz2 ist als „Kompendium moderner Erzählverfahren“3 nicht nur ebenso gut wie die Recherche geeignet, Genettes Theorie zu veranschaulichen, sondern es finden sich darüber hinaus Erzählstrukturen wieder, die in ihrer Komplexität Anlass für eine Prüfung dieses Analysemodells geben.
Genette ordnet den Discours nach den Prinzipien der grammatischen Konjugation, entlehnt ihr auch die Einteilung in die Kategorien erzählte Zeit oder Tempus, Erzählweise oder Modus, und Person oder Stimme.4 Die Besonderheiten des Modus unter Bezugnahme auf BAP herauszuarbeiten und gleichzeitig die Vereinbarkeiten, bzw. Unvereinbarkeiten zwischen Genettes „Theorie“ und Döblins „Praxis“ offenzulegen sind Ziel dieser Arbeit. Der Modus ist der natürliche Ausgangspunkt für diese kritische Untersuchung, da er als Bindeglied zwischen Tempus und Stimme fungiert. Theoretisch ein autonomes Gebilde, ist der Modus in der erzählerischen Praxis von den Elementen Tempus und Stimme gleichermaßen durchdrungen wenn nicht abhängig. Aus diesem Grund werden sich Begriffe aus den Kategorien Tempus und Stimme wiederfinden, ohne dass sie diesen explizit zugeordnet werden.
Während die Verbkonjugation gut auf die Kategorie des Tempus5 anwendbar und in den narrativen Diskurs übertragbar ist, zeigen sich Schwierigkeiten bei der Übertragung des grammatischen in einen narrativen Modus, da eine Erzählung selten im Konjunktiv verfasst wird, was ihrer Funktion, über ein bzw. mehrere Ereignisse (nicht Möglichkeiten) zu berichten zuwiderläuft. Somit ist der Indikativ nach Genette der einzige vorstellbare und charakteristische Modus der Erzählung.6 Die Präsentationsformen des Erzählten unterteilt Genette in die Parameter Distanz und Fokalisierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Genettes Distanz unter Bezugnahme auf Berlin Alexanderplatz.
- Theoretische Grundlagen: Von diegesis und mimesis zum narrativen und dramatischen Modus
- Der narrative Modus oder die Erzählung von Ereignissen.
- Der dramatische Modus: die drei Formen der Personenrede ….....
- Die Perspektive und ihre Zuordnung in Berlin Alexanderplatz......
- Schluss: Genettes Erzählung als moderne Erzähltheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Gérard Genettes Erzähltheorie und untersucht deren Anwendung auf Alfred Döblins Roman „Berlin Alexanderplatz“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Modus, einem zentralen Element von Genettes Analysemodell, und dessen Verbindung mit der erzählten Zeit (Tempus) und der Stimme.
- Analyse von Genettes Distanz und deren Bedeutung für die Rezeption von „Berlin Alexanderplatz“
- Untersuchung der narrativen und dramatischen Modi und ihrer Implikationen für die Erzählstruktur
- Beurteilung der Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen Genettes Theorie und Döblins Praxis
- Erörterung der Rolle der Perspektive im Roman und deren Verbindung zum Modus
- Bewertung der Relevanz von Genettes Erzähltheorie für die Analyse moderner Erzählwerke
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar und beschreibt die Relevanz von Genettes Erzähltheorie für die Analyse von „Berlin Alexanderplatz“. Sie erläutert den Fokus der Arbeit auf den Modus und die Beziehung zwischen Modus, Tempus und Stimme.
- Genettes Distanz unter Bezugnahme auf Berlin Alexanderplatz: Dieses Kapitel behandelt Genettes Konzept der Distanz und untersucht dessen Anwendung auf „Berlin Alexanderplatz“. Es beleuchtet die Rolle der Distanz in der Gestaltung der Erzählung und analysiert die Mittel, mit denen Döblin Distanz in seinem Roman erzeugt.
- Theoretische Grundlagen: Von diegesis und mimesis zum narrativen und dramatischen Modus: Dieser Abschnitt erörtert die theoretischen Grundlagen von Genettes Distanz und erklärt die Verbindung zwischen den narrativen und dramatischen Modi.
- Der narrative Modus oder die Erzählung von Ereignissen: Dieser Abschnitt fokussiert auf den narrativen Modus und erläutert dessen Eigenschaften und Funktionen.
- Der dramatische Modus: die drei Formen der Personenrede ….....: Dieser Abschnitt behandelt den dramatischen Modus und analysiert seine drei Formen der Personenrede.
- Die Perspektive und ihre Zuordnung in Berlin Alexanderplatz......: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Perspektive in „Berlin Alexanderplatz“ und analysiert, wie Döblin unterschiedliche Perspektiven in seinem Roman einsetzt. Es untersucht die Beziehung zwischen Perspektive und Modus und diskutiert die Auswirkungen der Perspektive auf die Rezeption des Romans.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Erzähltheorie, darunter Modus, Distanz, Erzählung, Erzähler, Perspektive, Tempus, Stimme, diegesis, mimesis, narrative und dramatische Modi, Personenrede, „Berlin Alexanderplatz“, und Gérard Genettes „Die Erzählung“. Die Analyse von „Berlin Alexanderplatz“ unter Verwendung von Genettes Theorie ermöglicht Einblicke in die Funktionsweise moderner Erzähltechniken und die Analyse komplexer Erzählstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus von Genettes Erzähltheorie in dieser Arbeit?
Der Schwerpunkt liegt auf der Kategorie „Modus“, die als Bindeglied zwischen Tempus (Zeit) und Stimme fungiert und die Präsentationsformen des Erzählten regelt.
Wie wird „Berlin Alexanderplatz“ in der Analyse genutzt?
Döblins Roman dient als Kompendium moderner Erzählverfahren, um die Grenzen und Möglichkeiten von Genettes Analysemodell in der literarischen Praxis zu prüfen.
Was versteht Genette unter „Distanz“?
Distanz bezieht sich auf den Grad der Vermittlung zwischen dem erzählten Ereignis und dem Leser, unterteilt in narrativen (Bericht) und dramatischen (Szenisch) Modus.
Was ist der Unterschied zwischen Diegesis und Mimesis?
Diegesis bezeichnet das reine Erzählen (Bericht), während Mimesis die Nachahmung oder Darstellung von Handlung und Rede (Zeigen) bedeutet.
Welche Rolle spielt die Fokalisierung bei Genette?
Fokalisierung bezeichnet die Perspektive oder den Blickwinkel, aus dem die Geschichte wahrgenommen wird, was entscheidend für die Informationsvergabe an den Leser ist.
- Arbeit zitieren
- Sabine Friedlein (Autor:in), 2003, Anmerkungen zu Genettes 'Die Erzählung' unter Bezugnahme auf 'Berlin Alexanderplatz' mit Schwerpunkt auf den Modus , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62571