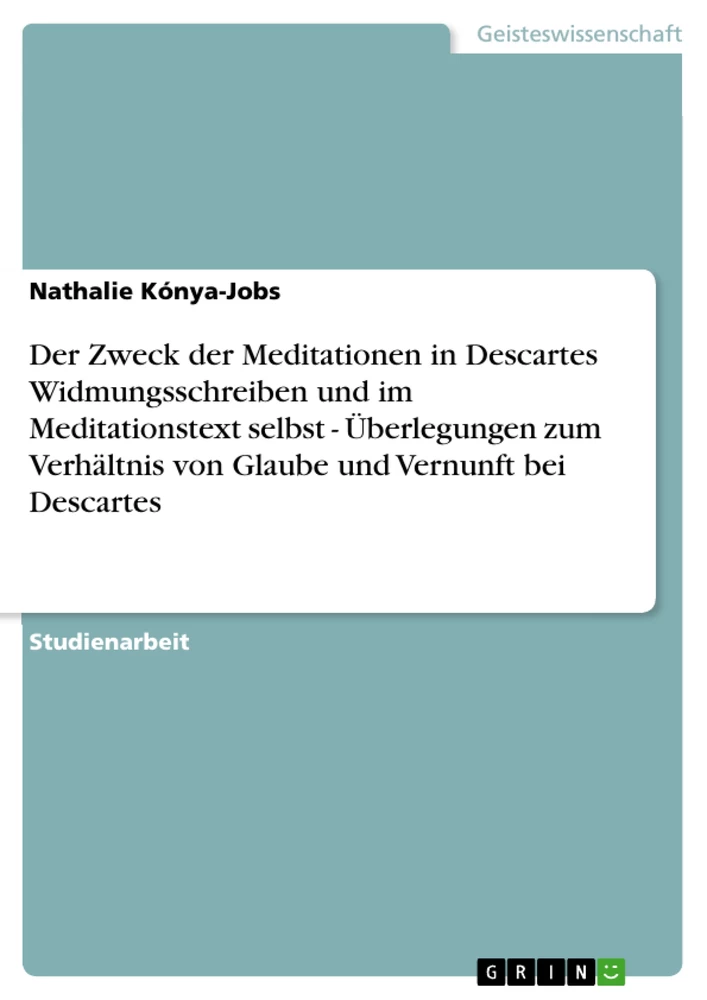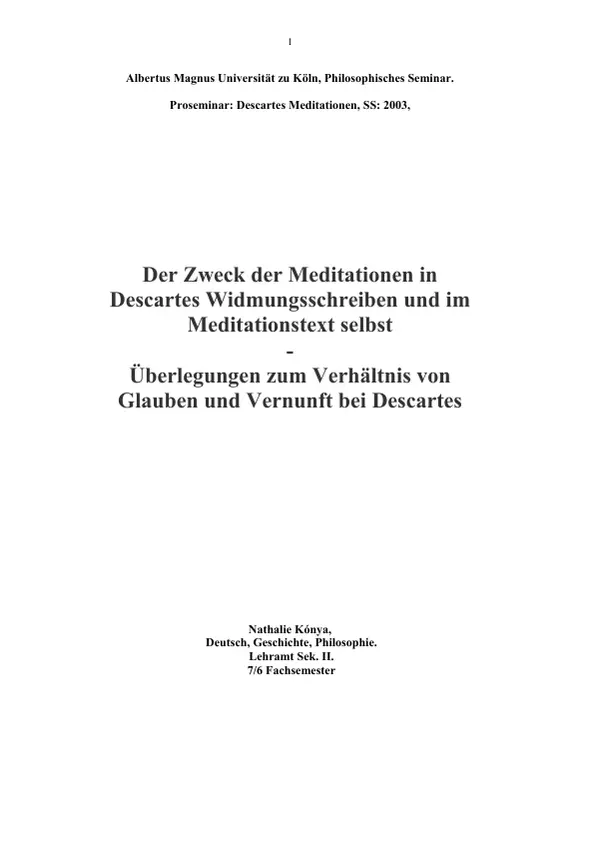Der Name René Descartes löst häufig folgende Reaktionen aus: Begründer der neuzeitlichen Philosophie, Rationalist, Wissenschaftler im strengsten Sinne, Erfinder der Philosophie des Subjekts und nicht zuletzt hört man den bekannten Satz: ‚Cogito ergo sum’1.
Gerade weil Descartes mit dem Nimbus der kompromisslosen Wissenschaftlichkeit, der Unbestechlichkeit und Aufgeklärtheit behaftet ist, neigt man als Leser seiner Texte dazu, jede Ungereimtheit in seinem Werk, die dann sogleich als Ungereimtheit in seinem Denken verstanden wird, was noch diskutiert werden muss, besonders kritisch zu betrachten. Ein Philosoph und Naturwissenschaftler, der mit den oben genannten Attributen behaftet ist, muss sich auch durch Stimmigkeit und Stringenz seines Denkens auszeichnen.
Gibt es jedoch Unstimmigkeiten bei Descartes?
Wie erklärt man sich, dass der Philosoph, mit dessen Schaffen nach unbestrittener Schulmeinung die neuzeitliche Philosophie beginnt, in seinem vielleicht wichtigsten Werk, den Meditationes de prima philosophia, es sich angelegen sein lässt Gott zu beweisen? Wollte Descartes nicht Schluss machen mit der Verquickung von Glauben und Vernunft? Was haben Glauben und Vernuft überhaupt miteinander zu tun?
Diesen Fragen möchte ich in meiner Arbeit nachgehen. Dazu werde ich das Widmungsschreiben Descartes an die Sorbonne sowie seine eigene Einleitung des Meditations-Textes daraufhin untersuchen, ob sie helfen können die gestellten Fragen zu beantworten. Ich beziehe selbstverständlich den Text der Meditationen in meine Überlegungen mit ein. Ein besonderes Augenmerk soll darauf gerichtet werden, inwiefern Descartes von den Prämissen seiner einleitenden Worte in den Meditationen abgewichen ist. Und ob der Zweck, den der Philosoph im Widmungsschreiben nennt, auch als solcher im Meditations-Text erkennbar ist. Nicht zuletzt möchte ich das Verhältnis von Glauben und Vernunft in Descartes’ Denken thematisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Überlegungen zur Fragestellung
- Der Zweck der Meditationen
- Der Zweck der Meditationen, wie er in Descartes Widmungsschreiben an die Sorbonne deutlich wird
- Descartes Vorwort an den Leser
- Der Zweck der Meditationen im Text der ,,Meditationes de prima Philosophia“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zweck von Descartes' Meditationen, indem sie das Widmungsschreiben an die Sorbonne und die Einleitung des Meditationstextes analysiert. Es wird der Frage nachgegangen, ob Descartes' Gottesbeweise mit seinem rationalistischen Ansatz vereinbar sind und welches Verhältnis zwischen Glauben und Vernunft in seinem Denken besteht. Die Analyse soll klären, ob der im Widmungsschreiben genannte Zweck der Meditationen auch im Text selbst erkennbar ist.
- Der Zweck der Meditationen im Widmungsschreiben und im Text selbst
- Das Verhältnis von Glauben und Vernunft bei Descartes
- Die Rolle der Gottesbeweise in Descartes' Philosophie
- Die apologetische Funktion der Meditationen
- Descartes' Umgang mit potenzieller Kritik und Anfeindungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Überlegungen zur Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zweck von Descartes' Meditationen und dem Verhältnis von Glauben und Vernunft in seinem Werk. Sie hebt das Paradoxon der Gottesbeweise hervor: Glauben setzt keinen Beweis voraus, ein Beweis widerlegt den Glauben. Descartes' apologetischer Ansatz im Widmungsschreiben wird als Ausgangspunkt der Analyse genannt, ebenso die Frage nach möglicher Selbstzensur aufgrund des damals bestehenden gesellschaftlichen und religiösen Klimas. Die Einleitung legt die methodische Vorgehensweise fest: Analyse des Widmungsschreibens, der Einleitung der Meditationen und des Textes selbst, mit besonderem Fokus auf mögliche Abweichungen zwischen den einleitenden Worten und dem Haupttext.
Der Zweck der Meditationen: Dieses Kapitel untersucht den in Descartes' Widmungsschreiben an die Sorbonne zum Ausdruck kommenden Zweck der Meditationen. Der höfliche, aber selbstbewusste Ton gegenüber den Theologen der Sorbonne wird analysiert. Descartes argumentiert, dass die Philosophie besser geeignet sei, Fragen nach Seele und Gott zu beantworten als die Theologie, da Ungläubige durch "natürliche Gründe" leichter zu überzeugen seien als durch religiöse Argumente. Die ausführliche Rechtfertigung des Gottesbeweises durch einen Nicht-Theologen wird im Kontext möglicher Ablehnung durch die theologische Fakultät interpretiert, was auf ein strategisches Kalkül des Autors hindeutet.
Schlüsselwörter
René Descartes, Meditationes de prima philosophia, Gottesbeweise, Glauben und Vernunft, Rationalismus, Apologetik, Sorbonne, Wissenschaftlichkeit, Philosophie des Subjekts, Cogito ergo sum.
Häufig gestellte Fragen zu Descartes' "Meditationes de prima Philosophia"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zweck von René Descartes' "Meditationes de prima Philosophia". Im Mittelpunkt steht die Analyse des Widmungsschreibens an die Sorbonne und der Einleitung des Meditationstextes, um Descartes' Intentionen und die Beziehung zwischen Glauben und Vernunft in seinem Werk zu verstehen.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Vereinbarkeit von Descartes' Gottesbeweisen mit seinem rationalistischen Ansatz. Sie untersucht das Verhältnis zwischen Glauben und Vernunft in Descartes' Denken und analysiert, ob der im Widmungsschreiben genannte Zweck der Meditationen auch im Text selbst erkennbar ist. Weiterhin wird Descartes' Umgang mit potenzieller Kritik und Anfeindungen beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitende Überlegungen zur Fragestellung, Der Zweck der Meditationen (mit Unterkapiteln zum Widmungsschreiben und Vorwort), Der Zweck der Meditationen im Text der ,,Meditationes de prima Philosophia“, und Schlussbetrachtung.
Wie wird der Zweck der Meditationen untersucht?
Der Zweck der Meditationen wird anhand einer detaillierten Analyse des Widmungsschreibens an die Sorbonne und des Vorworts untersucht. Dabei wird der Ton, die Argumentationsweise und die strategische Kommunikation Descartes' im Kontext der damaligen theologischen und gesellschaftlichen Situation analysiert. Der Vergleich mit dem Haupttext der Meditationen soll mögliche Diskrepanzen aufzeigen.
Welche Rolle spielen die Gottesbeweise in der Analyse?
Die Gottesbeweise spielen eine zentrale Rolle, da sie die Verbindung zwischen Glauben und Vernunft in Descartes' Philosophie verdeutlichen. Die Arbeit untersucht, ob diese Beweise mit seinem rationalistischen Ansatz vereinbar sind und welche apologetische Funktion sie im Kontext des Widmungsschreibens und der damaligen gesellschaftlichen Situation einnehmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: René Descartes, Meditationes de prima philosophia, Gottesbeweise, Glauben und Vernunft, Rationalismus, Apologetik, Sorbonne, Wissenschaftlichkeit, Philosophie des Subjekts, Cogito ergo sum.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welchen Zweck verfolgte Descartes mit seinen Meditationen, und wie verhält sich sein rationalistisches Denken zu seinem Glauben?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textanalytische Methode. Das Widmungsschreiben, die Einleitung und der Haupttext der Meditationen werden detailliert analysiert und verglichen, um den Zweck der Meditationen und das Verhältnis von Glauben und Vernunft zu klären.
- Arbeit zitieren
- Nathalie Kónya-Jobs (Autor:in), 2003, Der Zweck der Meditationen in Descartes Widmungsschreiben und im Meditationstext selbst - Überlegungen zum Verhältnis von Glaube und Vernunft bei Descartes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62595