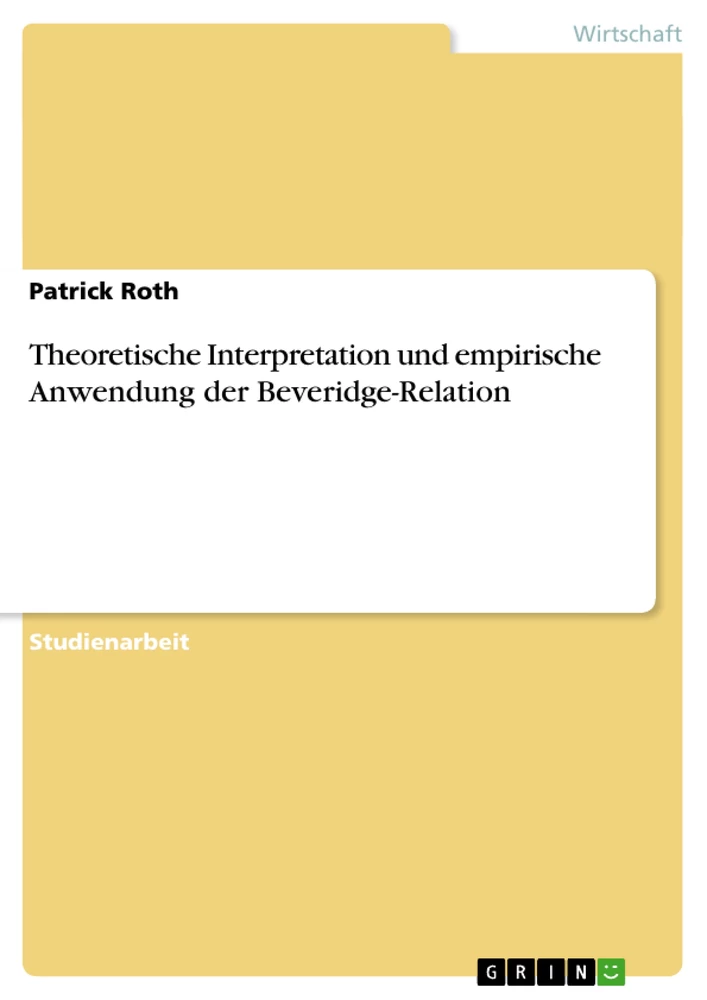Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist seit Mitte der siebziger Jahre zu einem zentralen gesellschaftlichen Problem geworden. Man kann hierbei grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Ursachen für Arbeitslosigkeit unterscheiden. Eine mögliche Ursache ist eine Diskrepanz zwischen dem Arbeitskräftepotential und der Menge der insgesamt verfügbaren Arbeitsplätze. Die zweite mögliche Ursache sind Friktionen in der Vermittlung von Angebot und Nachfrage durch den Markt1. Ein theoretisches Modell, das es erlaubt zwischen diesen Ursachen für Arbeitslosigkeit zu unterscheiden, basiert auf der Beveridge-Relation. Nachfolgend werden einige Gründe für die simultane Existenz von Arbeitslosigkeit und offenen Stellen aufgezeigt. Danach folgt mit dem Stromgrössenmodell ein einfaches Modell, das als Grundlage des anschließenden Beveridge-Kurven-Modells gesehen werden kann. Nach einer theoretischen Interpretation der Beveridge-Relation anhand der Beveridge-Kurve, werden einige Schwächen aufgezeigt, die sich sowohl bei der Diagnose dieser Funktion, sowie auch bei der empirischen Ermittlung der benötigten Daten ergeben. Schließlich folgt eine empirische Anwendung dieser theoretischen Grundlagen anhand der Werte, welche sich für die Beveridge-Kurve für Deutschland , sowie für das Euro-Währungsgebiet ergeben. Von besonderem Interesse ist hierbei, welche Ursache für die angestiegene Arbeitslosigkeit besteht. Hier wird also die Frage diskutiert ob dieser Anstieg auf einer verschlechterten Vermittlungseffizienz beruht, oder ob gesamtwirtschaftlich-klassische Probleme hierfür verantwortlich sind. Zum Schluß dieser Arbeit erfolgt ein Ausblick über zukünftige Erwartungen und Möglichkeiten, die sich aus den Vorschlägen der "Hartz-Kommission" und der zu Beginn der Jahres 2003 gestarteten Vermittlungsoffensive ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Problemstellung
- Arbeitslosigkeit und offene Stellen
- Das Stromgrössenmodell
- Die Beveridge-Kurve
- Schwächen des Modells
- Die Vakanzen
- Die Arbeitslosendaten
- Die Schleifenbewegung der Beveridge-Kurve
- Verschiebung oder Bewegung auf der Beveridge-Kurve
- Die Beveridge-Kurve für Deutschland
- Die Beveridge-Kurve des Euro-Währungsgebiets
- Ausblick
- Anhang 1
- Anhang 2
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Beveridge-Relation, ein theoretisches Modell zur Analyse von Arbeitslosigkeit. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Relation zu erläutern und ihre empirische Anwendbarkeit anhand von Daten für Deutschland und das Euro-Währungsgebiet zu demonstrieren. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen simultaner Arbeitslosigkeit und offener Stellen.
- Theoretische Interpretation der Beveridge-Relation
- Empirische Anwendung des Modells auf Deutschland und das Euro-Währungsgebiet
- Analyse der Schwächen des Beveridge-Kurven-Modells
- Unterscheidung zwischen friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit
- Diskussion der Ursachen für steigende Arbeitslosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit untersucht die Ursachen von Arbeitslosigkeit in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre, wobei zwischen einer Diskrepanz zwischen Arbeitskräften und Arbeitsplätzen und Friktionen im Marktmechanismus unterschieden wird. Die Beveridge-Relation wird als theoretisches Werkzeug zur Unterscheidung dieser Ursachen eingeführt. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau, der die Analyse der Beveridge-Kurve und ihrer Schwächen sowie eine empirische Anwendung auf Deutschland und das Euro-Währungsgebiet umfasst.
Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Dieses Kapitel beschreibt die friktionell-strukturelle Arbeitslosigkeit, die auf Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Arbeitslosen auf offene Stellen aufgrund von Informationsdefiziten, qualitativen Unterschieden zwischen Angebot und Nachfrage (Mismatch-Arbeitslosigkeit) und regionaler Immobilität zurückzuführen ist. Es werden drei wesentliche Ursachen für Mismatch-Arbeitslosigkeit herausgearbeitet.
Das Stromgrössenmodell: [Leider fehlt im bereitgestellten Text eine explizite Beschreibung dieses Kapitels. Es ist anzunehmen, dass dieses Kapitel ein ökonometrisches Modell zur Erklärung der Arbeitsmarktdynamik beinhaltet, welches die Grundlage für die Interpretation der Beveridge-Kurve liefert.]
Die Beveridge-Kurve: Dieses Kapitel behandelt die theoretische Interpretation der Beveridge-Kurve als graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Arbeitslosigkeit und offenen Stellen. Die Kurve visualisiert die Effizienz des Arbeitsmarktes und erlaubt Rückschlüsse auf die Ursachen von Arbeitslosigkeit (Mismatch vs. gesamtwirtschaftliche Faktoren).
Schwächen des Modells: Dieses Kapitel analysiert die Limitationen des Beveridge-Kurven-Modells. Es diskutiert Probleme bei der Datenbeschaffung (genaue Erfassung von Vakanzen und Arbeitslosenzahlen) und die Interpretation der Kurvenbewegung (Verschiebung vs. Bewegung entlang der Kurve).
Schlüsselwörter
Beveridge-Relation, Arbeitslosigkeit, offene Stellen, Mismatch-Arbeitslosigkeit, friktionelle Arbeitslosigkeit, strukturelle Arbeitslosigkeit, Beveridge-Kurve, Stromgrössenmodell, Deutschland, Euro-Währungsgebiet, Vermittlungseffizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Analyse der Beveridge-Kurve
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Beveridge-Relation, ein ökonomisches Modell zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Arbeitslosigkeit und offenen Stellen. Der Fokus liegt auf der theoretischen Erklärung des Modells und seiner empirischen Anwendung auf Deutschland und das Euro-Währungsgebiet. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen für simultan auftretende Arbeitslosigkeit und offene Stellen, insbesondere die Unterscheidung zwischen friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die theoretische Interpretation der Beveridge-Relation, die empirische Anwendung des Modells auf Deutschland und das Euro-Währungsgebiet, die Analyse der Schwächen des Beveridge-Kurven-Modells, die Unterscheidung zwischen friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit sowie die Diskussion der Ursachen für steigende Arbeitslosigkeit. Es wird ein Stromgrössenmodell verwendet, um die Arbeitsmarktdynamik zu erklären.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit verwendet Daten zur Arbeitslosigkeit und zu offenen Stellen in Deutschland und dem Euro-Währungsgebiet, um die Beveridge-Kurve empirisch zu analysieren. Die genauen Datenquellen werden im Literaturverzeichnis angegeben. Die Arbeit diskutiert auch die Herausforderungen bei der Datenerhebung, insbesondere die Schwierigkeiten bei der präzisen Erfassung von Vakanzen.
Welche Schwächen des Beveridge-Kurven-Modells werden diskutiert?
Die Arbeit identifiziert und diskutiert verschiedene Schwächen des Modells. Dies umfasst Probleme bei der Datenbeschaffung (genaue Erfassung von Vakanzen und Arbeitslosenzahlen) und die Interpretation der Kurvenbewegung (Verschiebung vs. Bewegung entlang der Kurve). Die Arbeit geht auch auf die Limitationen des Modells bei der Erklärung von Arbeitslosigkeit ein.
Wie wird die Beveridge-Kurve interpretiert?
Die Beveridge-Kurve wird als graphische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Arbeitslosigkeit und offenen Stellen interpretiert. Die Form und Lage der Kurve geben Aufschluss über die Effizienz des Arbeitsmarktes und helfen, die Ursachen von Arbeitslosigkeit zu identifizieren (Mismatch vs. gesamtwirtschaftliche Faktoren).
Welche Arten von Arbeitslosigkeit werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit. Friktionelle Arbeitslosigkeit resultiert aus Informationsdefiziten und Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Arbeitssuchenden auf offene Stellen. Strukturelle Arbeitslosigkeit entsteht durch ein Missverhältnis zwischen den Qualifikationen der Arbeitslosen und den Anforderungen der offenen Stellen (Mismatch).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Beveridge-Relation, Arbeitslosigkeit, offene Stellen, Mismatch-Arbeitslosigkeit, friktionelle Arbeitslosigkeit, strukturelle Arbeitslosigkeit, Beveridge-Kurve, Stromgrössenmodell, Deutschland, Euro-Währungsgebiet, Vermittlungseffizienz.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Ein zusammenfassendes Fazit ist im bereitgestellten Text nicht explizit enthalten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der theoretischen Grundlagen und die empirische Analyse der Beveridge-Kurve. Es wird eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen des Modells vorgenommen.
- Arbeit zitieren
- Diplom Volkswirt Patrick Roth (Autor:in), 2003, Theoretische Interpretation und empirische Anwendung der Beveridge-Relation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62639